 Die junge, 1986 in Zagreb geborene und in Zürich aufgewachsene Ivna Žic schrieb mit „Die Nachkommende“ einen Roman, der nicht in erster Linie eine Geschichte erzählen will. Ivna Žic erzählt Bilder, die sie aus Vergangenheit und Gegenwart mit sich trägt, Bilder, die mit dem Lesen zu Geschichten werden. So wie ein Grossvater mit einem Mal zu malen aufhört und nie eine Antwort dafür gibt, warum er den Pinsel weglegte, so taucht Ivna Žic als Prosamalerin auf und malt beeindruckend.
Die junge, 1986 in Zagreb geborene und in Zürich aufgewachsene Ivna Žic schrieb mit „Die Nachkommende“ einen Roman, der nicht in erster Linie eine Geschichte erzählen will. Ivna Žic erzählt Bilder, die sie aus Vergangenheit und Gegenwart mit sich trägt, Bilder, die mit dem Lesen zu Geschichten werden. So wie ein Grossvater mit einem Mal zu malen aufhört und nie eine Antwort dafür gibt, warum er den Pinsel weglegte, so taucht Ivna Žic als Prosamalerin auf und malt beeindruckend.

Eine junge Frau bewegt sich hin und her, von Zürich nach Zagreb, von Zagreb zurück, nach Paris. Aber nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich. Zurück in Bildern aus ihrer Kindheit, noch weiter in das familiäre Bewusstsein einer ganzen Sippe. An die Seite eines Mannes, den sie liebte, der sie liebt, aber eine Liebe, die von beiden Seiten nicht hielt, was sie versprach. An die Seite ihrer Grossmutter, der sie als Kind das Wasser in Kübeln vom Meer auf die Veranda brachte und die ihre Füsse darin badete, ohne je einmal wieder mit ans Meer zu kommen. An die Seite des Grossvaters, des rauchenden Deda, der einmal malte, sich in die Erinnerung der Erzählten malte, tief ins Bewusstsein und nie enträtselte, warum er zu malen aufhörte.
„Warum hast du aufgehört zu malen? Es gibt anderes, sagte er dann, irgendwann, immer wieder…“
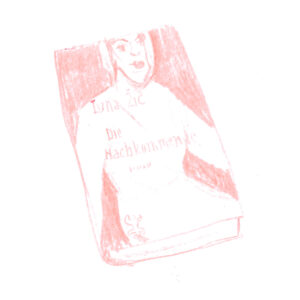 Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.
Ivna Žic erzählt vom Unterwegssein, der Unmöglichkeit, wahrhaftig an einem Ort zu sein oder an der sicheren Seite eines Menschen. Alles wandelt sich, nichts bleibt, wie es ist. Wer dort ist, soll da sein. Sie erzählt vom Verlust von Heimat, der Suche nach ihr, den Verpflichtungen und Rufen einer Sippe, dem Wunsch, ein eigenständiges Leben zu führen, ungebunden und doch irgendwo zuhause zu sein, der Sehnsucht all jener, die sich nach inneren Bildern sehnen, die von der Gegenwart vergessen sind. Die Sehnsucht, sich nahe zu kommen und die Ernüchterung darüber, dass zum andern und gar zu sich selbst unüberwindbare Distanz bleibt.
„… Geschichten der letzten Generationen, die an meinem Körper kleben, dranhängen, als wären sie vergessen, und doch pochen sie jeden Tag, wandern sie jeden Tag mit…“
Die Erzählerin sitzt und liegt nachts im Zug und die ganze Sippe setzt sich im Dunkel des ratternden Gefährts an die Seite der jungen Frau, flüstert, ruft und erzählt. Die Erzählerin sitzt im Bus, 12 Stunden zurück in die Schweiz nach Zürich, ganz nah all den andern, die Geschichten und Bilder mit sich herumschleppen. Von einem Ort zum andern, wie Generationen zuvor, als Kriege und Grenzen Reisen von Süden nach Norden zu Fluchten machten. Von einem Land, das in diesem Jahrhundert mehrfach von Kriegen, verschiedensten Regimen gebeutelt wurde, in ein Land der „eingeschlafenen Körper“.
Die Protagonistin reist hin und her, getrieben von ihr selbst, von unbeantworteten Fragen, verschwiegener Geschichte, dem Gefühl nirgendwo zuhause zu sein. Unvereinbare Welten, die sie auseinanderzureissen drohen. Auf der Grossmutterinsel die stete Frage, wann sie wiederkomme und in der Stadt, in der sie wohnt, die dauernde Frage, ob sie von hier sei.
Ivna Žic erzählt und webt ein Netz in die Landschaft, dessen Bänder sich mit jedem Erzählstrang mehr und mehr zu einem grossen, ganzen Bild zusammenfügen. Sie erzählt wie ein Maler malt, nicht von links oben nach rechts unten, sondern Pinselstrich für Pinselstrich auf der Leinwand der Zeit. Zugegeben, Ivna Žics Prosa entschlüsselt sich nicht von selbst. Sie verlangt von Lesenden einiges ab. Aber wer sich auf die Musik in der Sprache der jungen Schriftstellerin einlässt, die Intensität ihrer Sprache, der wird reichlich belohnt.

«Ein Interview»:
In Ivna Žics Roman „Die Nachkommende“ stellt die namenlose Protagonistin ein paar Fragen an den Schalterbeamten Herr Zlatko.
Fragen, die ich der Autorin stellte:
Warum sind Sie gerade hier und nicht anderswo?
Jetzt gerade bin ich hier, in Zürich, und nicht anderswo, weil ich das Stück GEBROCHENES LICHT am Theater probe. Das schöne am Medium Theater ist: Man muss da sein, hier sein und kann nicht anderswo, es geht nicht digital oder per Mail, es geht nur hier und jetzt.
Warten Sie auf etwas?
Momentan nicht wirklich, die Tage sind voll, wir sind mitten in Endproben und die Première rückt von Stunde zu Stunde näher.
Was oder wer fehlt Ihnen?
Etwas Ruhe zum Schreiben.
Haben Sie Zeit?
Ich nehme sie mir, jeden Tag aufs Neue.
Hassen Sie?
Nein.

Ivna Žic, 1986 in Zagreb geboren, aufgewachsen in Zürich, studierte Angewandte Theaterwissenschaft, Schauspielregie und Szenisches Schreiben in Gießen, Hamburg und Graz. Seit 2011 arbeitet sie als freie Autorin, Dozentin und Regisseurin u. a. am Berliner Maxim Gorki Theater, Schauspielhaus Wien, Luzerner Theater, Theater Neumarkt, Schauspiel Essen, Theater St. Gallen und bei uniT. Žic erhielt für ihre Texte eine Vielzahl von Stipendien und Preisen. Für ihren Debütroman »Die Nachkommende« wurde sie 2019 sowohl für den Österreichischen Buchpreis als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert. Sie lebt in Zürich und Wien.
Illustrationen © Lea Frei

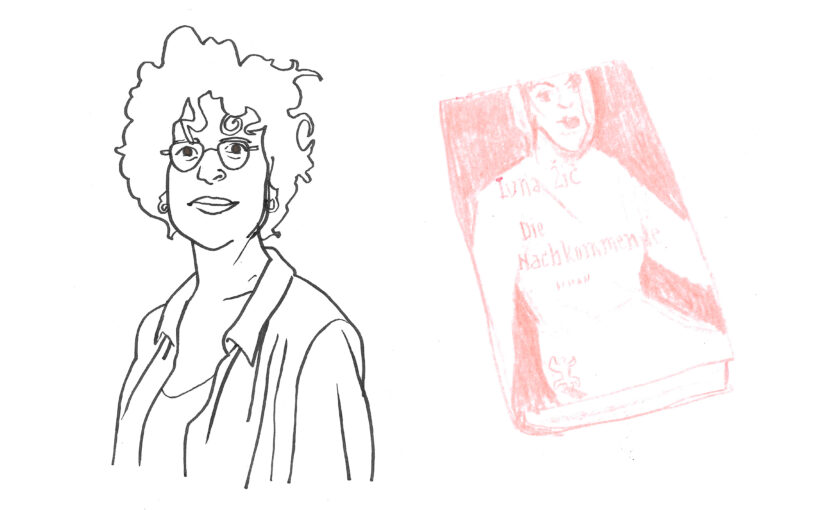

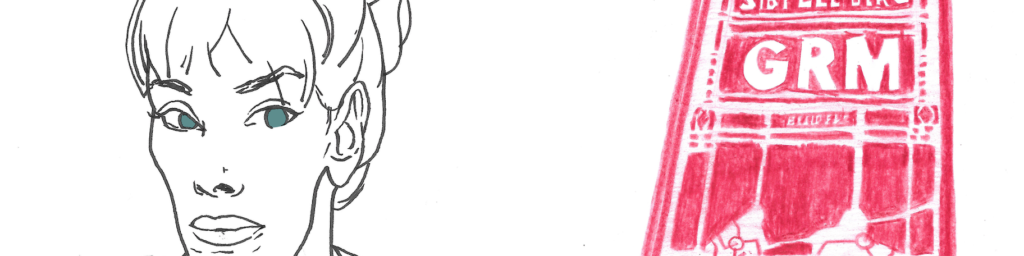
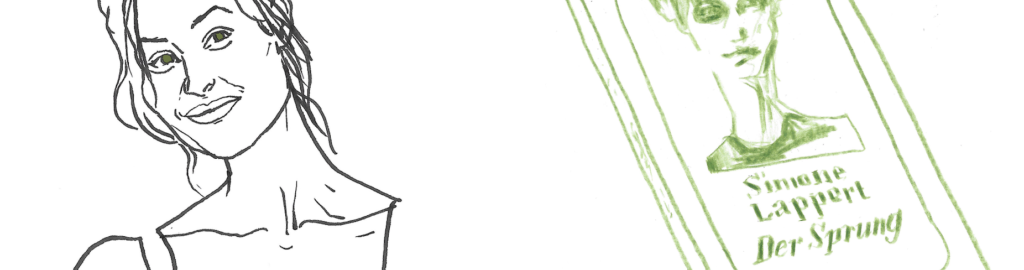

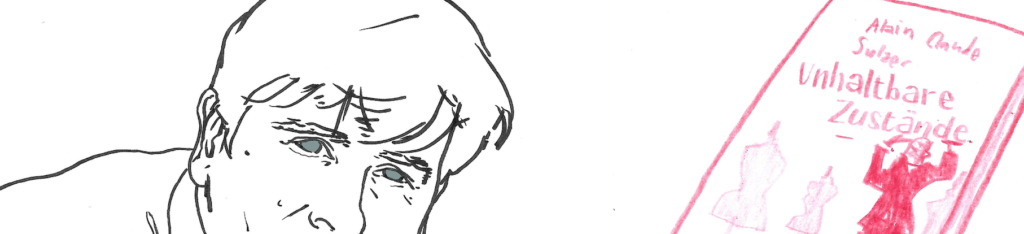

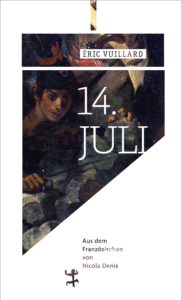 Während sich der Hof in Versailles, dieser Moloch aus gepuderten Günstlingen, Zubringern, Dienstboten, Glückssuchern, Profiteuren und Gaunern ganz dem Moment hingab und sich der Monarch in Gottes Gnaden suhlte, kochte und brodelte in der unkontrolliert gewachsenen Grossstadt Paris, damals wahrscheinlich eine der grössten Städte der Welt, das Volk. Versailles, heute strahlende Sehenswürdigkeit, mit seiner ebenso pompösen wie monströsen Infrastruktur war nicht nur riesiges Macht- und Kulturzentrum, sondern ein Abgrund, in dem sich Biographien verloren, Menschen verschwanden, die Dekadenz wilde Feste feierte und Reichtum und Armut Wand an Wand existierten.
Während sich der Hof in Versailles, dieser Moloch aus gepuderten Günstlingen, Zubringern, Dienstboten, Glückssuchern, Profiteuren und Gaunern ganz dem Moment hingab und sich der Monarch in Gottes Gnaden suhlte, kochte und brodelte in der unkontrolliert gewachsenen Grossstadt Paris, damals wahrscheinlich eine der grössten Städte der Welt, das Volk. Versailles, heute strahlende Sehenswürdigkeit, mit seiner ebenso pompösen wie monströsen Infrastruktur war nicht nur riesiges Macht- und Kulturzentrum, sondern ein Abgrund, in dem sich Biographien verloren, Menschen verschwanden, die Dekadenz wilde Feste feierte und Reichtum und Armut Wand an Wand existierten.
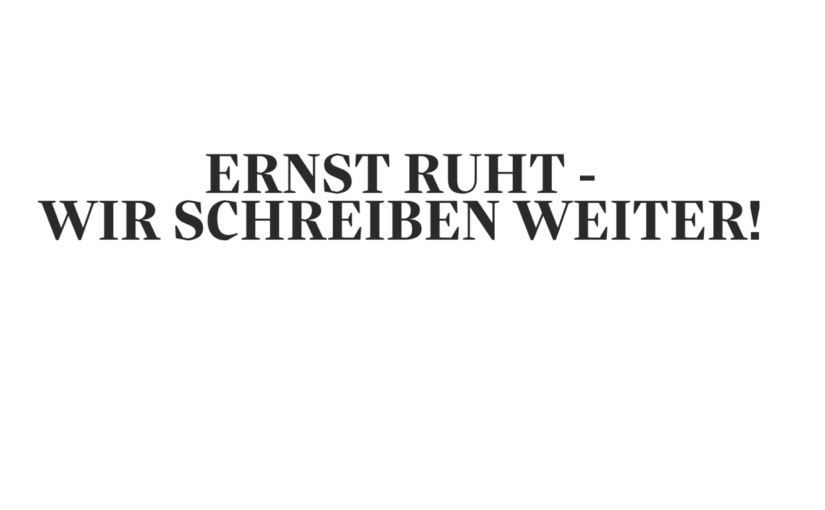
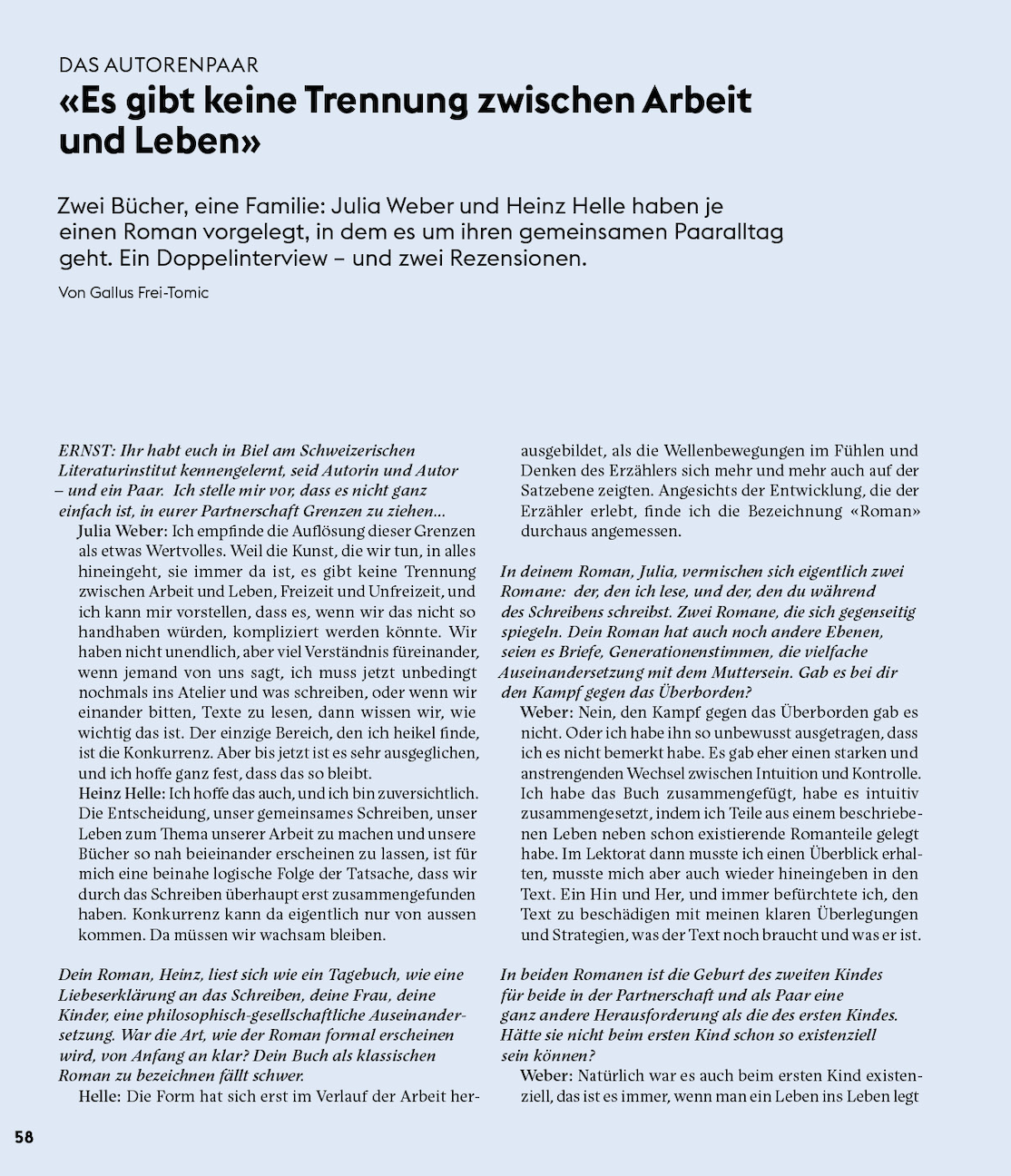


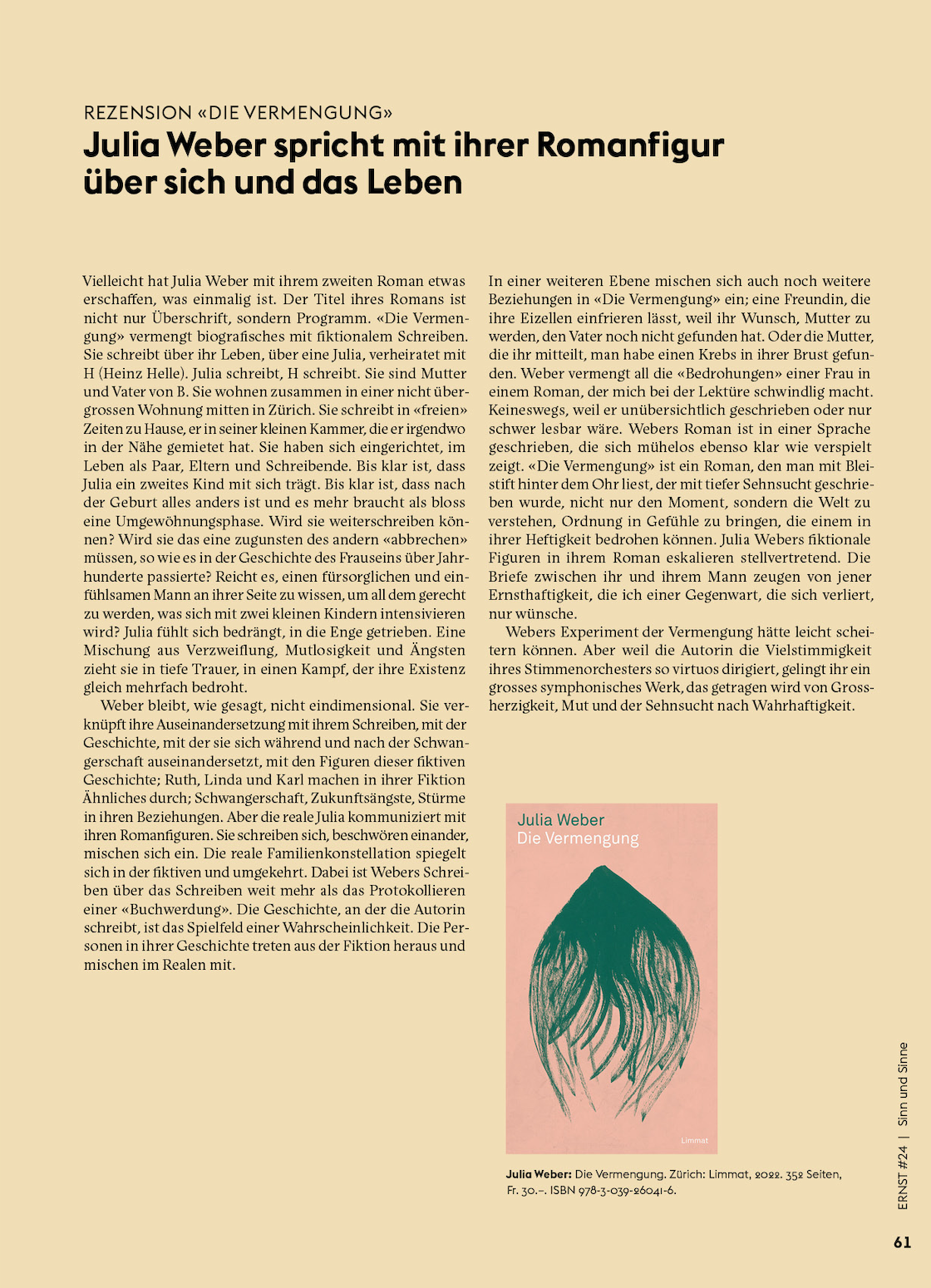
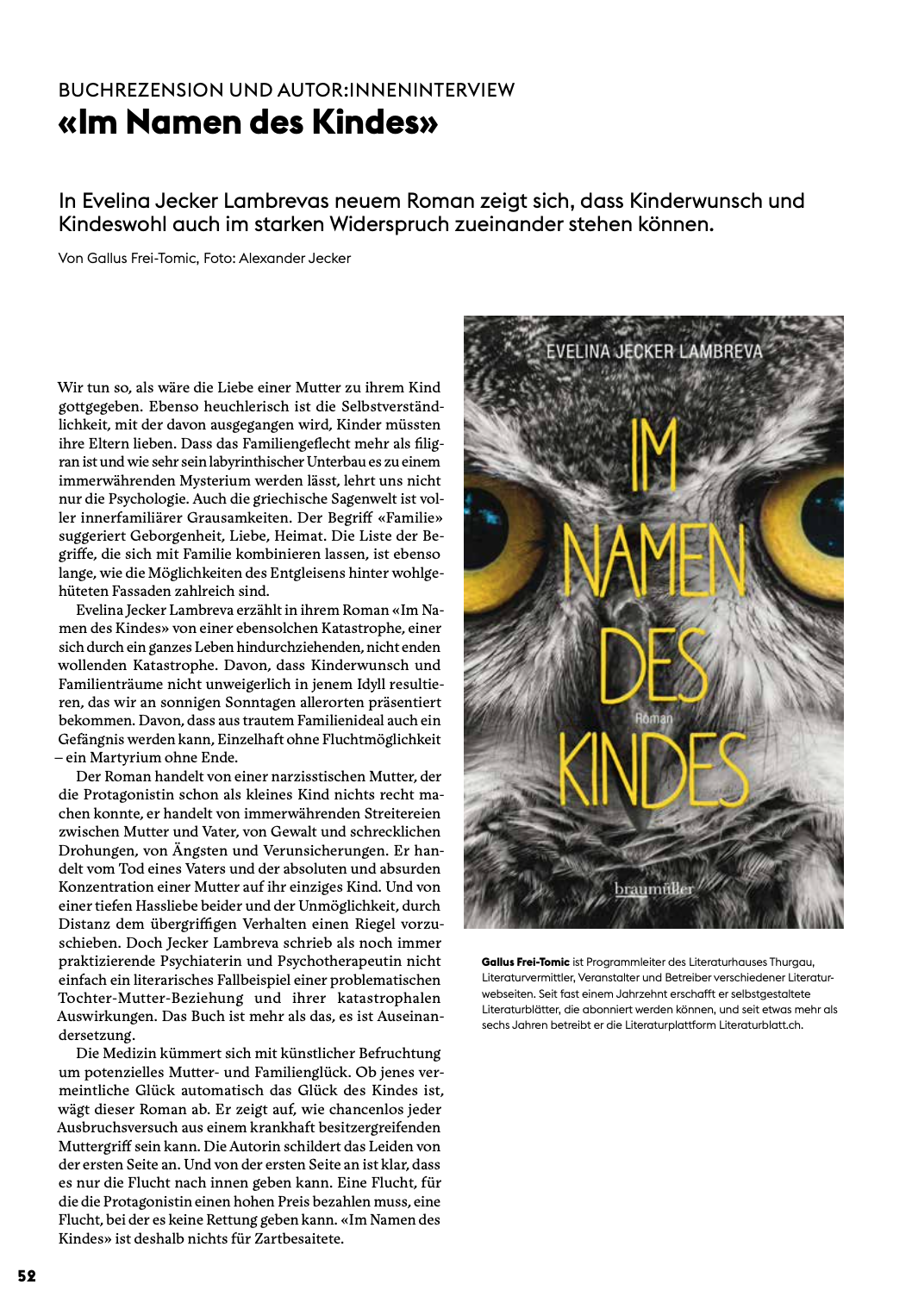


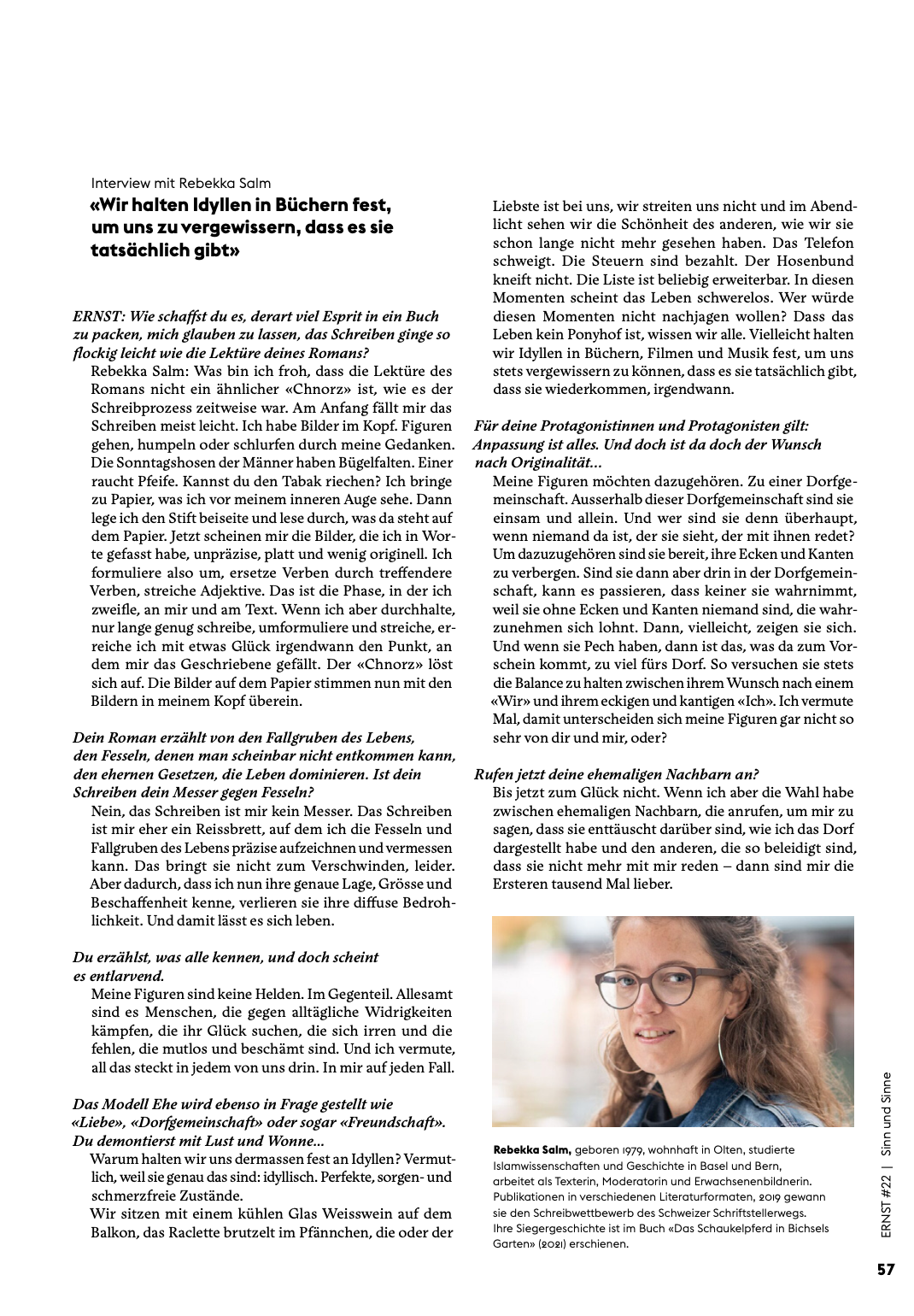



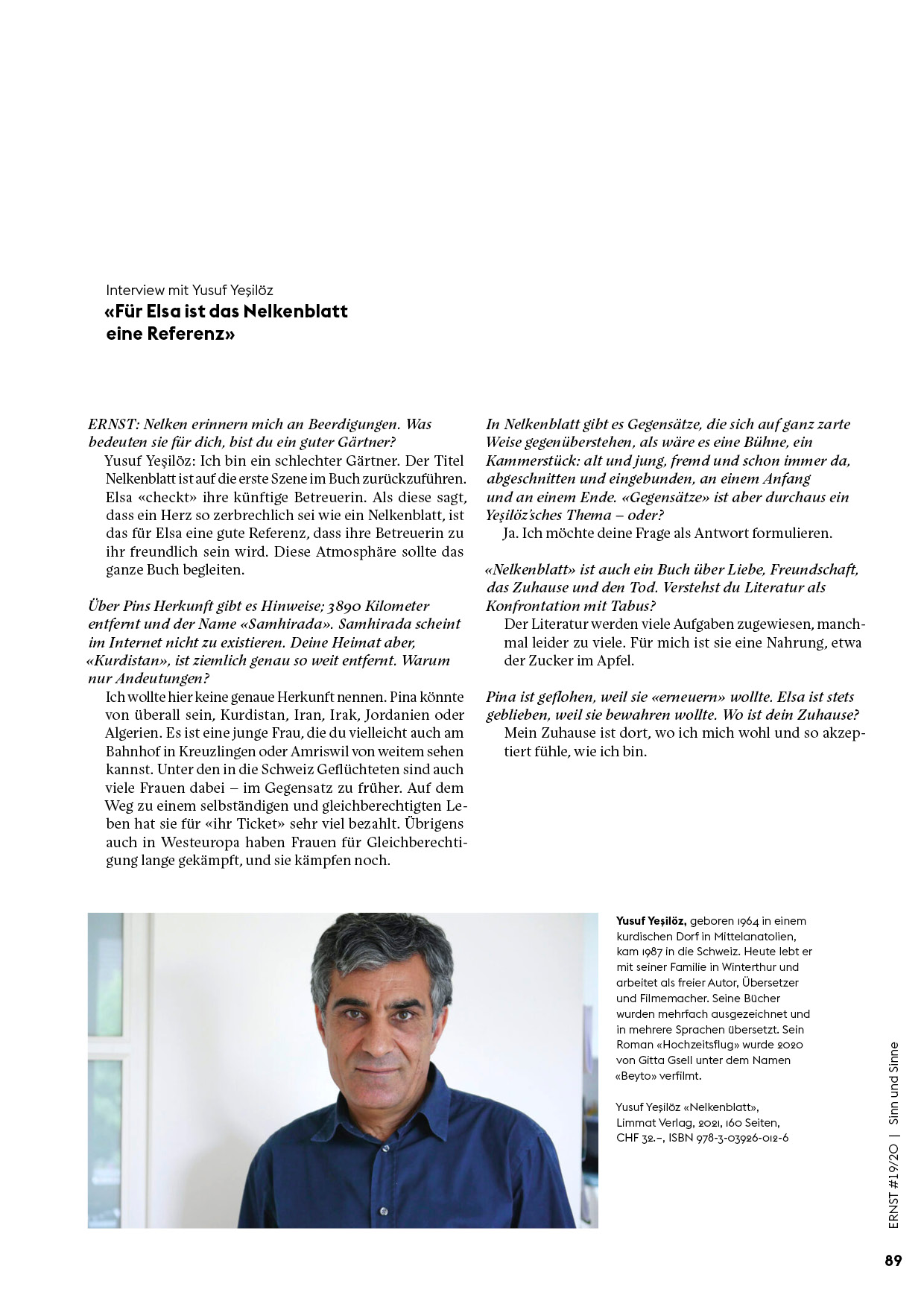















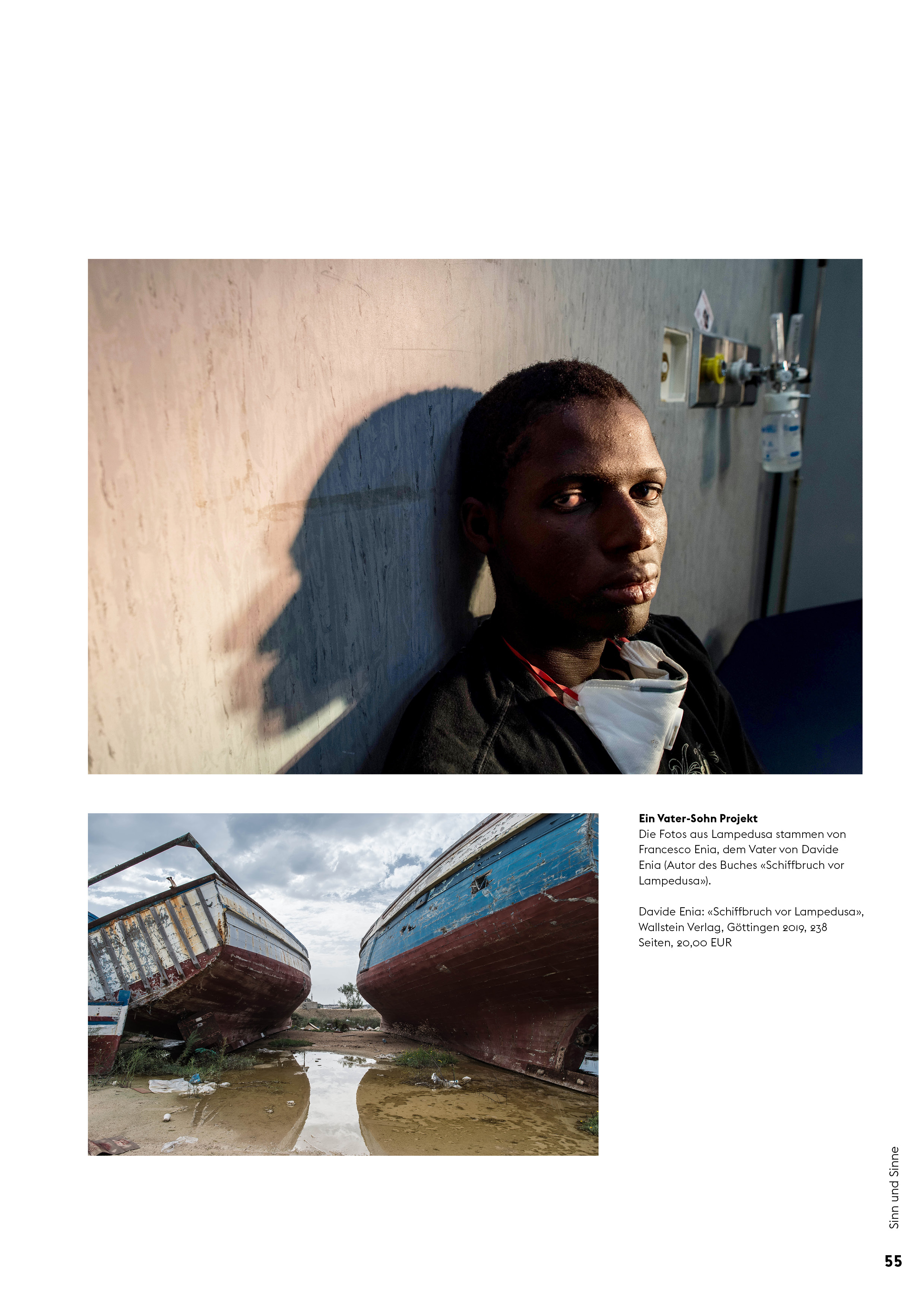

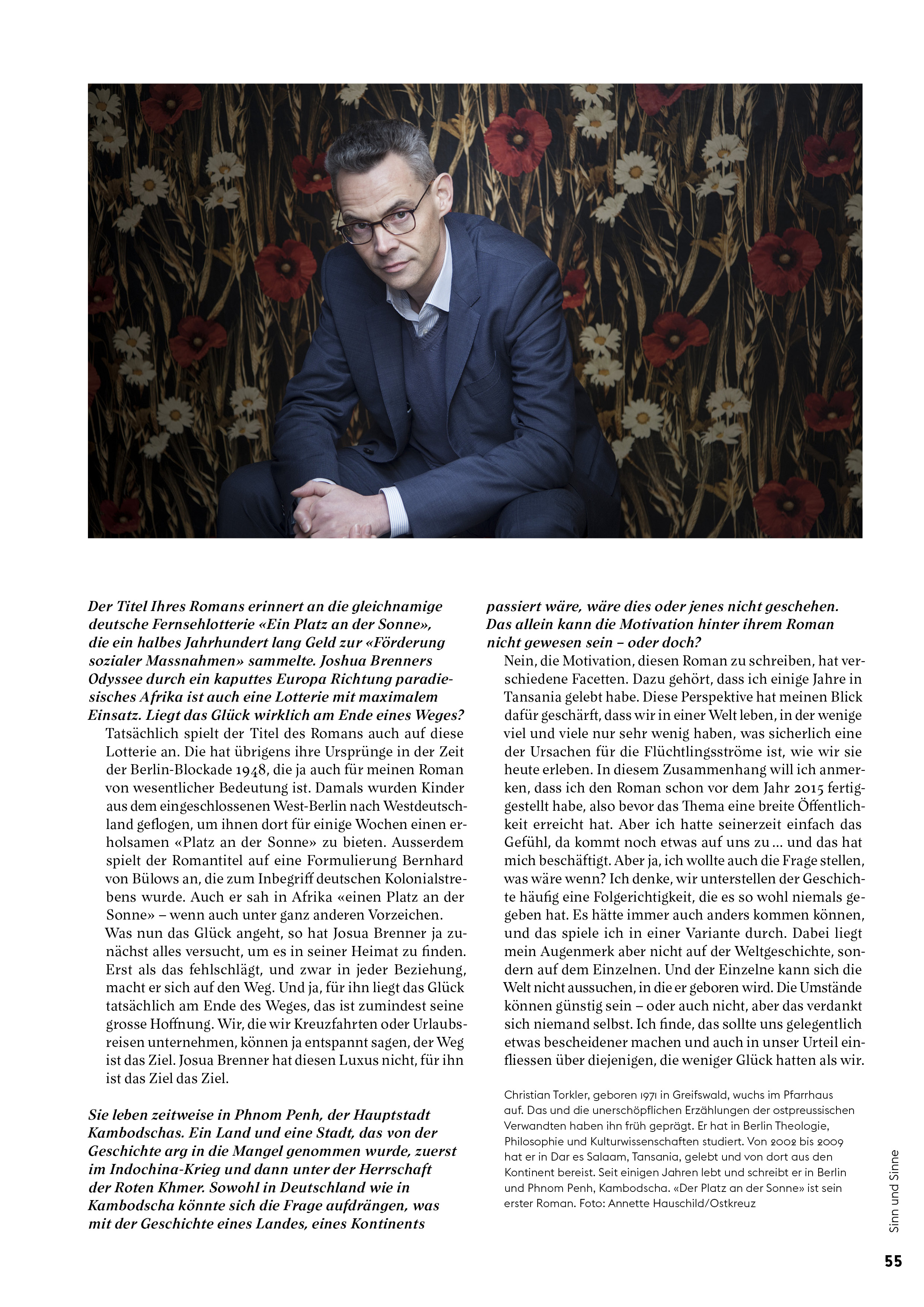


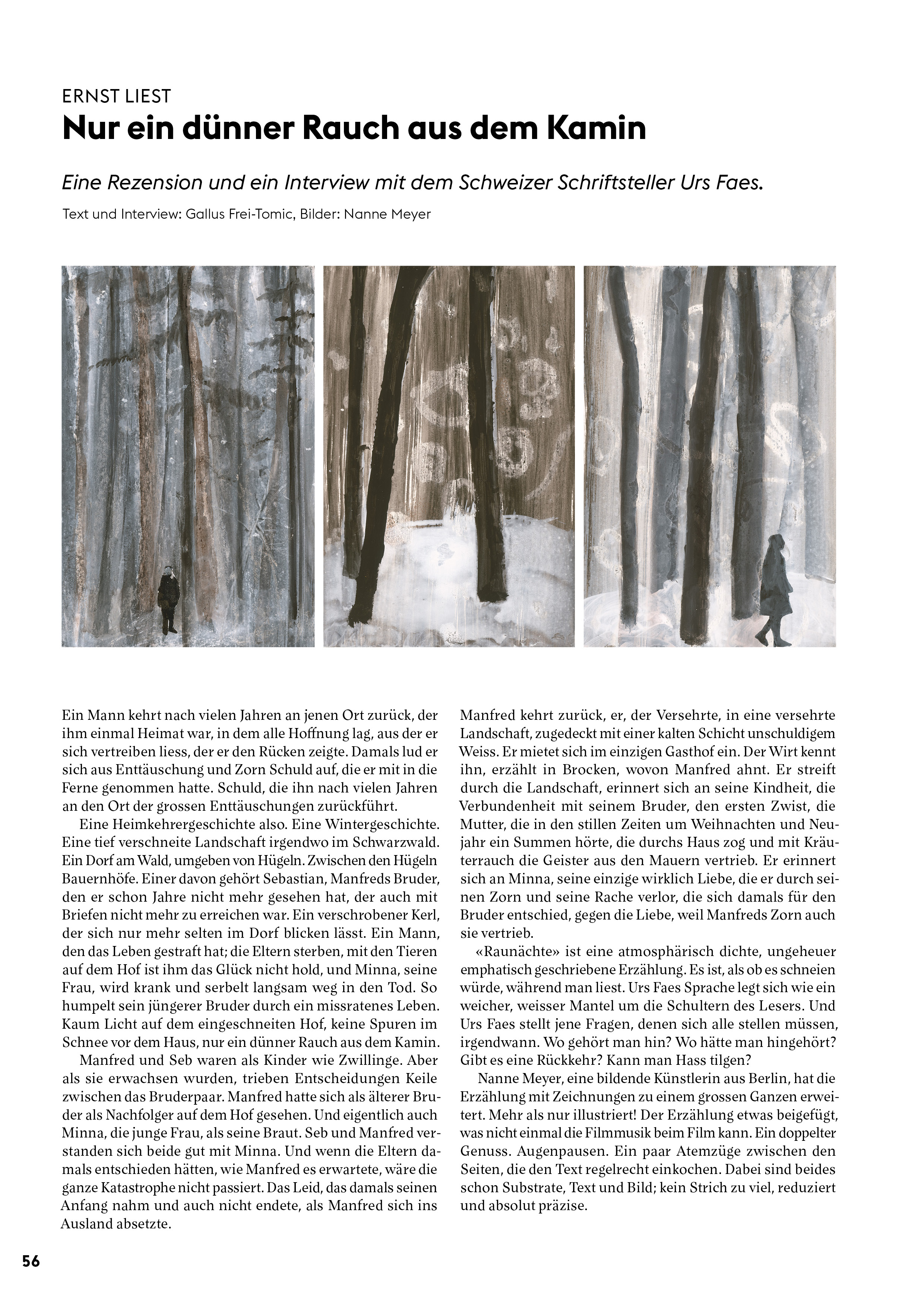
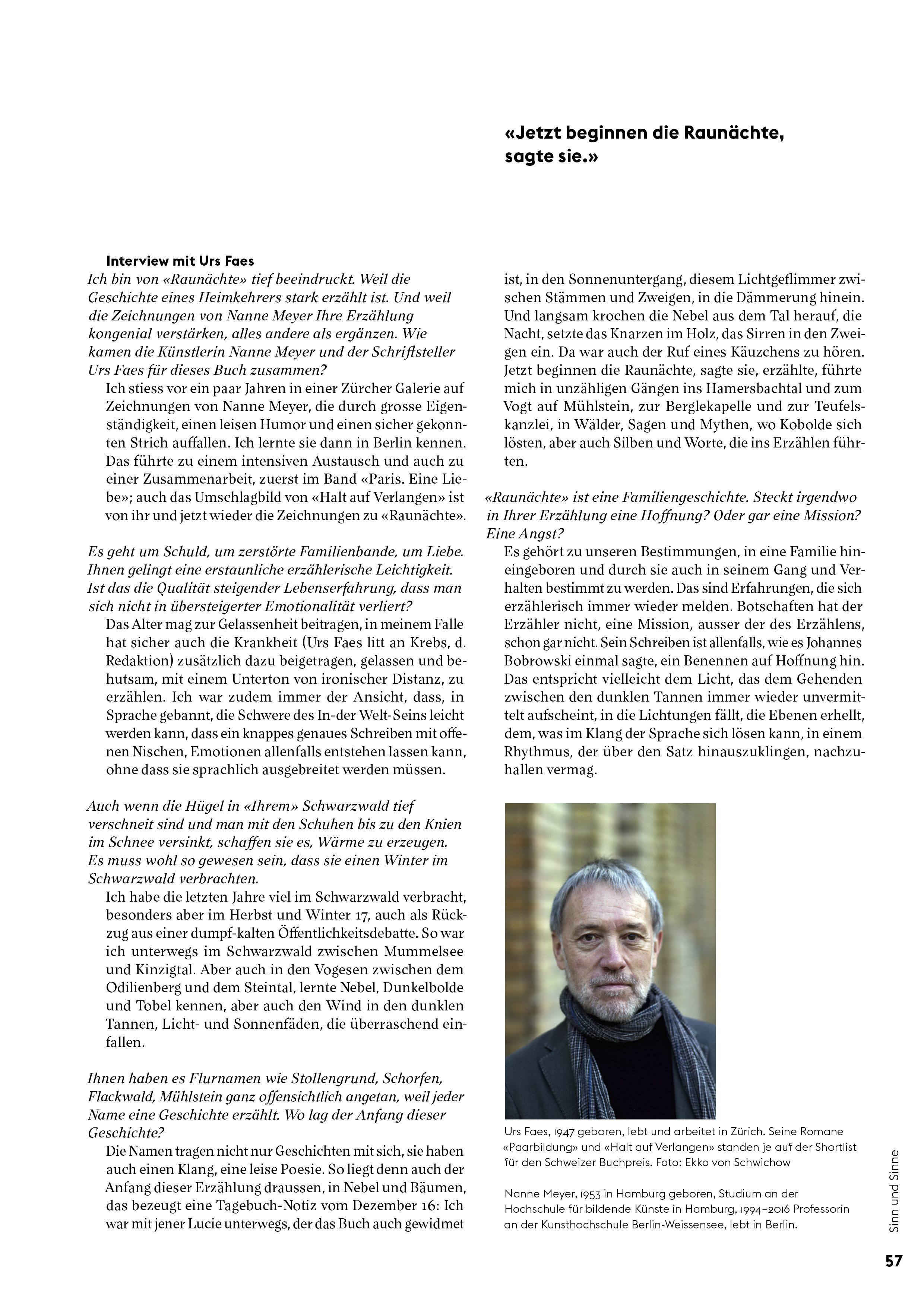
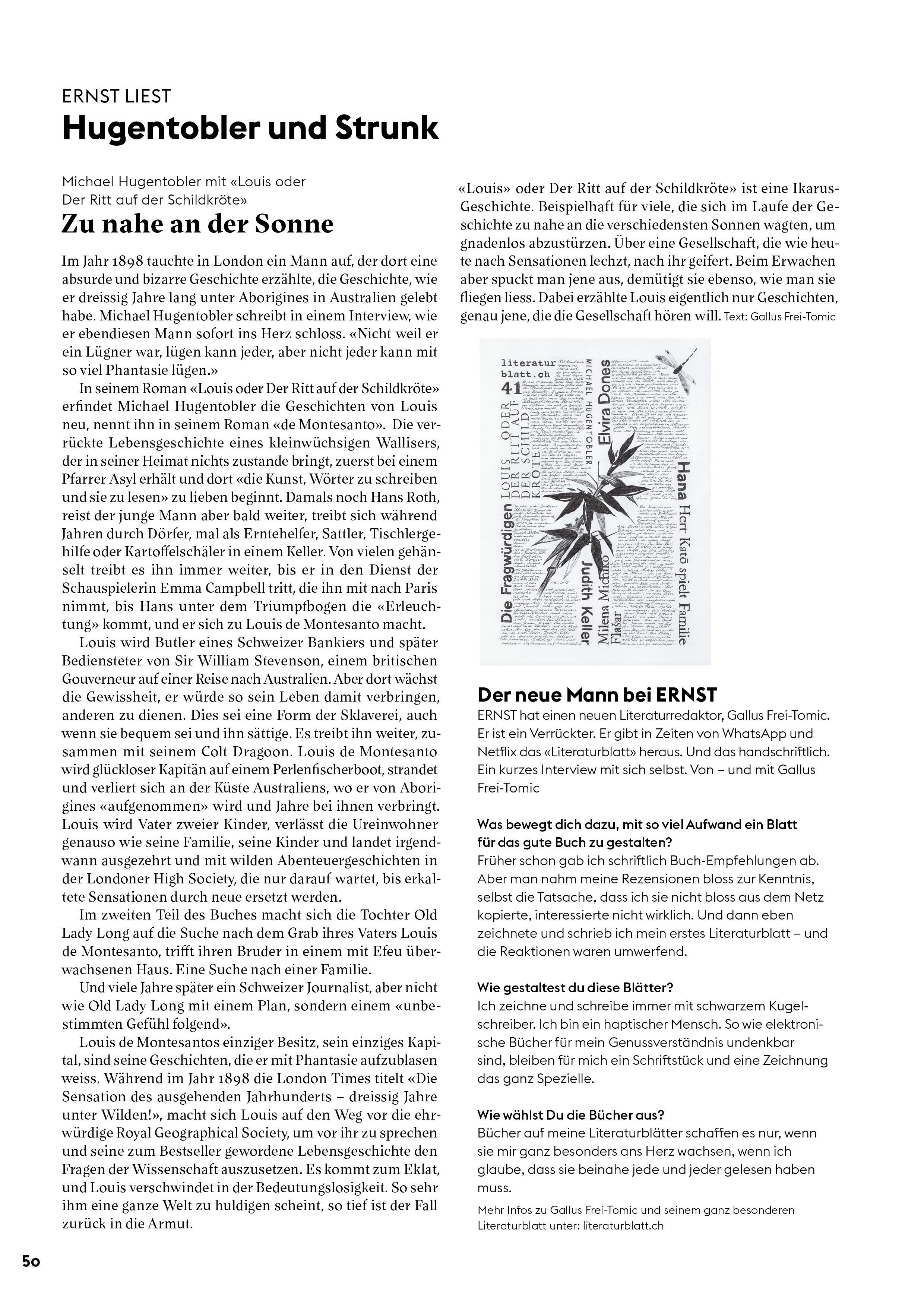

 sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?
sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?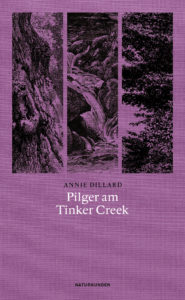 Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.
Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.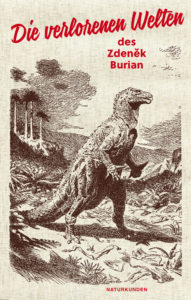 Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.
Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.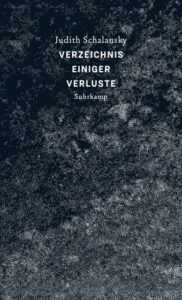 Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.
Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.