Lieber Gallus
Unser Lesezirkel hat aus meinen drei Vorschlägen Maja Haderlap («Nachtfrauen«), Nina Jäckle («Verschlungen«) und Peter Handke letzteren ausgewählt. Bisher hatte ich nur «Abschied des Träumers» und «Winterliche Reise» gelesen, um die Kontroverse um Serbien zu verstehen, was nur teilweise gelang. Ich freute mich auf eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Nobelpreisträger von 2019. Ein Rezensent hat geschrieben, die 200 Seiten von der «Ballade des letzten Gastes» seien an zwei Abenden gut zu lesen, Handke hätte in diesem Alterswerk zu einer einfacheren Sprache gefunden.
Ich aber kämpfte mehrere Abende erfolg- und ratlos um das Verstehen dieses knorrigen Buches mit seiner rätselhaften Sprache und kaum zu erfassendem Inhalt. Nach fünfzig Seiten dachte ich: Dieses Buch kann ich nicht fertiglesen. Irgendwie wollte ich nicht aufgeben und kaufte die Biografie von Malte Herwig «Meister der Dämmerung». Diese Biografie ist ein Meisterwerk, voller Selbstzeugnissen Handkes, beispielsweise dessen Briefen an seinen leiblichen Vater, sehr spannend zu lesen, mit vielen Hinweisen auf die Verarbeitung persönlicher Ereignisse in den Texten und reich bebildert. Ein sehr lesenswertes Werk! Angeregt durch diese eindrückliche Lebensgeschichte las ich «Wunschloses Unglück» und «Die Lehre der Sainte-Victoire», zwei sehr persönliche und berührende Bücher, in einer mir verständlichen, wunderbaren Sprache, die ich dank der Hinweise in dieser Biografie mit Genuss lesen konnte. Dass Peter Handke seinem leiblichen Vater erst mit 18 Jahren begegnet ist und seine Mutter 1971 Selbstmord gemacht hat, dass er bereits in der Schule ein kluger genau beobachtender Einzelgänger war, das alles erleichterte mir den Zugang zu diesem widersprüchlichen Autor. Es gelang mir, die «Ballade des letzten Gastes» ganz zu lesen, die kunstvolle Sprache und die verwirrenden Bilder auf mich wirken zu lassen, auch wenn viele Passagen für mich weiterhin fremd bleiben.

Für mich ist der letzte kurze Abschnitt dieser Ballade am besten gelungen, ein Gedicht voll eindrücklicher Bilder, sehr anregend und bereichernd:
«Als ich mich schnarchen hörte beim Schlaf im Bombentrichter. Aus heiterem Himmel angefallen von einem Schmetterling. Der Tag ohne Vogelflug.»
Malte Herwig schreibt: «Handkes Werke sind Bruchstücke einer grossen Konfession, und die Radikalität und Schonungslosigkeit, mit der er seine Selbsterforschung betreibt, ist einmalig. Hier schreibt einer über sich, aber stellvertretend für alle, die der Welt noch nicht so abhanden gekommen sind, dass sie sich nicht einmal mehr für sich selber interessieren.»
Mit diesen Worten hoffe ich, dass die Uraufführung von «Mein Tag im anderen Land» gestern Abend in Villach erfolgreich verlief. Dein Beitrag im Literaturblatt hat mir übrigens auch sehr geholfen, Peter Handke besser zu verstehen.
Nun wünsche ich euch noch angenehme Tage in der Heimat dieses aussergewöhnlichen Schriftstellers und sende herzliche Grüsse aus der Innerschweiz
Bär

Lieber Bär
In Griffen, einem kleinen Ort im Drautal in Südkärnten, kann man seit ein paar Jahren im ehemaligen Stift ein Handke-Museum besichtigen. Als ich das Museum zum ersten Mal besuchte, dachte ich, es wäre ein Wallfahrtsort für Handke-Begeisterte geworden, ein Blick ins Leben des Nobelpreisträgers mit allen Höhen und Tiefen, einem Shop mit Büchern von und über den Dichter, einer anwesenden Museumsleitung. Das über 500 Jahre alte Kloster, das vor 200 Jahren aufgelöst wurde, die Gebäude privater Nutzung zugeführt und die Kirchen zu Pfarren, sind mehr als bloss in die Jahre gekommen. Es war kein Mensch anzutreffen. Und als ich neugierig und etwas verunsichert durch die feuchten Räume des Stifts streifte auf der Suche nach dem Handke-Museum, sah ich bloss auf dem angrenzenden Friedhof zwei Frauen, die sich um die Blumen auf den Gräbern bemühten.
Man scheint in Griffen, in Kärnten, in Österreich durchaus stolz auf den Nobelpreisträger zu sein, bekam er doch dieses Jahr das «Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich». Die Ausstellung im Stift ist ein aufschlussreicher Blick in ein Leben, das schon in frühen Jahren eine deutliche Richtung bekam, in ein Schreiben, das sich wenig um Konventionen und Strömungen kümmerte, ein Wirken, das stets eigenwillig und eigensinnig ist und war. Eigenschaften, die in der Gegenwart immer schwieriger werden, in der «fremde» Ein- und Ansichten schnell zu vernichtenden Urteilen führen, in einer hyperempfindlichen Gesellschaft, die sich immer schwerer tut, andere Meinungen zu akzeptieren.
Das Handke-Museum in Griffen ist ein seltsamer Ort. Als wäre es Pflicht geworden. Als hätte man ihm das Leben entzogen. Als würde man sich ein bisschen schämen.

Umso beeindruckender war die Uraufführung des Stückes „Mein Tag im anderen Land“ an der «Neuen Bühne Villach«. Michael Weger, Schauspieler, Regisseur und verantwortlich für die Bühnenbearbeitung der «Dämonengeschichte» von Peter Handke, die 2021 bei Suhrkamp erschien, performte sich mitten in den Text, ganz nah ans Publikum, unmittelbar.
Ein Mann wandelt durch einen Tag. Manchmal in einer realen Welt, manchmal im Dazwischen, zwischen Traum, Wahn, Fata Morgana und Realität. Von sich selbst und seiner Schwester begleitet, manchmal ganz nah, manchmal weit abdriftend. Er geht durch einen Ort, einen Ort, ebenso unbekannt wie vertraut. Geht wie von Sinnen und doch mit scharfem Gespür für das, was sich neben der Realität offenbart. Er redet mit lauten Zungen, schwadroniert, schreit und gebärdet sich wie ein Entfesselter, verbreitet Schrecken und Verunsicherung, um dann mit einem Mal wieder der ganz Sanftmütige und Ruhige zu werden. Vielleicht erkennt man dort den Autor selbst, wenn man sich erinnert an seine selbstvergessenen literarischen Erkundungen, seine ruhigen Worte in der lichtdurchfluteten Schreibstube seines Hauses, in den Betrachtungen in seinem verwachsenen Garten. Aber ebenso in der verbalen Entgleisung, wenn man Handke zu reduzieren versucht, wenn man ihm auf die Pelle rückt.
So seltsam die Erzählung, so seltsam die Sprache. Peter Handke bedient sich einer Sprache, die wie die Geschichte selbst leicht daneben klingt, ebenso wie die Geschichte entrückt, nicht der Welt hier und der Zeit jetzt entsprechend. Eine Sprache, die beinah singt, die Haken schlägt und Kringel zeichnet, die anders ist als das, was der Realität entspricht, die mich wegzieht, meinen Blick verbaut.
Handke ist Handke.



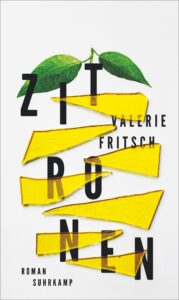



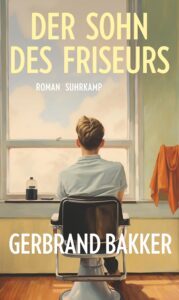













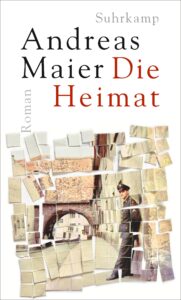



 Die Solothurner Literaturtage sind das Flaggschiff im nationalen Literaturbetrieb. Als solches von beachtlicher Grösse und mit viel Masse und Wasserverdrängung. Kein Wunder, wenn der eine Kapitän von Bord geht, dass es zuweilen vernünftig ist, diesen schweren Kahn unter eine furchtlose Doppelleitung zu stellen. Nathalie Widmer und Rico Engesser, beide noch lange nicht so alt wie das Festival selbst, müssen bestehen im Spagat zwischen den Erwartungen jener, die Tradition und Beständigkeit hochhalten und anderen, die dem in die Jahre gekommenen Schiff am liebsten mehr als nur neue Segel setzen wollen.
Die Solothurner Literaturtage sind das Flaggschiff im nationalen Literaturbetrieb. Als solches von beachtlicher Grösse und mit viel Masse und Wasserverdrängung. Kein Wunder, wenn der eine Kapitän von Bord geht, dass es zuweilen vernünftig ist, diesen schweren Kahn unter eine furchtlose Doppelleitung zu stellen. Nathalie Widmer und Rico Engesser, beide noch lange nicht so alt wie das Festival selbst, müssen bestehen im Spagat zwischen den Erwartungen jener, die Tradition und Beständigkeit hochhalten und anderen, die dem in die Jahre gekommenen Schiff am liebsten mehr als nur neue Segel setzen wollen. 
