Es gibt Bücher, die überrollen, verstören und faszinieren mich. «Zitronen» von Valerie Fritsch ist ein solches, ein weiterer Streich einer überragenden Schriftstellerin, eine Literaturperle. Und trotzdem würde ich dieses Buch nicht allen empfehlen, denn es ist schrecklich schön, leuchtet tief in die Abgründe menschlichen Seins!
Während des Lesens stellte sich eine seltsame Mischung aus Erschütterung, Faszination und Freude ein. Wie schafft es Valerie Fritsch ein Buch in einer derart hohen Sprach- und Bildintensität durchzuziehen, vielfach überraschend, beweisend, dass Literatur viel mehr sein kann, als eine gute Geschichte zu erzählen. „Zitronen“ schmeichelt mit Sprache. „Zitrone“ erschüttert mit Einsichten. „Zitronen“ bannt bis zum letzten Satz. „Zitronen“ ist ein Sprachkunstwerk. Der Saft dieser Zitronen brennt sich ein!
Eine Kleinfamilie in der Provinz, in einem windschiefen, vollgestopften Haus am Rande eines Dorfes. Ein Vater, der die Mutter und seinen Sohn schlägt. Mutter und Sohn, die in dauernder Angst leben und sich in einem Band aus Nähe und Zartheit miteinander gegen den übermächtigen Vater verbünden. Sie braucht ihren Sohn, ihr Sohn braucht sie. Der Sohn ist das einzige, was in ihrem Leben Resonanz gibt. Und für den Sohn ist die Mutter die einzige, die ihm Trost für all die vom Vater zugefügten Verletzungen bietet. Die Eltern waren ein Kippbild aus Schutz und Bedrohung, ein janusköpfiges Wesen, das einem erst mit kaltem, dann mit mitleidigem Gesicht ansah. Bis mit einem Mal der Vater, der Mann verschwindet und sich alles verschiebt.
«In jedem Leben gehen Bestimmung und Selbstbestimmung, Glück, Unglück und Zufall mit stiller Wirkmächtigkeit gegeneinander an, zerren an der Linie, die zwischen Geburt und Tod gespannt ist, und wehen die auf ihr Balancierenden wieder und wieder vom Weg.»
Ein Verschwinden, dass auch die Beziehung der Mutter zu ihrem Sohn radikal verändert. Was der Sohn als Rettung für die Mutter in einem Leben aus Angst und Bangen war, öffnet sich zwar, kehrt sich aber um in eine Angst, diesen Sohn an ein eigenständiges, unabhängiges Leben zu verlieren. Nach einer Krankheit, die die Mutter dem noch jungen August noch einmal ganz in seine Nähe brachte, beginnt die Mutter heimlich Medikamente in die Nahrung ihres Sohnes August zu mischen. Sie deckt August mit ihrer Fürsorge zu, so sehr, dass August nicht einmal mehr zur Schule gehen kann und über Wochen und Monate ans Bett gefesselt bleibt, beständig umgarnt von seiner Mutter, die ganz in ihrer Rolle als Schützende und Wissende aufgeht. Die Medikamente, die sie missbraucht, bezieht sie von ihrem Hausarzt.
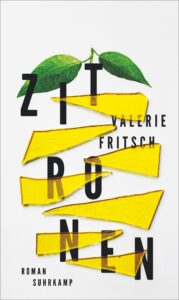
Auch nach einem gemeinsamen Urlaub am Meer, im Land der Zitronen, zusammen mit eben jenem Arzt, der zwar konstatiert, dass es dem Jungen mit jedem Tag am Meer besser geht, ändert sich das Leben von August nur marginal. Seine Mutter bringt ihn züruck ins Bett, zurück an ihren Tropf. Bis ein Blitz einschlägt. Bis auch für den Arzt nicht mehr zu leugnen ist, dass Augusts Krankheit bloss das Resultat eines fatalen Medikamentenmix ist. August kommt nach Wien, wird förmlich ausgesiedelt, in eine kleine Wohnung, die ihm der Arzt, der sich seiner Schuld bewusst ist, in der fernen Stadt zur Verfügung stellt.
So sehr ins Mutternest zurückgebunden, so einsam und allein sind die ersten Wochen für August in der fremden Stadt. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs mehr schlecht als recht durch und baut aus den Versatzstücken fremder Biographien und Lügengeschichten eine eigene Vergangenheit zusammen, mit der er sich sein Dasein formt, ein Leben zwischen Huren und Ganoven. Bis er Ava trifft, eine Künstlerin, eine Verwundete wie er. Bis er in Ava seine grosse Liebe findet und alles dafür tut, diese eine Liebe nicht wieder zu verlieren. Aber August in seiner Angst, auch diese Liebe zu verlieren, schnürt Ava immer mehr die Luft zum Atmen weg. Bis das Unvermeidbare zur Tatsache wird und sich auch diese Liebe von ihm trennt. Bis August spürt, dass er dorthin zurück muss, wo ihn die Fesseln noch immer binden.
«Es gab nichts, was es nicht gab, aber es gab vieles, was es nicht hätte geben dürfen.»
Aber um den Zauber dieses Romans zu ergründen, sollte man sich viel mehr der Sprache zuwenden. Was Valerie Fritsch mit „Zitronen“ schafft, gelingt nur ganz wenigen. Meist ist die Sprache der Träger einer Geschichte. Aber bei Valerie Fritsch ist die Geschichte der Träger eines Sprachteppichs aus Farben, Gerüchen, Geräuschen und Melodien, die seinesgleichen suchen. Zum einen spürt sie sich in die Seelenlandschaft eines Gefesselten, zum andern bebildert sie die Welt dieses Gebeutelten, eines jungen Mannes, der mit Strategie krank gemacht wird. Ihr Schreiben ist im wahrsten Sinne des Wortes schaurig schön. Valerie Fritsch schreibt in Sätzen, die mich wie Winde umschmeicheln, die den Schrecken in helle Farben verwandeln, die einen Alp sublimieren.
Ich verneige mich tief vor der Kunst dieser Autorin! Lange her, dass mich Lesen so sehr berührte!
Interview
Natürlich geht es um einen krankhaften Zustand, den die Medizin „Münchhausen-Stellvertretersyndrom» nennt, eine ganz fiese Form der Kindsmisshandlung. Mütter, die in ihrem Umfeld als perfekt, maximal fürsorglich gelten und sich hingebungsvoll um angebliche Krankheiten ihrer Kinder kümmern. Krankheiten, die sie selbst herbeiführen. Aber du legst den Fokus auf das Kind, auf August, zeigst, dass dieses zurückgebundene Leben für immer gezeichnet ist. Und trotzdem wolltest Du viel mehr als die Nacherzählung eines Befreiungsversuchs. Du bist eine Reisende. Doch eigentlich erstaunlich, dass dein neuer Roman eine ganz besondere Reise ist.
Und auch sie begann mit Distanz, denn angefangen hat es damit, dass mir viele allgegenwärtige Phänomene fremd und fern waren und ich ihnen näher kommen wollte, um sie zu verstehen. Drei Jahre lang bin ich durch eine Welt hinter der Welt gereist, jene oft unsichtbare der Gewalt, habe intime Gespräche mit Opfern und Tätern geführt, mit Mördern Kaffee getrunken und durfte durch Schlüssellöcher in viele nicht lineare Leben schauen. Herausgekommen ist ein seltsames Buch über Gewalt und Zärtlichkeit, vor dem ich meine Lektorin am Ende nur gewarnt habe: es ist wild geworden.

Text & Foto © Valerie Fritsch
So sehr die Familie über Jahrhunderte idealisiert und von Politik und Religion immer wieder kräftig instrumentalisiert wurde, so sehr „Familie“ zu einem Traum, einem Ziel, einem Paradies werden kann, so sehr kann „Familie“ Hölle werden. Eine Hölle, die von den betroffenen Kindern mit stoisch scheinender Selbstverständlichkeit ertragen wird. August ist ein ewig Verwundeter. Warum begeben sich Menschen in einen Tunnel, bei dem es keine Umkehr gibt?
Selbstverständlichkeit ist eine hinterhältige Kategorie, sie ist das, was man kennt. Geschlossene Machtsysteme können überall entstehen, Türen zugesperrt, Vorhänge zugezogen werden. Wenn dann noch genug Menschen rundum die Augen verschließen, schaffen es auch die eigenartigsten und schrecklichsten Zustände als Normalität zu gelten, sogar für die Betroffenen. Man trägt schwer an den früheren Verwundungen, sie zerstören mitunter den Vertrauensindex zur Welt. Und es kann in existentiellen Krisensituationen zu einer Logik des Misslingens, einer Folgerichtigkeit der schlechten Entscheidung, sogar dem Glück der bösen Tat kommen: es fühlt sich das objektiv Falsche dann subjektiv richtiger an alles anderes.
In seiner Zeit in der Stadt, nach seiner ersten grossen Befreiung, muss sich August in seiner Selbstständigkeit zuerst zurechtfinden. Auch mit einem Leben, das sich nach Geschichte sehnt, nach erzählbarer Geschichte. Literatur ist Geschichte. Zusammengetragenes, Versatzstücke, Er- und Gefundenes. August erzählt „Lügengeschichten“, bastelt sich seine Vergangenheit immer und immer wieder neu zusammen. Eine befreundete Schriftstellerin meinte einmal, die Schriftstellerei sei der einzige Betrug, in dem man schadlos lügen kann. Wir hadern mit Wahrheiten, wissen, dass nichts so vieldeutig ist wie die Wahrheit. Tun wir der Lüge unrecht?
Ich denke, die Lüge hat mitunter ihre Berechtigung, außerdem ist sie angenehm eindeutig, manchmal sogar schonend und zartfühlend gemeint. Ganz ohne sie kommt der Mensch nicht aus. Wer würde es schon ertragen, auf einem Familienfest pausenlos mit allen ernstgemeinten Wahrheiten und angestauten Werturteilen beworfen zu werden zwischen Schweinsbraten und Dosenpfirsichkompott? Wer allgemein genug Wahrhaftiges in seinem Leben hat, muss es mit der Wirklichkeit nicht immer so genau nehmen.

Und er erzählte, wie er früher mit den anderen Kindern in den leeren Grabkammern der steinernen Kästen gesessen war, wie sie in den obersten gekrümmt gehockt waren unter der niedrigen Decke wie in Nestern, in den Ecken Vorräte von Süßigkeiten anlegten und Amarettini und Zuckerschlangen aßen zwischen den Toten. Wie sie einander Gespenstergeschichten zuflüsterten.«
Text & Foto © Valerie Fritsch
Du nennst das Dorf, in dem August aufwächst, das „Dorf, das sich mit Enttäuschungen auskannte“. Auch das Wort „Ent-Täuschung“ birgt doch eigentlich etwas Positives. Wird man nicht von Täuschungen befreit?
Enttäuschung ist eine Funktion der Erwartung, sagen die Philosophen. Zu sehen, dass etwas anders ist, als man gedacht und gehofft hat, ist möglicher Weise befreiend, wenn man resilient ist, aber doch in den meisten Fällen zuerst einfach sehr unschön.
Zwischen August und Ava wächst eine grosse Liebe. Aber auch diese Liebe zerbricht, weil August die Grenze nicht spürt zwischen Zuwendung und Umklammerung, zwischen Hingabe und Besessenheit. Doch eigentlich ganz ähnlich wie die Liebe seiner Mutter damals. Leben ist ein permanenter Befreiungsversuch. So sehr wir uns nach Liebe sehnen, nach einem Spiegel, der uns vor der Einsamkeit bewahrt, so sehr verlieren wir uns in Abhängigkeiten, der Befreiung entgegengesetzt. Hatte August je eine Chance?
August nimmt das Wünschen nach seiner tragischen Kindheit zum Ausgleich besonders ernst: er wünscht sich unbescheiden und glühend die große Liebe, das große Geld, das große Glück, er will leben bis zum Umfallen.
Diese Kindheit ist nichts vom Rest des Lebens Abgekoppeltes, es ist die Zeit, in der wir Schritt für Schritt zu dem Erwachsenen heranwachsen, der dann entscheidet, wer man sein will und kann. Für eine eigene Identität bedarf es immer einer Kraftanstrengung, und für eine Flucht aus alten Mustern und Systemen einer umso größeren. Unmöglich ist aber nichts, das ist das Schöne am Menschsein. Und das Schreckliche.
Am meisten fasziniert mich an deinem Roman die Sprache, die Machart, der Ton, was dein Buch in mir evoziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Buch wie das Deinige, so einfach in losen Stücken zusammensetzen kann. Wie gelingt es Dir, dass ich glaube, du hättest Dein Buch in einem Zug, wie im Sprachrausch geschrieben?
Tatsächlich kommt es mir an guten Tagen vor, als würde ich am Schreibtisch zwischen Teetassen und Bücherstapeln mit den Buchstaben komponieren auf der Tastatur. Es hat etwas geheimnisvoll Melodiöses. Ich höre die Sätze. Es ist manchmal wie ein Flow in Zeitlupe: das mag ich sehr.
Valerie Fritsch, geboren 1989, arbeitet als freie Autorin und bereist die Welt. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2015 wurde sie mit dem Kelag-Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Brüder-Grimm-Preis für Literatur. Sie lebt in Graz und Wien.
«Herzklappen von Johnson & Johnson», Rezension
Beitragsbild © oxyblau/Suhrkamp Verlag







 Du hattest nie die Intention, eine Biographie zu schreiben. Und trotzdem hat die Buchtaufe unweit des Geburtsorts der Protagonistin bewiesen, wie sehr Du den Nerv dieser Existenz, dieser Zeit getroffen hast. Du hast ein Stück Stellvertretergeschichte geschrieben. Du hast genau soviel Fiktion miteingeschrieben, in das sonst nur undeutliche Bild einer starken Frau hineingestickt, dass sämtliche BesucherInnen dieser Veranstaltung das Gefühl hatten, Du hättest ein Denkmal gesetzt. Auch ein Denkmal für all die Frauen, die in der Fremde vergessen gingen.
Du hattest nie die Intention, eine Biographie zu schreiben. Und trotzdem hat die Buchtaufe unweit des Geburtsorts der Protagonistin bewiesen, wie sehr Du den Nerv dieser Existenz, dieser Zeit getroffen hast. Du hast ein Stück Stellvertretergeschichte geschrieben. Du hast genau soviel Fiktion miteingeschrieben, in das sonst nur undeutliche Bild einer starken Frau hineingestickt, dass sämtliche BesucherInnen dieser Veranstaltung das Gefühl hatten, Du hättest ein Denkmal gesetzt. Auch ein Denkmal für all die Frauen, die in der Fremde vergessen gingen.


















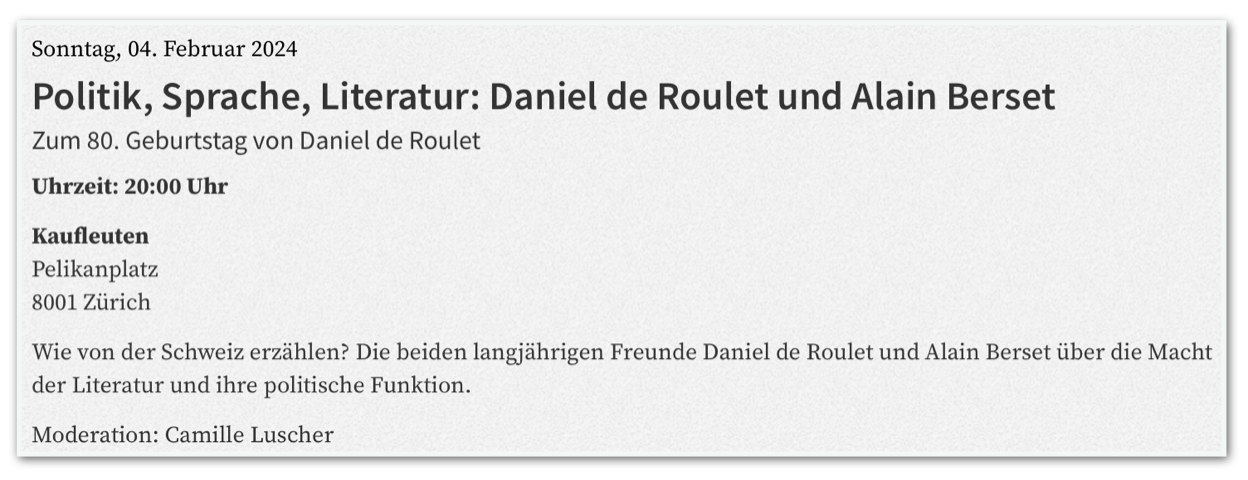
 Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.
Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.









