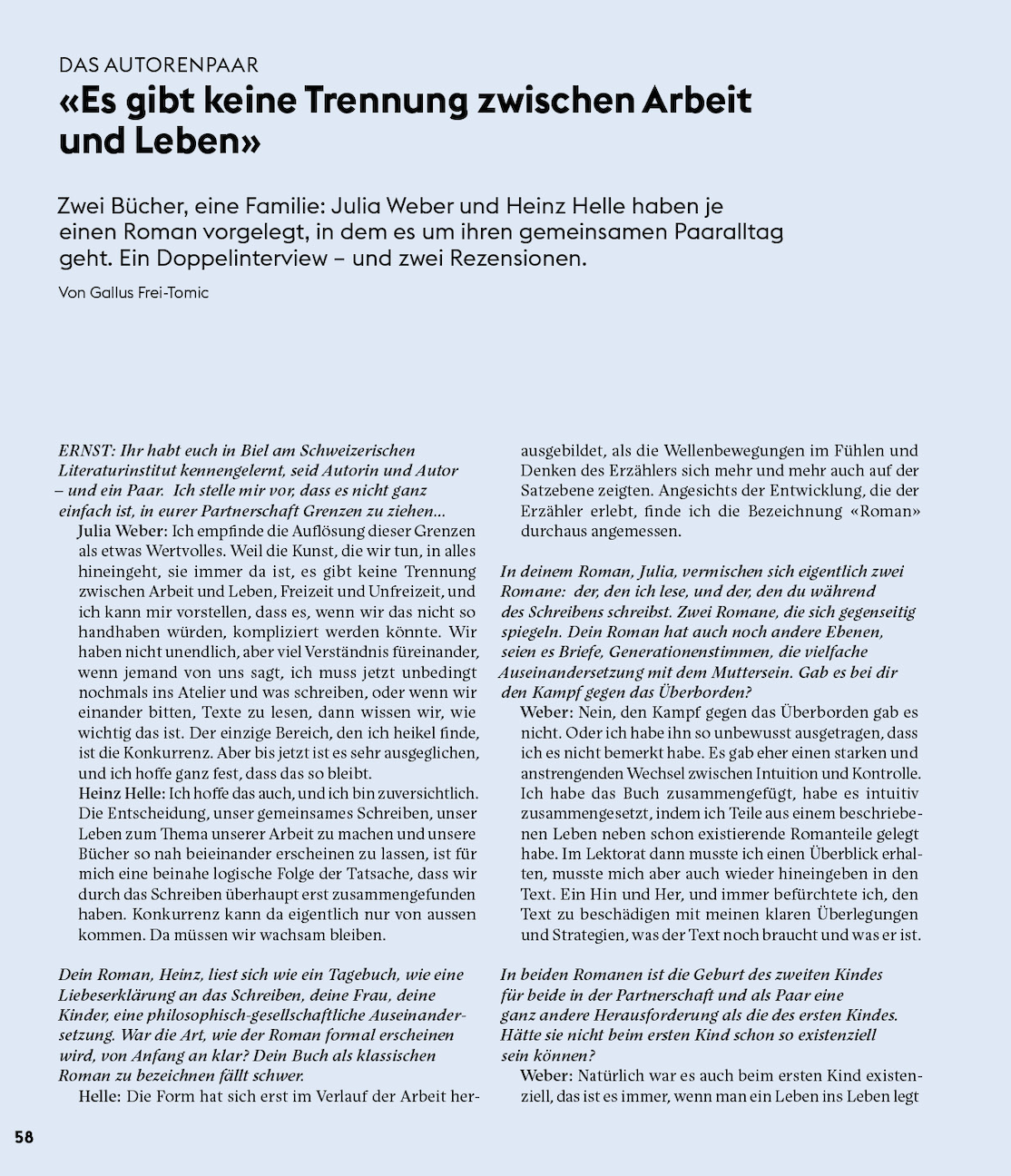„Yeki Bud. Yeki Nabud“, (Es gab jemanden, es gab niemanden.) damit beginnen persische Märchen. Ein Hakawati ist ein Geschichtenerzähler, der mit seiner Schauspielerei das Erzählte unterstreicht, nichts anderes als der Autor selbst, Pierre Jarawan, der einst deutscher Meister im Poetry Slam war und nun, nach seinem 2016 erschienen Debütroman „Am Ende bleiben die Zedern“ mit „Ein Lied für die Vermissten“ erneut einen atmosphärisch starken Roman vorlegt.
„Ein Lied für die Vermissten“ ist ein Familienroman, ein Roman über Freundschaft, die zerstörerische Kraft des Schweigens und die „verlorene Generation“ eines Bürgerkriegs der während 15 Jahren (1975 – 1990) fast 100 000 Tote, 20 000 Vemisste und unzählige Vertriebene forderte. Ein Krieg, der aus dem Paris des Nahen Ostens, der Orchidee des Mittelmeers ein Trümmerfeld machte. Im Libanon, einem Land, aufgerieben in der Geschichte der letzten 70 Jahre, im Dauerkriegszustand mit Israel, zerfleischt von Milizen, annektiert von der syrischen Diktatur, erschüttert von abertausend Bomben.
„Unser Land ist ein Haus mit vielen Zimmern. In einigen Räumen wohnen die, die sich an nichts erinnern wollen. In anderen hausen die, die nicht vergessen können. Und oben wohnen immer die Mörder.“
Ob der Bürgerkrieg in Libanon oder die Kriege nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens – für mich waren es „Sofakriege“, denen man sich während der Nachrichten oder beim Lesen der Zeitungen aussetzte, die durchaus Betroffenheit auslösten, aber zumindest für mich im Hintergrund blieben. Eine Tatsache, für die ich mich heute bis zu einem gewissen Grad schäme, denn diese Kriege klopften immer wieder unüberhörbar an meine Tür, sei es durch das Schicksal von Flüchtlingen, die ich kennenlernte oder eben durch die Literatur.
„Erinnerungen waren Pforten, hinter denen sich ganze Reiche auftaten, die ich noch zu entdecken hatte.“

Pierre Jawaran erfindet Amin und erfindet ihn nicht. Einen Jungen, der zusammen mit seiner Grossmutter nach dem Tod von Amins Eltern nach Deutschland flieht. 12 Jahre später findet die Grossmutter den Mut, wieder zurück ins Land ihrer Familie, in ihre Heimat zu reisen, um einen Neuanfang zu wagen. Einen Neuanfang als Familie, als Unternehmerin, als Malerin. Amin lernt in seiner neuen Umgebung Jafar kennen, einen Mitschüler aus seiner Klasse, den einzigen, der sich für ihn zu interessieren scheint. Jafar ist anders. Nicht nur weil er als kleiner Junge ein Auge verlor, sondern weil er in seinem Wesen wild und nur schwer fassbar ist, weil er mit Amin durch die Ruinen der Stadt zieht, weil er wie ein Hakawati Geschichten erzählen kann, so gut, dass sich damit sogar Geld verdienen lässt, wenn auch nicht immer zum Vorteil aller.
„Das Schweigen ist tiefer als die Stille. Weil Stille nie wirklich alles verschluckt.“
Amin wächst behütet bei seiner Grossmutter auf, einer Frau, die in der Altstadt Beiruts ein Café eröffnet und Bilder von sich an die Wand hängt. Bilder, die kryptisch von den Schrecken des Bürgerkrieges erzählen, so wie das einzige Bild von Amins Mutter, die als junge Frau als Studentin nach Paris kam, eifrig zu malen und zu lieben begann und schwanger und mit dem Bild „Ein Lied für die Vermissten“ nach Hause kam. Die Grossmutter, die die Wahrheit in Bilder und Geschichten verpackt, verpackt die Wahrheit auch für ihren Enkel. Die Wahrheit um Amins Eltern, um Amins Grossvater, ihren Mann, so wie sich in dem Land zwischen den Fronten alles hinter dem Schweigen zu verbergen scheint.
„Schon ein Sandkorn genügt, um eine grosse Geschichte daraus zu machen.“
Amin lernt, dass nichts von Dauer ist, weder die Liebe noch die Freundschaft, weder der Moment grösstmöglicher Nähe noch das Gefühl von abgrundtiefer Verlassenheit, weder Sicherheit noch Geborgenheit. Er begibt sich auf die Suche, die Suche nach seiner Wahrheit, seiner Geschichte, den verlorenen Momenten, die das Glück versprachen. Pierre Jawarans Schreiben widerspiegelt genau dieses Suchen. Sei es die Suche nach Gerüchen, Augenblicken, Erinnerungen, sei es jene nach dem, was Herkunft ebenso ausmacht wie Zukunft. Pierre Jarawan beschränkt sich aber nicht nur auf die Suchreise eines jungen Mannes. Sein Roman ist die Geschichte eines Landes, eines Sehnsuchtsorts, eine Kampfschrift gegen das Vergessen, Verschweigen und Verdrängen.

Interview mit Pierre Jarawan
Irgendwo im ersten Teil Ihres neuen Romans heisst es „Das alte Schiff Beirut. Das Prinzip, das es über Wasser hält, heisst Verdrängung.“ Gilt dieses Prinzip nicht für jedes Schiff, wenn es nicht in den Stürmen untergehen will? Würde dieses Prinzip nicht für jedes Land, jede Stadt, jeden Menschen gelten, müssten wir nicht längst das Steuer herumreissen, was wir auch nach einer Pandemie nicht tun werden?
Ganz sicher ist Verdrängung immer der erste Schritt, bevor es überhaupt eine Form der Aufarbeitung gibt oder geben kann. Verdrängung ist nicht per se negativ, sie kann auch heilsam sein. Und ganz sicher gilt das für alle Länder und Gesellschaftsformen, in denen es Konflikte gab, die eine bestehende Ordnung aufgelöst haben. Ein Schiff kann sich das Prinzip der Verdrängung nicht aussuchen, es ist ein physikalisches Gesetz, so wie sie in Gesellschaften sicher etwas Normales ist, das erstmal passiert. Allerdings darf man Verdrängung und das aktive Verhindern von Aufarbeitung nicht gleichsetzen. Die Figur, die den Satz äussert, bezieht beide Seiten mit ein. Beirut funktioniert, weil verdrängt wird, im Stadtbild, in der Gesellschaft – aber die Frage der Vermissten bspw. wird nicht nur verdrängt, sie wird in ihrer Aufarbeitung mit politischen Mitteln verhindert.
Wir sollten hier auch nicht zwei unterschiedliche Ebenen vermengen, indem wir die Auswirkungen einer Pandemie mit denen eines Bürgerkriegs vergleichen, zumal wir im ersten Fall diese Auswirkungen noch nicht kennen.

Sie selbst sind ein Hakawati, ein Geschichtenerzähler. Aber sie wollen nicht bloss ver- und bezaubern. Sie transportieren. Was steht auf ihrer Fahne ganz oben auf ihrem Mast?
Auch die echten Hakawati, die traditionellen Geschichtenerzähler, wollten nie nur verzaubern oder unterhalten. Ihre Geschichten beinhalteten immer auch eine Art Moral und Aussage über die Gesellschaft. Es ist in meinem Fall nicht so, dass ich programmatisch schreibe, also mit wehender Fahne an den Schreibtisch trete, um eine bestimmte Botschaft loszuwerden. Wenn jemand meine Romane liest, und sie einfach nur spannend findet, und sich gut unterhalten fühlt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Im Fall von „Ein Lied für die Vermissten“ war es mir allerdings tatsächlich ein Anliegen, das Thema durch das Erzählen vor dem Verschwinden zu bewahren, denn genau dieses Verschwindenlassen durch Schweigen passiert – der Roman versucht, dem etwas entgegenzusetzen.

„Ein Lied für die Vermissten“ erzählt von Beziehungen, Freundschaften, von der Liebe. Sei es die tiefe und gleichsam verletzliche Beziehung Amins zu seiner Grossmutter, die Freundschaft zu Jafar, oder die Liebe zu Zarah oder Soraya. Die Nähe scheint immer flüchtig, instabil. So wie der Frieden im Nahen Osten. Ist jeder/jede letztlich schmerzvoll auf sich selbst zurückgeworfen?
Das ist schwer zu verallgemeinern. Denn in den Gesellschaften des Nahen Ostens spielt das Individuum gar keine so grosse Rolle. Es geht fast immer um eine Gemeinschaft, sei es die Familie, oder eine Art Glaubensgemeinschaft, und dieses Auf-sich-selbst-zurückgeworfen-sein ist vielleicht eher ein Abgrenzen, das man gegenüber anderen vollzieht. Aber es stimmt schon, Amin erkennt am Ende des Romans, dass sich sein Leben – wie die Region – in einem immer wiederkehrenden Kreislauf abzuspielen scheint, aus Verlust und Wiederfinden, aus Rätselhaftigkeit und Erkenntnis, und so wieder von vorn …

Amins Mutter malte. Ihr Mutter, Amis Grossmutter, bei der er aufwuchs genauso. Sie malen auch, wenn nicht mit Pinsel, dann sicher mit Sprache. Findet da manchmal ein Kampf statt zwischen dem Sprachmaler und dem der Historie verpflichteten Erzähler?
Ich empfinde es nicht so. Die Historie ist die Grundlage, die diese Geschichten ermöglicht. Sie wirbelt die Figuren durcheinander, zwingt sie zu unterschiedlichen Handlungen, aber sie bleibt im Hintergrund. Sie ist immer nur das auslösende Ereignis, das etwas in Gang setzt, mit dem die Figuren sich auseinandersetzen müssen. Insofern betrachte ich Historie eher als etwas sehr Fruchtbares für mein Schreiben. Als eine Art Katalysator oder – um in Ihrem Bild zu bleiben – als Leinwand oder Grundierung, auf das dann die Sprache gemalt werden kann.

Bleibt der Arabische Frühling ein Frühling, dessen Blühten verdorren oder erfrieren? Wie sehr blutet das libanesische Herz? Ist das der Grund, warum sich ihr Schrieben in ihren ersten zwei Romanen ganz um die Geschichte des Libanons dreht?
Das ist leider unmöglich pauschal zu beantworten, weil die Revolutionen in den Arabischen Ländern unterschiedliche Ausgangspunkte, Voraussetzungen und Verläufe hatten. Ich habe mich immer an dem Begriff gestört, schon 2011, weil er einerseits zu romantisch ist, angesichts der zahlreichen Menschen, die beim Kampf um grundlegende Menschenrechte ihre Leben verloren haben, andererseits, weil er eine zeitliche Begrenzung suggeriert, die schon damals irreführend war.
Ich habe den Arabischen Frühling als Endpunkt für den Roman gewählt, weil ich mit diesem Moment der Hoffnung aufhören wollte, der damals zweifellos bestand, und nur aus heutiger Perspektive sind wir in der Lage, diese Hoffnung als tragisches Missverständnis zu entlarven. Und im Bezug auf den Libanon bedeutet 2011 eine Umkehrung von etwas Grundlegendem. Nachdem jahrzehntelang Libanesen in das sichere Syrien fliehen mussten, kehrt sich das plötzlich um, eine alte Ordnung wird in ihr Gegenteil verkehrt.
Es ist nicht so, dass mein libanesisches Herz blutet, auch wenn ich natürlich eine Enttäuschung angesichts unterschiedlicher Punkte verspüre – die Perspektivlosigkeit für die Jugend, der Unwille, die Vergangenheit aufzuarbeiten, aber ich würde nicht sagen, dass das der Grund ist, weshalb die Historie in beiden Romanen eine grosse Rolle spielt – und ich würde sogar widersprechen darin, dass sie sich „ganz um die Geschichte des Libanons drehen“ – da beide Bücher sich für mich um andere Fragen viel zentraler drehen, nämlich um die Leerstellen, die dort entstehen, wo es eben kein Sprechen über Geschichte gibt. Wie oben gesagt: Für mich ist die Historie eher ein Katalysator, um etwas Kleineres im Grösseren zu erzählen, und das Miterzählen von Geschichte erlaubt es, den Lesern Zusammenhänge vor Augen zu führen, die dieses Kleine erklärbar machen.

Pierre Jarawan wurde 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Amman, Jordanien, geboren, nachdem seine Eltern den Libanon wegen des Bürgerkriegs verlassen hatten. Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland. 2012 wurde er internationaler deutschsprachiger Meister im Poetry Slam. 2013 nahm er an der Weltmeisterschaft in Paris teil. Sein Romandebüt «Am Ende bleiben die Zedern» erschien 2016. Der Roman wurde als bestes deutschsprachiges Debüt beim Festival du Premier Roman in Chambéry vorgestellt. Pierre Jarawan lebt in München.