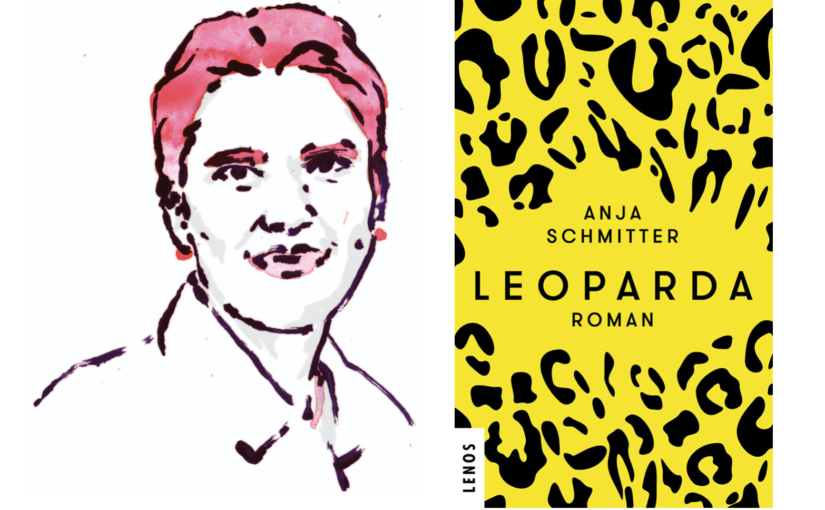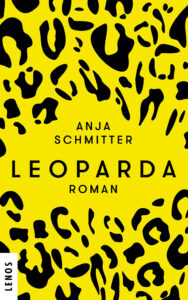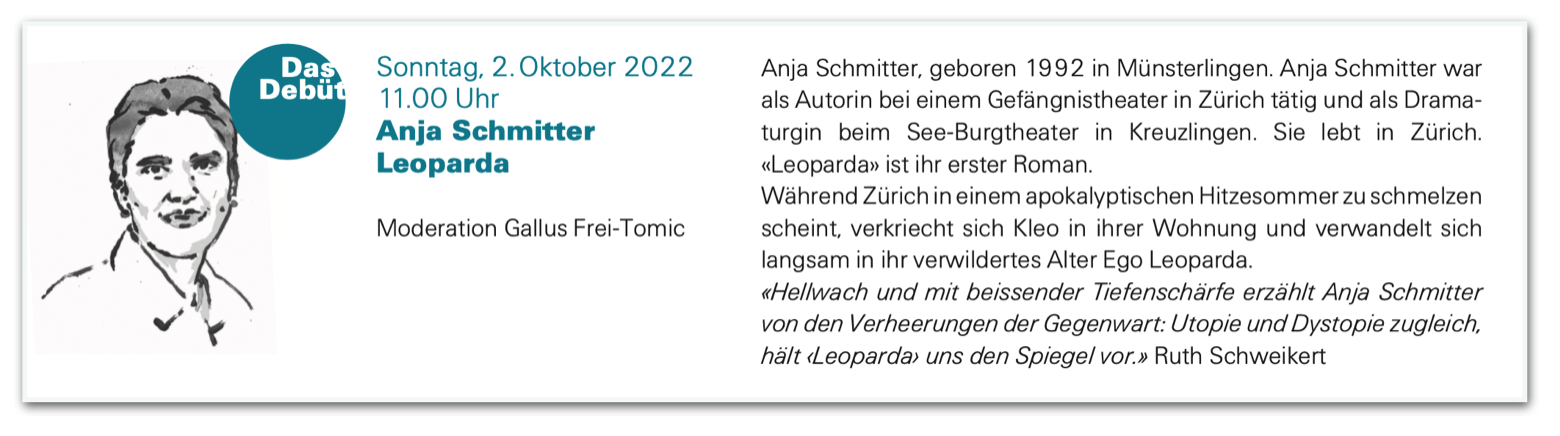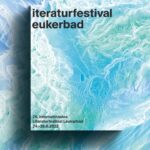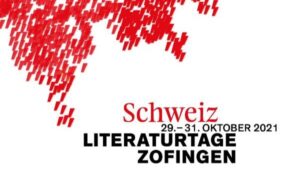Gabrielle Alioth lebt und schreibt seit Jahrzehnten an der Ostküste Irlands. Die Insel, ein Sehnsuchtsort vieler, spielt einmal mehr die Hauptrolle in einem ihrer Bücher – diesmal in einer düsteren Perspektive, schonungslos und und ungeheuer stimmungsvoll. „Die letzte Insel“, ein Roman über das Ende.
Immer mehr Menschen erfahren die Konsequenzen dessen, was unverantwortliche Vergangenheit und Gegenwart anrichten. Seien es Dürren und Sturzfluten dort, wo man in der Vergangenheit niemals in der Intensität damit rechnen musste, Städte, die im Smog ersticken, Trockenheiten, die infernale Brände auslösen oder Altlasten aus der Vergangenheit, die uns in Gegenwart und Zukunft tödlich bedrohen; Abfälle, die in Fässern im Meer versenkt wurden, bis hin zu radioaktivem Material, Phosphor, das aus Bomben ausgestandener Kriege austritt und an die Strände gespült wird, um sich in Verbindung mit Sauerstoff unkontrolliert zu entzünden oder der steigende Meeresspiegel, der ganze Landstriche und Inseln unbewohnbar macht und letztlich noch mehr Menschen dazu zwingen wird, ihre Zukunft an einem scheinbar sicheren Ort zu suchen.
Warum ein Buch lesen, das einem weder schont noch einen Ausweg bietet, das ungeschönt schildert, was passieren wird, wenn die Mehrheit nicht zu einem Richtungswechsel bereit ist. Ist „Die letzte Insel“ ein moralisches Manifest zur Umkehr? Nein. Aber Gabrielle Alioth ist eine Schriftstellerin, die genau hinschaut, sich den Tatsachen nicht verschliesst, auch wenn die Fotografien, die sie dann und wann ins Netz stellt, glauben machen, sie lebe im Paradies. Noch ist es das. Aber es gibt wohl keinen Ort mehr, an dem nicht festgestellt werden muss, dass er auf die eine oder andere Weise, ganz direkt oder indirekt, von den Auswirkungen klimatischer oder umweltbelastender Veränderungen betroffen ist. Auch wenn politische Strippenzieher strategisch darüber hinwegsehen wollen.

„Die letzte Insel“ erzählt von den Konsequenzen. Gabrielle Alioth spinnt weiter, was sie als aufmerksame Beobachterin nicht nur in ihrer Umgebung, sondern überall feststellen muss. Ihr Roman, der in naher Zukunft angesiedelt ist, ist weder realitätsfremder Sience-Fiction noch übertrieben dunkle Dystopie. In zwei Handlungssträngen erzählt die Autorin von Menschen, die im Leben an einen Punkt gekommen sind, an dem sie nur noch hinnehmen können, was übrig geblieben ist. Von zwei Menschen, die nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch in einer scheinbar freien Gesellschaft, im Traum von Glück an einen Endpunkt gekommen sind.
Im Nachhinein wurde Vieles zum Zeichen.
Holm ist Biologe und hat sich auf eine kleine Insel absetzen lassen. Nicht um Neues zu erforschen, sondern um das festzuhalten, was in absehbarer Zukunft durch den steigenden Meeresspiegel verschwinden wird. Völlig überrascht findet er dort eine kleine Gruppe Verbliebener, die Letzten, die trotz allem ausharren; eine kleine Gruppe Mönche. Nach einem nassen Einstand und dem Verlust eines Teils seiner Ausrüstung beginnt Holm seine Streifzüge auf der rauen, baumlosen Insel, einem Eiland, auf dem ihm sehr schnell bewusst wird, wie verloren er wäre, gäbe es die Männer in den Kutten nicht. Holm hat sich von einem totalitären System der Kontrolle und staatlich geführten Wissenschaft abgesetzt. Sein Wirken auf der Insel ist ein letztes Aufbäumen, sein letzter Kampf gegen die Resignation.
Zweite Protagonistin ist eine Schriftstellerin, die alleine und zurückgezogen mit ihrem Hund in einem Haus unweit der Küste lebt. Sie blickt von ihrem Schreibzimmer auf das, was vom grossen Garten übrig beglieben ist. Nicht enden wollende Regenfälle verursachten eine Sturzflut, überfluteten das Haus und rissen Teile des Gartens weg. Mit ihm ihren Mann Alexander. Sie trauert. Nicht nur über den Tod ihres Mannes und das Bewusstsein, wie schnell alles zu Ende sein kann. Sie trauert auch darum, in ihrem Leben nicht mit offenen Karten gespielt zu haben, um all das unrettbar Versäumte.
Beide, die Ich-Erzählerin und der Forscher, erinnern sich, lauschen den Stimmen, die sie heimsuchen, den Lieben, von denen sie lassen mussten. Beide klammern sich an das, was geblieben ist, was sie am Leben hält.
„Die letzte Insel“ ist ein leidenschaftlich erzählter Roman über das Enden. Aber nicht die Trauer darüber steht im Vordergrund, sondern die Liebe zur Natur, zu Pflanzen und Tieren, zum Wind, zum Regen und den Momenten grösster Vertrautheit mit dem, was die beiden Protagonisten und die Schriftstellerin selbst umgibt. „Die letzte Insel“ ist eine Liebeserklärung an das Leben, selbst dann, wenn nur noch wenig davon übrig bleibt, wenn man sich der Endlichkeit bewusst ist. „Die letzte Insel“ beschreibt nicht nur eine geographisch nachvollziehbare Kulisse (Gabrielle Alioth verriet mir, dass es für die Insel eine „Vorlage“ gibt: Inish Meain), sondern das, was an Erinnerungen bleibt, jene Insel, die bleibt, wenn alles andere untergeht. Vor allem die Erinnerungen an die Momente grössten Glücks, der Liebe, des Geborgenseins.

Interview
Wir leben alle auf einer Insel. Wenn ich im Sommer im Süden der Schweiz, im Tessin, zwei Wochen Ferien mache, dann bin ich auf einer Insel, die mich glauben lässt, noch wäre alles in Ordnung. Noch mehr, weil die Schweiz selber eine Insel ist, politisch und wirtschaftlich, wenn auch immer mehr in Bedrängnis. Du pendelst zwischen Irland und der Schweiz, hast im Gegensatz zu vielen Schweizer*innen den Blick von Aussen. Was beschäftigt dich am meisten als „Auslandschweizerin“?
Die Insel ist eine dankbare Metapher für unser Dasein, die Beschränktheit unserer Wahrnehmung, das Leben in einer wie auch immer gearteten „Blase» und vielleicht auch für unsere Sehnsucht nach einer Rückkehr ins Paradies.
Irland und die Schweiz haben sich in ihrer „Inselhaftigkeit“ in den letzten vierzig Jahren angenähert. Beide sind europäischer geworden, wobei Irland ein viel dynamischeres Land bleibt. Als Auslandschweizerin staune ich oft über die – teilweise durch den Föderalismus bedingte – Langsamkeit der Prozesse in der Schweiz; und da ist das gesellschaftliche und private Klagen über die Zustände. Wenn ich Schweizer*innen zuhöre, denke ich manchmal, dass Jammern eine Art «bonding experience» sein muss. Dem gegenüber steht das schweizerische Bewusstsein, dass man halt doch etwas Besseres ist. Die Schweizer reisen ja gern in die ganze Welt, aber viele, so scheint es mir, nur, um sich selbst zu beweisen, dass die Schweiz halt doch der beste Ort auf der Welt ist.
Wie viel von dem ist in diesen Roman mit eingeflossen?
Einer der interessantesten Aspekte von Inseln, denke ich, ist ihre offenkundige Begrenztheit, denn an Grenzen, in der Konfrontation mit dem Fremden/Anderen, wird man sich seiner Voreingenommenheit, seiner (Vor)Urteile bewusst, beginnt sein Verhalten, sein Versagen in einem grösseren Kontext zu sehen. In früheren Romanen ging es mir oft um gesellschaftliche Grenzen, in diesem eher um eine Auseinandersetzung mit natürlichen, bzw. den Grenzen, die eine von Menschen beschädigte Natur uns setzt.
Ich weiss, dass du gerne lange Spaziergänge am Meer entlang machst, dass du fotografierst und dich inspirieren lässt. Vieles auf diesen Spaziergängen scheint in den Roman eingeflossen zu sein, wahrscheinlich auch Erfahrungen mit Phosphor, Erfahrungen mit Überschwemmungen und Unwettern. Wie sehr ärgert dich die Gedankenlosigkeit vieler Menschen?
Der Abfall hier an den Stränden ist ein echtes Problem, und die Iren stehen da weit hinter den Schweizern zurück. Ich sehe aber, dass man sich bemüht und dass es schon sehr viel besser geworden ist. Weniger offensichtlich sind industrielle oder staatliche/militärische Verschmutzungen, z.B. die Munition, die die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg im Beaufort’s Dyke versenkt haben und von der immer mal wieder was an den irischen Küsten angeschwemmt wird, als versuche die Vergangenheit sich an der Gegenwart zu rächen.
Ärgern tut mich das beides nicht. Ich nehme es zur Kenntnis, finde es streckenweise interessant. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen hier in Irland war, dass die Natur immer gewinnt. Der Bach in dem Tal, in dem ich zuerst lebte, ist jedes Jahr über die Ufer getreten, nicht weil die Umwelt sich veränderte, sondern weil sich die Landschaft über Jahrtausende so entwickelt hatte. In den ersten Jahren versuchten wir den Überschwemmungen mit Mauern und Wällen beizukommen. Aber das Wasser war immer stärker, klüger. Das hat mich Demut gelehrt und ich bin dankbar für diese Lektion. In diesem Sinne denke ich auch, dass die Natur die Klimakrise auf ihre Weise überstehen wird, ob die Menschheit dazu auch in der Lage ist, ist eine andere Frage.

Dein Roman ist weder Manifest noch Kampfschrift, keine Abrechnung, kein moralisierender Zeigefinger. Aber manchmal sind deine Schilderungen und Aufzählungen doch haarscharf daran vorbeigeschrammt. Ich bin mir des Dilemmas bewusst. Einfache Unterhaltung allein – daran warst du nicht interessiert. Gibt es während des Schreibens einen Warnmechanismus oder muss man auf ein gutes Lektorat vertrauen, dass man nicht überbordet?
Den Leser*innen irgendetwas zu vermitteln, gehört nicht zu meinen Zielen, ich habe keine „Message“. Das würde ich mir nicht anmassen und es würde meinem Grundverständnis von dem, was Literatur kann und soll, fundamental widersprechen.
Ich denke, das Ziel eines Romans ist es, ein Geschehen und die darin involvierten Personen in seiner/ihrer Komplexität und Ambivalenz darzustellen. Dabei geht es nicht darum, eine Wirklichkeit (oder gar Wahrheit) abzubilden, sondern Zusammenhänge zu erforschen, Konstellationen auszuloten, vielleicht zu einem möglichen Ende zu führen, vielleicht auch Alternativen zu entwickeln. Grundsätzlich denke ich, was Literatur/Kunst im besten Fall erreichen kann, ist, dass der Betrachter, die Leserin seine/ihre Wirklichkeit etwas anders betrachtet, dass sich seine/ihre Wahrnehmung ein klein wenig verschiebt.
Tatsächlich hat mich der Verlag gedrängt, den Text in dem von Dir beschriebenen Sinn zu „schärfen“. Ich habe dem nachgegeben, aber vielleicht hätte ich doch mehr Widerstand leisten sollen.

Dein Roman spielt in nicht allzuferner Zukunft. Sind deine Schilderungen das Resultat einer sorgfältigen Recherche über mögliche Zukunftsszenarien oder vertraust du deiner Intuition, deiner Beobachtung, deiner Erfahrung?
Bevor ich ernsthaft zu schreiben begann, habe ich einige Jahre als Konjunkturforscherin gearbeitet und mit ökonometrischen Simulationen die wirtschaftliche Entwicklung einzelnen Branchen prognostiziert. Lange habe ich es als 180-Wendung in meinem Leben betrachtet, dass ich dann zu schreiben begann. Inzwischen beginne ich die Ähnlichkeiten zwischen Simulation und Fiktion zu verstehen. Beide werden dort eingesetzt, wo das Wissen an eine Grenze stösst, oder wie der frühere Rektor der Uni Basel Antonio Loprieno, sagte „die literarische Fiktion und die wissenschaftliche Simulation vermitteln Bilder alternativer Realitäten.“ Beides sind Versuche, die Grenze zwischen Wissen und Glauben zu bewältigen, in beiden wird die Grenze zwischen Faktischem und Möglichem in Frage gestellt. Beide entwerfen ein Bild von dem, was sein könnte.
Recherchen bilden einen wesentlichen Teil meines Schreibens. Ich denke, ich bin sorgfältig dabei, aber nicht in der Absicht oder gar mit dem Anspruch, etwas möglichst Plausibles zu konstruieren. Genauso wie die Vergangenheit, über die ich in früheren Romanen geschrieben habe, ist auch die Zukunft eine Funktion eines sich laufend verändernden Zustandes, eine Reflexion der Gegenwart und sagt primär etwas über diese aus.
Ein Haus ist eine Insel. Ein Garten ist eine Insel. Eine Klostergemeinschaft ist eine Insel. Eine Liebe ist eine Insel. Wir brauchen diese Inseln. Und doch sind die Bedrohungen manigfaltig. Der Forscher Holm und die Schriftstellerin erinnern sich an ihre Insel-, ihre Liebeserlebnisse. Bleibt man letztlich nicht doch allein, auf der letzten Insel seiner selbst?
Ja ist die einfache Antwort auf diese Frage. Natürlich gibt es Momente der Geborgenheit, der Liebe, in denen wir uns mit einem Menschen, der Welt verbunden fühlen. Aber ich denke, es ist eine (schöne) Illusion zu glauben, dass wir einen anderen Menschen verstehen können oder von ihm verstanden werden, fassen können, was und wie er/sie empfindet. Wir sind zwar nicht immer einsam, aber doch immer allein und dieser Roman ist auch einer über das Scheitern der Liebe.
 Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Für ihr Werk wurde sie 2019 mit dem Kulturpreis der Gemeinde Riehen ausgezeichnet. Gabrielle Alioth ist Präsidentin des PEN Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.
Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Für ihr Werk wurde sie 2019 mit dem Kulturpreis der Gemeinde Riehen ausgezeichnet. Gabrielle Alioth ist Präsidentin des PEN Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.
mehr von Gabrielle Alioth auf literaturblatt.ch
Beitragsbilder © privat


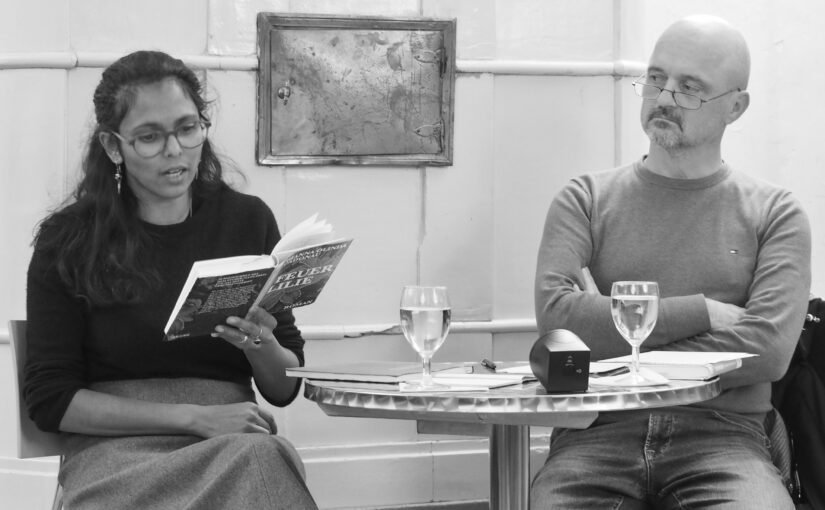
 Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend.
Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend. „Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert.
„Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert. Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.
Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.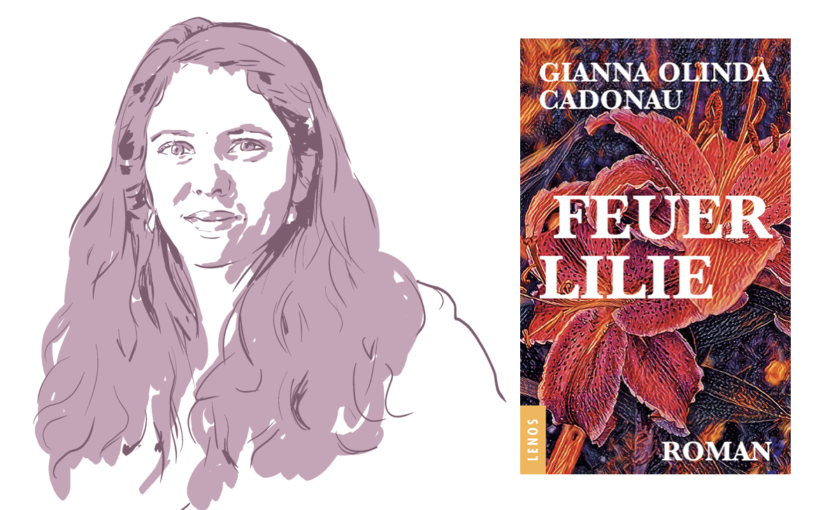
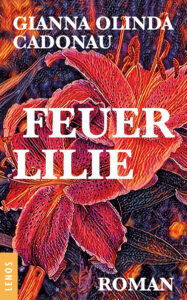
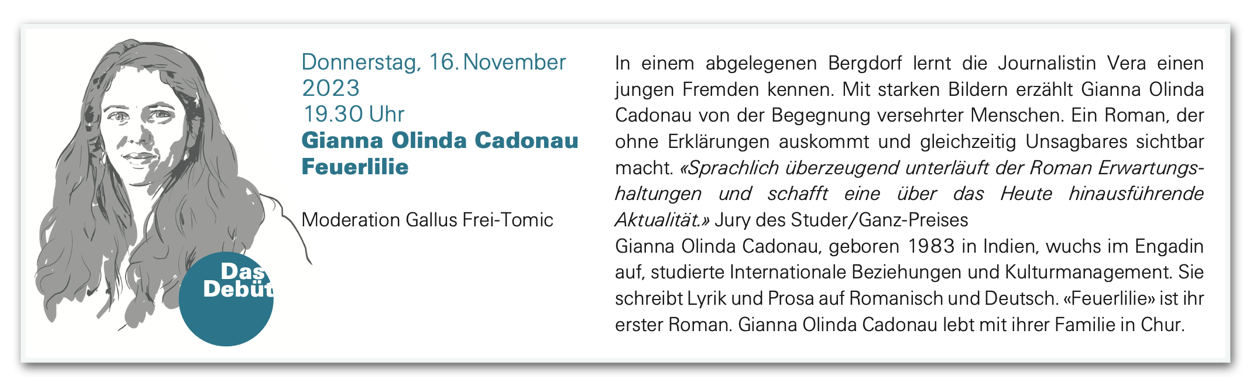

 Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“.
Alice Grünfelder, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, studierte nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und China. Sie war Lektorin beim Unionsverlag in Zürich, für den sie unter anderem die Türkische Bibliothek betreute. Seit 2010 unterrichtet sie Jugendliche und ist als freie Lektorin tätig. Alice Grünfelder ist Herausgeberin mehrerer Asien-Publikationen und veröffentlichte unter anderem Essays und Romane. Sie lebt und arbeitet in Zürich. Im Gepäck ihr 2023 erschienener Roman „Ein Jahrhundertsommer“. Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.
Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «Stories», Musiker aus der Ostschweiz, besitzen die besonderen Fähigkeiten, sich improvisatorisch auf literarische Texte einzulassen. Schon in mehreren gemeinsamen Projekten, zum Beispiel mit jungen CH-Schriftstellerinnen und ihren Romanen oder internationalen LyrikerInnen mit lyrischen Texten, bewiesen die beiden auf eindrückliche Weise, wie gut sie mit ihrer Musik Texte zu Klanglandschaften weiterspinnen können.