Ein Literaturfestival soll zur Auseinandersetzung einladen. Das diesjährige Literaturfestival in Leukerbad tat es – zuweilen emotional. Aber ein Literaturfestival soll auch überraschen. Adania Shibli tat es mit ihrem Roman „Eine Nebensache“. Ein schmaler Roman mit viel Gewicht!
 Sie hätte so viel falsch machen können. Tat sie aber nicht. Ganz im Gegenteil. Adania Shibli ist Palästinenserin und schreibt Arabisch. Ihr erster auf Deutsch erschienener Roman „Eine Nebensache“ erzählt von einer Gräueltat, die im Sommer 1949 von israelischen Soldaten an einem beduinischen Mädchen begangen wurde – einer Gruppenvergewaltigung, einem schrecklichen Mord an einer jungen Palästinenserin.
Sie hätte so viel falsch machen können. Tat sie aber nicht. Ganz im Gegenteil. Adania Shibli ist Palästinenserin und schreibt Arabisch. Ihr erster auf Deutsch erschienener Roman „Eine Nebensache“ erzählt von einer Gräueltat, die im Sommer 1949 von israelischen Soldaten an einem beduinischen Mädchen begangen wurde – einer Gruppenvergewaltigung, einem schrecklichen Mord an einer jungen Palästinenserin.
Es hätte eine späte Racheschrift werden können, eine blutige Anklage, ein Enthüllungsroman. Doch Adania Shiblis schmaler, hoch konzentrierter Roman ist ein Kunstwerk. Aber auch ein Fingerzeig, ein Mahnmahl. Erst recht heute, wo ein alles dominierender Krieg alle anderen Kriege und Konflikte zur Nebensache macht. Erst recht heute, wo die Folgen von Krieg und Gewalt, all die Opfer zur Nebensache werden, weil das Gefühl des Bedrohtseins, die Angst vor globalen Folgen jedes einzelne Schicksal zu einer Nebensache werden lässt. Erst recht, weil es nur ein Mädchen war, die an ihr begangene Gräueltat ein Zwischenfall.
Als Folge der Staatsgründung Israels im Mai 1948 wurden über 700 000 PalästinenserInnen aus ihrer Heimat, aus Palästina vertrieben. Eine angebliche Rückeroberung für all die Siedler, die sich in der Kargheit jener Gebiete, in denen Palästinenser über Generationen als Beduinen lebten, ansiedelten und einen modernen Agrarstaat errichteten. Einem Gebiet, aus dem man ein Volk, das in den Augen ihrer Besatzer minderwertig erschien, verdrängte. Ausgerechnet von Menschen, die während einer Dekade Nationalsozialismus alle vorstellbaren Schrecken erleiden mussten.
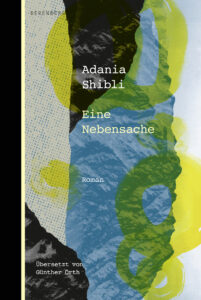
Ein Gruppe Soldaten, die ein Gebiet in Negev zu sichern hat, tötet eine Gruppe Beduinen und verschleppt das einzige überlebende Mädchen. Man sperrt sie ein, reisst ihr die Kleider vom Leib, schruppt ihre Haare mit Benzin, schert sie, vergewaltigt sie der Reihe nach in einer Hütte, schleppt sie in die Wüste und tötet sie wie ein verletztes Tier.
Ein Vierteljahrhundert später macht sich eine junge Palästinenserin nach der Lektüre eines Zeitungsberichts auf die Suche nach Informationen. Eigentlich nur deshalb, weil sich das Vierteljahrhundert genau mit ihrem Geburtstag schneidet, dadurch eine Verbindung entsteht, der sich die Erzählende nicht mehr entziehen kann.
Was die bestechende Qualität dieses Romans ausmacht, ist weder das Thema noch das erzählte Verbrechen, ein Plot. Auch nicht die Suche nach den Spuren oder den Ursachen. Adania Shibli erzählt in zwei Perspektiven. Im ersten Teil rein beschreibend über den einen Soldaten, den Vorgesetzten jener Soldatengruppe. Im zweiten Teil vom Versuch der jungen Erzählerin durch all die territorialen Hindernisse an jene Orte zu gelangen, die ihr die Geschichte erzählen könnten. Im ersten Teil schlüpft die Erzählperspektive nicht einmal in die Innenwelt jenes Soldaten. Das macht aus dem Tun des Soldaten eine fast glatte Erzählfläche, die alles der Leserin/dem Leser übergibt. Selbst die Tat, das schreckliche Geschehen unter den Soldaten, der Mord ganz am Schluss – alles nur beschreibend erzählt, als wäre die Innenwelt Nebensache – was sie auch werden muss angesichts des Schreckens. Der zweite Teil, die Suche der jungen Frau Jahrzehnte später, beschreibt die Lebenswelt einer Palästinenserin, kaum nachvollziehbar für mich als Europäer. Ein in Sektoren eingeteiltes Land, durch Checkpoints und scharfe Kontrollen zerrissen. Eine Welt, die die Normalität zur Nebensache werden lässt.
Und in beiden Teilen des Romans spiegeln sich Bilder des jeweils andern Teils; Ängste, ein Hund, Spinnen, ein Mädchen.
Adania Shiblis Roman schleicht sich ins Unterbewusstsein, beschreibt die Seelenlosigkeit von Menschen in Uniformen, die Seelenlosigkeit eines Landes im permanenten Ausnahmezustand. Und nicht zuletzt stellt der Roman Fragen, wichtige Fragen!
Adania Shibli, geboren 1974 in Palästina, schreibt Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten und Essays und ist zudem in der akademischen Forschung und Lehre tätig. «Eine Nebensache» ist ihre erste Buchveröffentlichung auf Deutsch, die englische Übersetzung war für den National Book Award (2020) sowie für den International Booker Prize (2021) nominiert. Adania Shibli lebt in Palästina und Deutschland.
Günther Orth, geboren 1963 in Ansbach, studierte in Erlangen Islamwissenschaft. Sprachstipendien führten ihn nach Ägypten und Syrien, es folgte ein Übersetzerabschluss Arabisch in Leipzig. In seiner Magisterarbeit und später in seiner Dissertation schrieb er zur modernen Erzählliteratur Syriens und des Jemen, wo er jeweils lebte. Er arbeitet heute in Berlin und weltweit als Übersetzer und Konferenzdolmetscher für Arabisch.






 Urs Mannhart, geboren 1975, lebt als Schriftsteller, Reporter und Landwirt in der Schweiz. Er hat Zivildienst geleistet bei Raubwildbiologen und Drogenkranken, hat ein Studium der Germanistik abgebrochen, ist lange Jahre für die Genossenschaft Velokurier Bern gefahren, war engagiert als Nachtwächter in einem Asylzentrum und absolvierte auf Demeter-Betrieben die Ausbildung zum Bio-Landwirt. Für sein literarisches Werk erhielt er eine Reihe von Preisen, darunter 2017 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Im selben Jahr war er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen; sein Text stand auf der Shortlist. Sein neuster Roman «
Urs Mannhart, geboren 1975, lebt als Schriftsteller, Reporter und Landwirt in der Schweiz. Er hat Zivildienst geleistet bei Raubwildbiologen und Drogenkranken, hat ein Studium der Germanistik abgebrochen, ist lange Jahre für die Genossenschaft Velokurier Bern gefahren, war engagiert als Nachtwächter in einem Asylzentrum und absolvierte auf Demeter-Betrieben die Ausbildung zum Bio-Landwirt. Für sein literarisches Werk erhielt er eine Reihe von Preisen, darunter 2017 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Im selben Jahr war er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen; sein Text stand auf der Shortlist. Sein neuster Roman «
