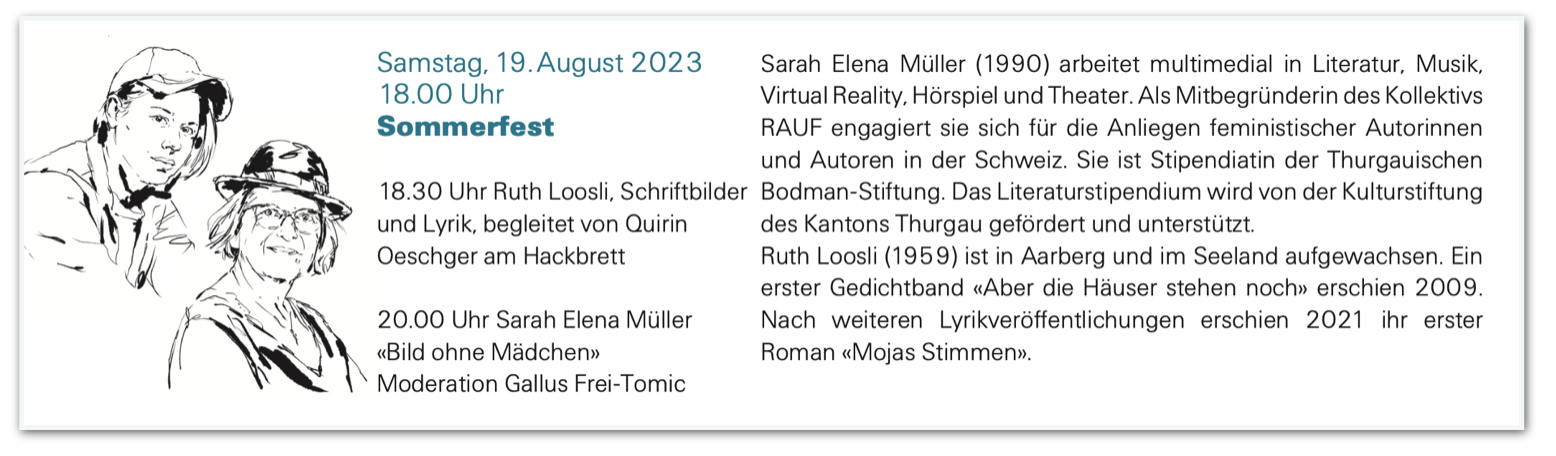Mit ihrer Trilogie „Liebesleben“, „Mann und Frau“ und „Späte Familie“ hat sich die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev tief ins Bewusstsein vieler geschrieben. Nicht nur weil sich die Romane eindringlich lesen, nicht nur weil „Liebesleben“ wie ein Komet einschlug und sieben Jahre später erfolgreich in die Kinos kam, sondern weil die Autorin mit ihren Themen den Nerv der Zeit trifft.
Dass man nun Zeruya Shalevs Erstling, der bereits 1993 unter dem Titel „Dancing, Standing Still“ in Israel erschien und damals im Vergleich zu „Liebesleben“ niemals jene Resonanz erreichte, jetzt auch auf den deutschsprachigen Markt wirft, erscheint zuerst als geschickter Schachzug des Verlags, nach der Lektüre des Buches aber als echtes Geschenk.
Als Zeruya Shalev diesen Roman in Israel schrieb, kannte man die Autorin in ihrem Heimatland in einem kleinen Kreis als Lyrikerin. Im Vorwort der Autorin erzählt Zeruya Shalev, wie sie in einem Café mit dem Manuskript eines Schriftstellers auf diesen wartete. Und weil er sich verspätete, begann sie auf den Rückseiten der Manuskriptseiten zu schreiben. Was damals im Café begann, war wie ein Dammbruch. Zeruya Shalev war 32, verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter. Als sie den Roman in einem wilden Rausch nach eineinhalb Jahren zu Ende geschrieben hatte, zerbrach ihre Familie. Und als der Roman 1993 erschien, liess die Presse die Autorin „verwundet und verängstigt zurück“, so sehr dass sie ihren Glauben an sich als Schriftstellerin beinahe verloren hatte.

Zwei Jahrzehnte später, mit dem Erfolg einer ganzen Reihe Bestseller im Rücken, einer getreuen Leserschaft und dem Umstand, dass die Geschichte ihr Land und die Zeit ihre Themen in den Brennpunkt stellt, ist es nicht verwunderlich, dass „Nicht ich“ derart Wellen verursacht, eben darum, weil der Umstand seines Erscheinens viel mehr ist als ein geschickter Schachzug des Verlags. Als Zeruya Shalev den Roman schrieb, war die Autorin ein Niemand. Da waren keine Erwartungen, da war keine Linie, keine Marke „Zeruya Shalev“. Sie schrieb sich in einen Taumel, der aus jeder Seite schreit. Sie reizt aus, gibt sich unbeeindruckt von Konvention und Tradition. „Nicht ich“ ist der buchlange Monolog einer Frau, die sich verloren, ihre kleine Tochter verloren hat, ihren Mann, ihre Familie, ihre Eltern, ihr Zuhause, das Gesicht in ihrem Spiegel. Und mit dem Titel „Nicht ich“ macht sie unmissverständlich klar, dass es nicht ihre Geschichte ist, auch wenn es trotzdem die ihre ist, eine universelle Geschichte von jemandem, der aus der Spur gerissen wird.
„Wie kann man etwas verlieren, was man nie besessen hat?“
Zeruya Shalev lebt und schreibt in einem Land, das seit seiner Entstehung von Krieg und Terror gebeutelt ist. Am 29. Januar 2004, also vor mehr als 20 Jahren, wurde Zeruya Shalev selbst Opfer eines Selbstmordattentäters und verletzte sich dabei sehr. Eine kollektive Verunsicherung, die im ganzen Roman spürbar ist. So wie ein Land, eine Zivilisation, eine Religion nach Rechtfertigungen sucht, tut es im Roman eine „zerstörte Frau“, der man ihr Kind genommen, die Mann und Familie verloren hat, die sich bewusst ist, vieles in ihrem Leben „falsch“ angegangen zu sein. „Nicht ich“ ist ein lauter Roman aus wilden Träumen und Erinnerungen, aus Bildern, die zwischen Wahn und Realität flirren. Eine Frau voller Schuldgefühle, voller Anklage und Verzweiflung, permanent am Rand ihrer Existenz, von sich selbst und ihrer Wahrnehmung bedroht. Eine Frau, die sich selbst so wenig traut wie ihrer Umgebung. Zu viele unterirdiche Gänge führen zu diesem Kindergarten, da laufen mir zu viele Leute rum. Ich bin mir sicher, ab und zu verschwindet in diesen Gängen unbemerkt ein Kind. Sätze, die wie Messerschnitte die Lektüre zerschneiden.
Alles, was die namenlose Frau hatte, wurde ihr genommen. Selbst die Erinnerung droht in Unsicherheiten zu zerbröseln. Eine Frau, die nicht versteht, was mit ihr geschah und geschieht, die an ihrem Hunger nach Liebe leidet und nicht versteht, wie ihr passieren konnte, was ihr den Boden unter den Füssen wegzieht. Das Erstaunliche an diesem Roman ist die sprachgewordene Verzweiflung und Verunsicherung, der Taumel, die Selbstzerfleischung und der Schmerz. Unglaublich, wie tief Zeruya Shalev in die Wunden blicken lässt. Ich bin mit El Ii Ee Be Ee nicht zurechtgekommen. Für mich war das eine stinkende Verbindung von Schweiss und Sperma, Stechen im Bauch vom Ärger und Kopfschmerzen vom Weinen. Und trotzdem ist „Nicht ich“ eine Liebesgeschichte, wenn auch eine verzweifelte. Da schreibt jemand, der die rosa Brille auf dem Asphalt zertrampelt. „Nicht ich“ ist das literarische Zeugnis einer damals noch unbekannten Autorin und Dichterin, die alles auf eine Karte setzt. Ein Text, der sich in seiner Kraft wie ein Beben liest, der sich auch 30 Jahre nach seinem Entstehen passgenau in eine Zeit fügt, in der alles unter den Bomben der Gegenwart erzittert.
Zeruya Shalev, 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren, studierte Bibelwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Haifa. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe – «Liebesleben», «Mann und Frau», «Späte Familie» – wurde in über zwanzig Sprachen übertragen. Zuletzt erschienen ihre Romane «Schmerz» (2015) und «Schicksal» (2021). Zeruya Shalev gehört weltweit zu den bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit.
Anne Birkenhauer, 1961 geboren, studierte Germanistik und Judaistik in Berlin und Jerusalem und lebt seit 1989 in Israel. Sie arbeitete als wissenschaftliche Assistentin an der Universität und übersetzt u.a. Aharon Appelfeld, Chaim Be`er, Daniella Carmi, David Grossman, Dan Pagis und Yaakov Shabtai.
Beitragsbild © Jonathan Bloom















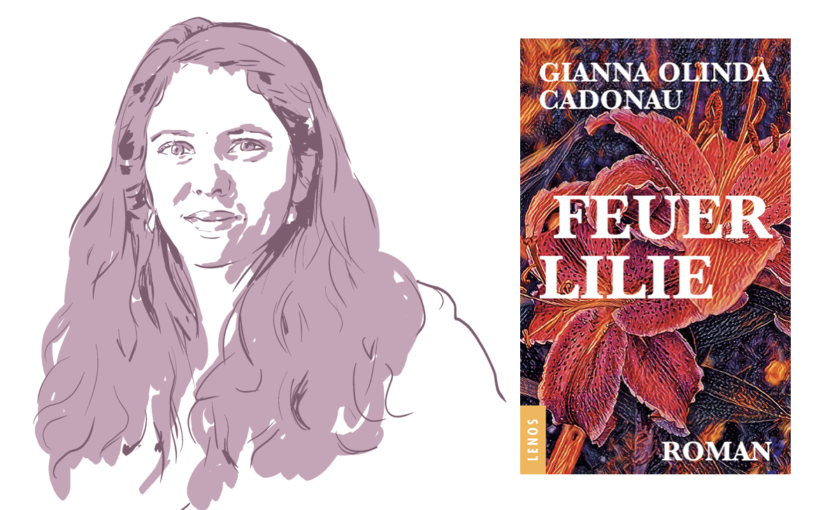

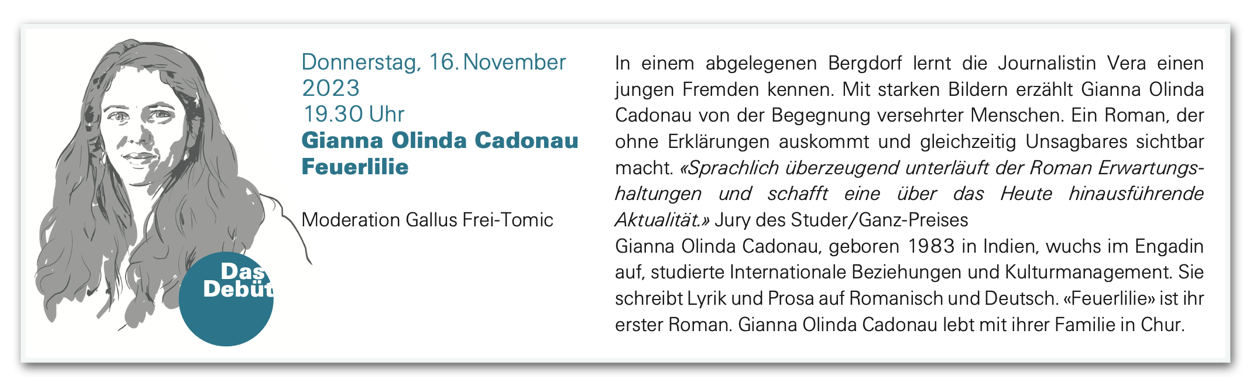

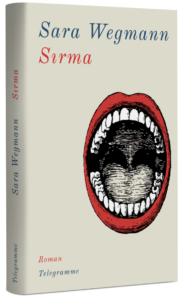 »DU WEISST NICHT, WELCHES BUCH DU ALS NÄCHSTES IN DER BADI LESEN WILLST? DANN HÄTTE ICH EINEN VORSCHLAG FÜR DICH: SIRMA VON SARA WEGMANN.«
»DU WEISST NICHT, WELCHES BUCH DU ALS NÄCHSTES IN DER BADI LESEN WILLST? DANN HÄTTE ICH EINEN VORSCHLAG FÜR DICH: SIRMA VON SARA WEGMANN.«