Anlässlich der Buchtaufe von Markus Bundis neuem Roman «Wilde Tiere» am 10. März dieses Jahres im Gluri-Suter-Haus in Wettingen, bei der Klaus Merz, aktueller Träger des Schweizer Literaturpreises, die Veranstaltung moderierte, verfasste Klaus Merz eine mehr als treffende Einführung zu «Wilde Tiere». Hier wiedergegeben eine leicht angepasste Fassung:
«Das Kaleidoskop sei ein optisches Gerät, das häufig als Kinderspielzeug verwendet werde, so Wikipedia. Es war ursprünglich schon den alten Griechen bekannt, wurde jedoch erst 1817 als Patent angemeldet. Ein Physiker war bei seinen Untersuchungen über die Polarisation doppelbrechender Kristalle darauf gestossen, als er solche in eine spiegelnden Metallröhre schob und betrachtete.
In unserem Fall aber giesst der Schriftsteller Markus Bundi in seinem neuen Buch mit dem Titel «Wilde Tiere» ein knappes Dutzend nicht über jeden Zweifel erhabene menschliche Individuen wie unsereins, ein paar Kunstmuseen von Rang und die dazu gehörenden Kunstwerke samt einer vermuteten Leiche kurzerhand in seine verspiegelte Rollen-Prosa-Röhre.
Bundi lässt in der Folge Kollers Gotthardpost samt erschrecktem Kalb und Dalis Brennende Giraffe plus Schubladenfrau miteinander die Wege kreuzen, hortet ein gestohlenes Bacon-Porträt im düsteren Abstellraum, während Boschs Knabe mit Windrädchen leise den Wänden entlang vorüberzieht. Das Zürcher Kunstmuseum vermischt sich als Ort des Geschehens lichterdings, so übrigens der Titel eines frühen Bundi-Gedichtbandes, mit dem Kunstmuseum in Wien, die neue, lotterige Aarauer Kunsthausterrasse korrespondiert mit dem ältesten öffentlich zugänglichen Kunstmuseum der Welt im reichen Basel. Und das Putzpersonal der gehobenen Anstalt mischt sich äusserst mitteilsam unter die recherchierenden KriminalistInnen vor Ort.
Von Anfang an nicht zu übersehen der ganz und gar hiesige Hausmeister Binz sowie der alte Kunstkenner Assinger, dem Namen nach vermutlich gebürtiger Österreicher – oder ist er gar dem Umfeld von Robert Walsers Aschinger zuzuordnen? – Er trägt einen Topas als Erbstück an seinem Finger und Droste-Hülshoffs Satz «Du hast die Erde, hast den Himmel und deine Geister obendrein» stets in seinem Herzen. – Und ich kann Ihnen versichern, liebe Leserinnen und Leser, weder die Direktorin des Hauses noch Greta Thunberg kommen ungeschoren davon, sogar Frau Merkel wird fast liebenswürdig «verhundst». Und ein Zwillingsschicksal nimmt, als weiterer Nucleus eines möglichen Romans im Roman, einsam seinen Lauf, während Wärter Odradek, das kafkaeske Museumsfaktotum per se, über Olafur Eliassons geflutete Zumthor-Räume in Bregenz nachdenkt und Marco Odermatt im Kunstschnee weiter siegt.

ISBN 978-3-99120-037-6
Nur, geneigte Leserinnen und Leser, leider weit und breit keine wilden Tiere, sondern im Grunde lauter «Denkzettel». Diese triftige Gedankensammlung Markus Bundis von 2022 findet hier ihre novellistische Fortsetzung. Als wildes Sinnieren.
Soviel als Versuch einer kurzen Einführung oder Entsprechung, will sagen, wilden Leseanleitung zu «Wilde Tiere», diesem sozusagen postmodernen Suchbild in Prosa, worin sich das Nichts und Abernichts auf Schritt und Tritt mit unserer Gegenwart vermischen und der heutige Zeitgeist bei Gelegenheit kurz und gehörig gegeisselt wird. Fast alles wird vom Autor mit einem knirschenden Lachen auf den Stockzähnen in den Prosa-Häcksler geschoben. Auch der Mord als Vorwand und Köder für die neugierige Leserschaft.
Wir sollten in diesem kaleidoskopischen Suchbild also vor allem dem Autor selber auf der Spur bleiben, da er ja – wie immer in literarischen Texten – der eigentliche Täter ist und bleibt. – In unserem Fall lautet sein Leitsatz übrigens: «Ich halte den Realismus für einen Irrtum.» Markus Bundi setzt diese Aussage von Georges Bataille als gestrenges Motto schon vor den Anfang seiner Geschichte. – Viel Vergnügen bei der Lektüre und Lesung von Markus Bundis «Wilden Tieren»!»
Klaus Merz
Markus Bundi, 1969 geboren, lebt heute in der Nähe von Zürich. Er studierte Philosophie und Germanistik, arbeitete als Sport- wie auch als Kulturredakteur und unterrichtet seit vielen Jahren an der Alten Kantonsschule Aarau. Seit Beginn des Jahrhunderts publiziert er literarische und essayistische Texte, zuletzt «Vom Verschwinden des Erzählers. Ein Essay zum Werk von Alois Hotschnig» und «Des Möglichen gewärtig. Ein Essay zum Werk von Klaus Merz». 2018 veröffemtlichte er sein Essay zur Ästhetik in Franz Tumlers Spätwerk «Wirklichkeit im Nachsitzen» und seit 2011 erscheint unter Bundis Herausgeberschaft die Klaus-Merz-Werkausgabe im Haymon Verlag. Bei Septime erschienen bisher der Kriminalroman «Alte Bande, Der Junge, der den Hauptbahnhof Zürich in die Luft sprengte» und «Die letzte Kolonie».
Rezension auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © Franjo Seiler




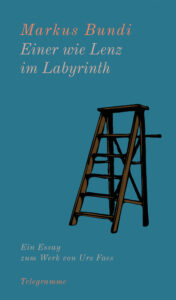


 „Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…
„Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…