„Lichtungen“ ist die Geschichte von Kato und Lev, eine zarte Liebesgeschichte, die Iris Wolff überraschend erzählt, nämlich in neun Kapiteln vom Ende her erzählt. Haben Liebesgeschichten ein Ende? Jene von Kato und Lev nicht, Iris Wolffs Roman nicht, denn der Schluss des ersten Kapitels ist die Frage „Wohin fahren wir?“. Der Anfang ist ein Schluss ist ein Anfang.
Schon in ihren Romanen zuvor ist die Qualität in Iris Wolffs Erzählen die Zartheit ihrer Sprache, dieses filigrane Netz aus Wahrnehmungen, Empfindungen, das Sichtbarmachen des Unsichtbaren. „Lichtungen“ ist die Geschichte einer Freundschaft, zweier Charakteren, die sich wie ein Doppelplanet umkreisen, bis der eine aus dem Gravitationsfeld ausbricht und damit auch die Umlaufbahn des andern zerreisst. Kato reist in den Westen, bricht auf. Lev bleibt im Dorf, bis ihn eine Karte aus Zürich erreicht: „Wann kommst du?“.
Kato und Lev wachsen in Ceaușescus Rumänien auf, das Mädchen Kato mehr oder weniger alleine, zusammen mit einem alkoholkranken Vater, getrieben vom Wunsch auszubrechen, Lev bei seiner Mutter Lis und seinen Grosseltern, seinen beiden Halbgeschwistern, als jüngster Spross einer Familie, in einem kleinen, grauen Ort. Beide sind Aussenseiter, Lev schwächlich, ohne Antrieb, bei all dem Rudelgehabe in der Schule und im Dorf eine Rolle zu spielen, Kato von fast allen gemieden, nicht zuletzt, weil sie sich mit Stift und Papier von all dem absetzt, was die Interessen aller anderen ausmacht. Und weil man Kato dazu verdonnert, dem kranken Lev die Hausaufgaben ans Bett zu bringen, wächst zwischen den beiden etwas, was mit den Jahren immer mehr zu einer Freundschaft wird, die alles andere zusammenzuhalten scheint.

Dass Iris Wolff Malerei studiert hat, zeigt sich nicht nur, weil ihre Protagonistin Kato Künstlerin, Zeichnerin, Malerin ist. Iris Wolff hat eine ganz eigene Fähigkeit zu sehen. Sie schreibt aus den Augen ihrer beiden ProtagonistInnen, ohne in ihre Figur hineinzuschlüpfen. Kato entwickelt ihre ganz eigene Art des Sehens, so wie die Autorin selbst. Auch Lev ist ein Sehender, ein Beobachtender, einer, der mehr wahrnimmt als andere und doch das Gefühl nicht wegbekommt, aussen vor zu sein. Ein Gefühl, das ihn restlos einnimmt, als ein Fremder in Fahrradmontur im Dorf auftaucht und Kato dazu bringt, mit ihm das Dorf mit unbestimmtem Ziel zu verlassen. Kato entschwindet und Lev bleibt. Bis er es nicht mehr aushält und ein kläglicher Versuch eines Ausbruchs ihn wieder zurück ins Dorf spült. Bis Lev Jahre später die Karte aus Zürich erhält und endlich aufbricht.
Vielleicht beschreibt der Titel „Lichtungen“ auch die Art der Freundschaft der beiden. So wie das, was zwischen Kato und Lev über die Jahre entstanden ist, genau das, was „Lichtungen“ in seinem Leben ausmacht. Für Lev ist Kato die Tür zur Welt, für Kato Lev ein Stück Zuhause, etwas, das ihr im Vergleich zu allem anderen nicht genommen werden kann.
Lev, der die Schule abbricht, als Soldat nur schwer zurechtkommt, als Waldarbeiter in die Tiefen der rumänischen Wälder geschickt wird und nur überlebt, weil er Freundschaft mit Imre schliesst, einem Mann, der sich dort selbst bestraft und in dessen Sägerei er später Arbeit findet, wird durch ein Leben geschoben. Kato, die sich ihre Welt mit ihrem Stift, mit Pinsel oder Kreide macht, die mit ihrer Leidenschaft immer am Fenster zur Welt steht, zieht es weg. Eine Freundschaft in Gegenseitigkeit. Eine Freundschaft, die in Liebe eingetaucht ist, in die sich Leidenschaft mischt, die aber immer zuerst Freundschaft bleibt, bis zu diesem einen Satz „Wohin fahren wir?“.
Ihre Strategie, die Geschichte von Kato und Lev in ihrer Chronologie zurückzuerzählen, scheint experimentell. Aber ein Blick zurück, auf ein Leben, eine Geschichte, auch auf die Geschichte eines Landes, jener Ecke Rumäniens, die die nationale Zugehörigkeit immer wieder wechseln musste, ist immer ein Blick zurück. Nur die meist gewählte Erzählrichtung liegt in der Gegenrichtung. Aber während des Lesens von „Lichtungen“ erschliesst sich Schicht um Schicht, erklärt sich Bild um Bild.
Warum „Lichtungen“ ein ähnliches Lesegefühl wie „Die unendliche Leichtigkeit des Seins“ von Milan Kundera bei mir auslöst, weiss ich nicht wirklich. Aber beim Lesen, ich las den Roman gleich zweimal hintereinander, war da das Gefühl, an etwas Besonderem teilhaben zu dürfen.
Interview
Ich bin begeistert und schwer beeindruckt. Zum einen ist es eine Geschichte, in der viele Themen eingebunden sind. Aber genauso deine Art des Erzählens, die Zartheit deiner Sprache, die mich ans Zeichnen erinnert. Es sind keine opulenten, mit Öl gemalten Bilder, sondern Zeichnungen in Pastellfarben, ohne je rührselig oder kitschig zu wirken, fein skizziert, mit vielen Zwischenräumen, Zeichnungen in der perfekten Mischung aus Schmeichelei und Herausforderung. Wie passiert Schreiben bei Iris Wolff? Was sind die Zutaten, dass es klappt? Gibt es Dinge, die du um jeden Preis vermeidest?
Die wichtigste Zutat ist Stille. Sprachliche Äußerungen deuten Wirklichkeit, reduzieren sie, verfehlen sie manchmal haarscharf. Es ist schwer, etwas wirklich Neues zu denken und zu schreiben; nicht immer dieselben Erfahrungen zu machen, weil sich die Zukunft aus den Mustern der Vergangenheit wiederholt. Er wolle malen, was er sehe, und nicht, was er wisse, soll William Turner formuliert haben – dabei ist es geradezu unmöglich, die Welt zu sehen, wie sie an sich ist, weil sich alles immerzu in unsere Gedanken einfärbt. Was mir hilft ist Stille. Dort sind Dinge und Erfahrungen noch nicht beurteilt, zergliedert, analysiert. Sie sind einfach da; sie sind groß, überwältigend, mitunter widersprüchlich. Aus dieser Kraft heraus sind Sätze möglich, die jene Balance halten zwischen Präzision und Offenheit, zwischen Gesagtem und Angedeuteten. Was ich unbedingt vermeiden möchte: Meine Figuren festnageln, ausdeuten ins grellste Licht zerren. Ich möchte ihnen möglichst unvoreingenommen begegnen; sehen, was sich verbirgt, zeigen, was ungesagt ist, aber doch auch gleichzeitig das Verborgene, ihr Geheimnis hüten.

Die Freundschaft zwischen Kato und Lev ist ein feinmaschiges Geflecht, das den beiden ganz unterschiedliche Positionen erlaubt. Obwohl es zwischendurch ganz ordentlich knistert und Eros schon früh mitspielt, lassen sich die beiden nie bis zur letzten Konsequenz auf den anderen ein. Weil sie ahnen, dass Leidenschaft Leiden schafft?
Mir war es wichtig, in der Schwebe zu lassen, ob es Liebe oder Freundschaft ist. Jeder Freundschaft ist Liebe beigemischt, und jeder Liebe Freundschaft. In der Malerei gibt es in der Moderne die Tendenz, den Rand freizulassen. Es wird nicht etwas gezeigt, sondern das Bild zeigt sich. So wie in Katos Skizzen die Strichführung sichtbar ist, ihre Spontaneität, Wucht, Feinteiligkeit, möchte ich auch in der Literatur mit offenen, unbeschriebenen Rändern schreiben – einen weiten Raum öffnen. So können sich Leserinnen und Leser zu einer Geschichte in Beziehung setzen (mit ihren Fragen, inneren Bildern) und letztlich selbst entscheiden, was das zwischen Lev und Kato ist.
Weder Lev noch Kato wachsen in klassischen Familien auf, in Familien, die einem Muster entsprechen. Beide fühlen sich nie ganz und gar zuhause, sicher, aufgehoben. Da ist bei beiden die Sehnsucht nach mehr. Nur manifestiert sich diese Sehnsucht ganz unterschiedlich. Bei üblicher Erzählweise frage ich gerne, ob während des Schreibens der Weg oder gar das Ende klar vor Augen war. Du erzählst zuerst den Schluss. Warum diese Strategie?
Ich habe Lev im Bett liegend kennengelernt, als kleinen Jungen, der nach einem Unfall seine Beine nicht mehr bewegen kann. In dieser reduzierten Welt, bestehend aus Bett, Haus und Familie, aus Geschichten und Geräuschen, war alles enthalten. Ich wusste: Sein Leben wird rückwärts erzählt, denn so begegnen wir einander auch im „echten Leben“. Man lernt jemanden kennen, und wenn sich die Begegnung verstetigt, erfährt man nach und nach, was denjenigen zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. Die Form setzt den Rahmen für bestimmte Fragen. „Jedes Jetzt enthält das Vergangene“ – das ist eine Erkenntnis, die Lev in Zürich, am Anfang des Romans hat. Ich habe mir gewünscht, dass er die Traumata seiner Kindheit eines Tages hinter sich lassen und dass er neu beginnen kann. Ohne Kato wäre ihm das nie gelungen. Erzählerisch war diese Strategie eine Herausforderung, und habe mir vorgenommen, es mir beim nächsten Buch leichter zu machen 😉
Man muss sich aufmachen. Kato und Lev tun es. Du tust es mit jedem Buch. Du machst dich auf in dein Herkunftsland, eine Geschichte, in „fremdes“ Leben. Angesichts der aktuellen Geschichte, der Probleme, die ungelöst anstehen, scheint mir die einzig wirksame Losung zu sein, sich aufzumachen. Weder in der aktuellen Politik noch in Klimafragen spüre ich diesen unbedingten Willen. Vielleicht deshalb meine Überzeugung, dass die Literatur, die Kunst, dieses Aufmachen initieren kann. Wer liest, macht sich auf in andere Welten, öffnet sich. Oder ist Schreiben doch nur Selbstzweck?
Diese Frage berührt den Kern des Buches. Lev und Katos Geschichte ist als Reise in die Vergangenheit angelegt, weil Erkenntnis am leichtesten rückwirkend geschehen kann. Umso frustrierender, wenn wir merken, dass der Mensch anscheinend nicht fähig ist, aus den vergangenen Jahrhunderten mit seinen Kriegen und Diktaturen zu lernen. Der Blick zurück ist wichtig. Aber wahre Veränderung ist nur möglich, wenn man sich traut, radikal neu zu denken. Es kommt mir vor, als laborierten wir an Systemen herum, die grundsätzlich nicht mehr taugen. Nehmen wir das Beispiel Klimaschutz oder unser Umgang mit der Tierwelt. Wir gehören zur Natur, sind abhängig von anderen Lebewesen. Aber die menschliche Gier setzt sich über diese Einsicht hinweg. Dabei haben wir eine gemeinsame Geschichte, eine Übereinkunft: dass das Leben nur im Verbund möglich ist. Aber statt eine neue Tier-Ethik aufzustellen oder den Mut zu haben, Klimaschutz als oberste Priorität zu setzen, werden nur ab und an (oft genug nicht einmal das) Gesetze verabschiedet, die etwas verbessern sollen. Man könnte, wenn man hier in die Tiefe geht, leicht verzweifeln. Was Bücher auf einzigartige Weise können ist: Empathie erzeugen. Weil wir mit Büchern die Welt aus den Augen eines anderen Menschen sehen. Das gilt generell für Kunst: Wir weiten – für die Dauer eines Films, eines Buchs, eines Musikstücks – die Grenzen unseres fest gefügten Selbst und begreifen vielleicht, wie sehr alles miteinander verbunden ist.
„Lichtungen“ ist auch ein Buch der Auslassungen, der Ungewissheiten. Du leuchtest die Szenerien nicht aus. Dein Roman will nicht erklären. Es sind „Lichtungen“, die du beschreibst. So wie die eine Szene im Wald, der Kampf zwischen zwei Wölfen. Eine Szenerie, die nicht verdeutlicht, aber eine Stimmung erzeugt, eine Ahnung, Diskussionsstoff für ganz viele Leserunden, die sich mit deinem Buch zusammensetzen. Wie sehr ist dein Schreibprozess, dieses Buch, der Spiegel deiner ganz eigenen Prozesse? Oder wie sehr öffnest du dich im Schreiben der Einmischung und Beeinflussung?
Jedes Buch ist wie ein weiterer Jahresring eines Baums. Bücher sind Wachstumsprozesse. Es kann mitunter befremdlich sein, aus früheren Werken zu lesen; ein wenig so, als würde man alte Fotoalben durchblättern. Jeder neue Text verhandelt Fragen und bezeugt sicher auch Veränderungen der Weltwahrnehmung. Ich habe in Lichtungen mit Lev gelernt, dass das Gegenteil von Sprechen nicht Schweigen ist, sondern Hören. Dass es wichtig ist, ab und an zu überprüfen, ob Glaubenssätze und Selbstbilder einen am Gehen hindern. Und was den Schreibprozess anbelangt: Ich habe das Manuskript lange für mich behalten, weil ich Angst hatte, dass mir jemand das Rückwärtserzählen ausreden wird. Gleichzeitig bin ich immer offen für Einmischung. Die besten Hinweise begegnen einem zufällig. Wenn man auf „Empfang“ gestellt ist, arbeitet das Leben, der Zufall, die Natur, andere Menschen an der Geschichte mit.
Iris Wolff liest am 8. Juni in Frauenfeld CH!
Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt, Siebenbürgen, studierte Germanistik, Religionswissenschaft, Grafik und Malerei. Sie ist Mitglied des internationalen Exil-PEN und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Marieluise-Fleißer-Preis und den Marie-Luise-Kaschnitz-Preis für ihr Gesamtwerk. Für «Die Unschärfe der Welt» (2020) erhielt unter anderem den Solothurner Literaturpreis. Ausserdem wurde der Roman sowohl von deutschen als auch von Schweizer Buchhändlern zu einem der fünf beliebtesten Bücher gewählt. Iris Wolff lebt in Freiburg im Südwesten Deutschlands.
Rezension von «So tun, als ob es regnet» auf literaturblatt.ch
«(Er)zählen», Iris Wolff, Plattform Gegenzauber
Beitragsbild © Max Gödecke



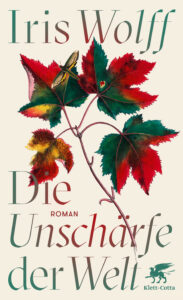



 eisigen Kälte, weg vom Tod und der dauernden Angst, hinein in ein Dorf, in eine Familie. Weg vom Grabenkrieg im weiten, waldigen Gebirge in eine warme Stube, ein weiches Bett, an einen reich gedeckten Tisch. Jacob, der Soldat, freundet sich mit der jüngsten Tochter an, erzählt ihr Geschichten, zuletzt auch jene seines Bruders, der weit weg seine Schuhe am Rand einer tiefen Schlucht auszog. Eine Geschichte später, Jahre dazwischen, treffen sich der Grossvater Elemér und seine Enkelin Henriette im Garten, beide schlaflos, von Unruhe gepackt in der «Gesellschaft der Schlaflosen». Eine Familie droht durch die Geschichte zerrissen zu werden und Herniette weiss, dass sie nicht ist, wie die anderen, nicht einmal wie ihre Schwestern. Noch einmal Jahre später, als der Mond durch Amstrong in Besitz genommen wird, Vicco an der Distanz zu seiner Mutter Henriette zu zerbrechen droht, Liane kennenlernt und mit ihr bis zum Schwarzen Meer im Trabi fährt. Und noch einmal Jahre später, Henriette ist als Grossmutter und ganz besondere Frau bloss noch Erinnerung, die junge Hedda auf einer Insel im Meer erfährt, dass ihr Vater Vicco an Krebs erkrankt ist. Hedda beobachtet ein Paar, das in einen Fischerkahn steigt. Ein Boot, das nie zurückkehrt. So wie die Wellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft.
eisigen Kälte, weg vom Tod und der dauernden Angst, hinein in ein Dorf, in eine Familie. Weg vom Grabenkrieg im weiten, waldigen Gebirge in eine warme Stube, ein weiches Bett, an einen reich gedeckten Tisch. Jacob, der Soldat, freundet sich mit der jüngsten Tochter an, erzählt ihr Geschichten, zuletzt auch jene seines Bruders, der weit weg seine Schuhe am Rand einer tiefen Schlucht auszog. Eine Geschichte später, Jahre dazwischen, treffen sich der Grossvater Elemér und seine Enkelin Henriette im Garten, beide schlaflos, von Unruhe gepackt in der «Gesellschaft der Schlaflosen». Eine Familie droht durch die Geschichte zerrissen zu werden und Herniette weiss, dass sie nicht ist, wie die anderen, nicht einmal wie ihre Schwestern. Noch einmal Jahre später, als der Mond durch Amstrong in Besitz genommen wird, Vicco an der Distanz zu seiner Mutter Henriette zu zerbrechen droht, Liane kennenlernt und mit ihr bis zum Schwarzen Meer im Trabi fährt. Und noch einmal Jahre später, Henriette ist als Grossmutter und ganz besondere Frau bloss noch Erinnerung, die junge Hedda auf einer Insel im Meer erfährt, dass ihr Vater Vicco an Krebs erkrankt ist. Hedda beobachtet ein Paar, das in einen Fischerkahn steigt. Ein Boot, das nie zurückkehrt. So wie die Wellen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft.
 Iris Wolff geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen. Studium der Germanistik, Religionswissenschaft und Grafik & Malerei in Marburg an der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, 2013 Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Neben dem Schreiben ist sie am Kulturamt der Stadt Freiburg im Breisgau tätig. Ihr erster Roman „Halber Stein“ erhielt den Ernst-Habermann-Preis 2014.
Iris Wolff geboren 1977 in Hermannstadt/Siebenbürgen. Studium der Germanistik, Religionswissenschaft und Grafik & Malerei in Marburg an der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, 2013 Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Neben dem Schreiben ist sie am Kulturamt der Stadt Freiburg im Breisgau tätig. Ihr erster Roman „Halber Stein“ erhielt den Ernst-Habermann-Preis 2014.