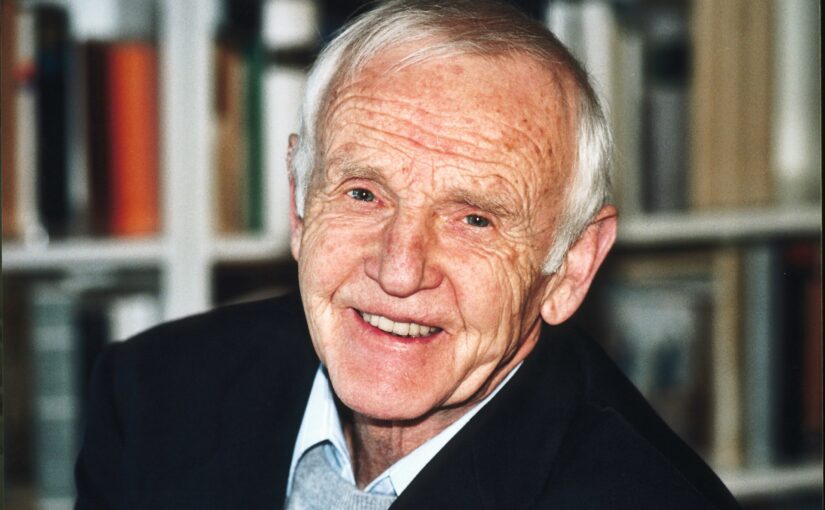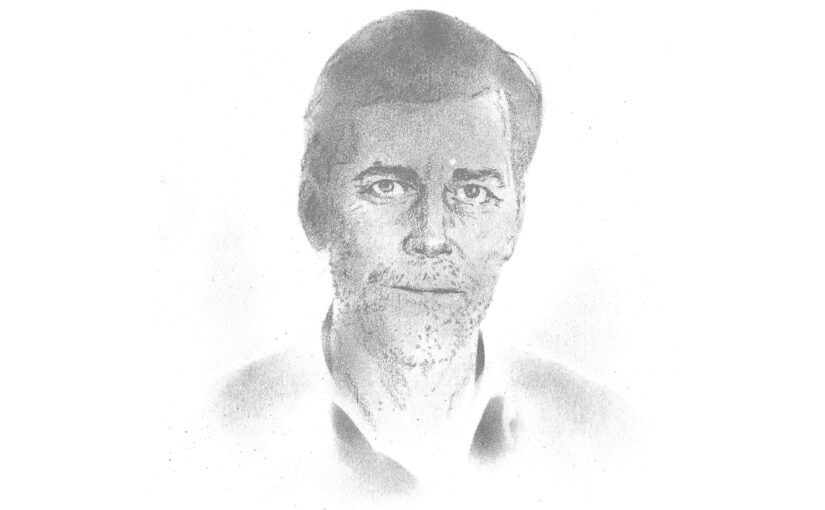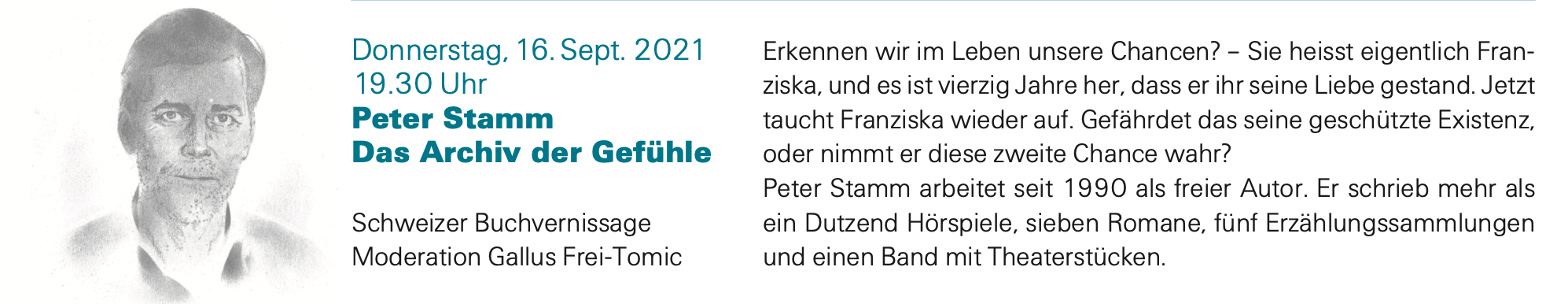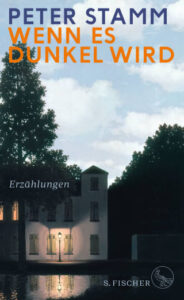Die junge Lize Spit erzählt in ihrem dritten, auf Deutsch erschienenen Roman «Der ehrliche Finder» von der bedrohten Freundschaft zwischen Jimmy und Tristan. Ein Erzählen, das es meisterhaft versteht, die kindliche Perspektive zu einer Art des Sehens zu machen. Ein Roman voller Zuwendung!
Tristan und Jimmy sitzen in der Schule in der gleichen Bank. Tristan, als Sohn einer grossen Flüchlingsfamilie quer durch ganz Europa aus dem Balkan bis nach Belgien gekommen, Jimmy aus der Einfamilienhaussiedlung, aus einem Haus ohne Vater. Tristan Ibrahimi mit seiner ganzen Familie, Schwestern und Brüder, Mutter und Vater. Jimmy von einem Zuhause, wo sich die Mutter seit Vaters Verschwinden nur mehr schwer aus dem Bett bringt. Und weil Jimmy es gewohnt ist, die Welt, die sich ihm stellt, in kleinen Schritten anzugehen, ist die Tatsache, dass sich Tristan neben ihm in der gleichen Schulbank findet, Aufgabe genug. Jimmy zeigt Tristan seine Welt und Tristan lernt. Er lernt den Ort, die Schule, die Sprache. Und mit einem Mal ist Jimmy auch ein Teil der Welt von Tristan. Einer mitgenommenen Welt. Einer Welt in einer grossen Familie. So ganz anders wie das verlorene Glück in Jimmys Familie, seit der Vater nicht mehr da ist, alles im Haus, was an ihn erinnern könnte, ausgemerzt ist.
Jimmy sammelt Flippos, kleine, bunte Klebebilder, die er in Alben sammelt. Und weil sein Taschengeld nicht reicht, um jene Chipstüten zu kaufen, in denen Flippos beigelegt sind, macht Jimmy jeden Tag seine kleine Fahrradtour und sucht in irgendwelchen Automaten nach liegengelassenen Münzen. Bis er eines Tages, mittlerweile liegt der Ausweisungsbescheid an die Familie Ibrahimi auf ihrem Tisch, im Schlitz eines Geldautomaten ein Bündel Banknoten sieht. Er bleibt stehen, nimmt das Bündel; 5000 Gulden – eine Menge Geld für eine ganze Menge Chipstüten. Aber das vermeindliche Glück dauert nicht lange. Ein Mann fährt mit seinem Auto vor und fragt Jimmy, was der in seiner Jackentasche verschwinden liess. Jimmy ist das Geld wieder los. Nicht einmal ein Finderlohn. Ein ehrlicher Finder. Erst später wird Jimmy bewusst, wofür man das Geld auch noch hätte brauchen können, zum Beispiel für einen Anwalt.

Jimmy sammelt nicht nur Flippos, irgendwann, wenn die Gelegenheit die richtige ist, wird er auch seinem Freund Tristan ein volles Album übergeben, Jimmy sammelt Geschichten. Er schreibt in ein kleines Buch, dem er den Titel „Tristans Krieg“ gab. Er schreibt, was er von Tristan erfährt, chronologisch. Er versuchte nicht, eigens danach zu angeln, Sensationen wollte er nicht, das passte nicht zu seinem Beruf als Ehrlicher Finder. Was Jimmy erfährt, ist nicht leicht einzuordnen, noch weniger das, was im Dorf die Runde macht.
Aber die Familie Ibrahimi bringt nicht nur Jimmys ehrliche Seele in Aufruhr. Das ganze Dorf wird mitgerissen. Ibrahimis enges Zuhause wird zugedeckt von Dingen, von denen andere glauben, man könne sie in der Not brauchen; Möbel, Säcke mit Bettwäsche und Kartons voller Spielzeug, Dinge, die Kurt, der Vermieter der Ibrahimis, in seiner Gebrauchtwarenhandel „Klein-Kosovo“ wieder zu gutem Geld macht. Im Dorf formiert sich eine Allianz, die erreichen will, dass die Ibrahimis bleiben können. Jimmy würde seinen Freund nicht verlieren. Tristan, von dem er nur den Tristan-nach-der-Flucht kennt, den Tristan mit der permanenten Angst, ausgewiesen zu werden, nie den kosovarischen Tristan, der einst auf einem Bauernhof aufwuchs.
Lize Spit ist eine Spezialistin der Ausnahmezustände. Das bewies sie auch schon mit ihrem vorherigen Roman „Ich bin nicht da“ über eine junge Frau, der die grosse Liebe von einer psychischen Erkrankung weggerissen wird. Lize Spit erzählt in kleinen Geschichten von den grossen, wichtigen Dingen des Lebens; von Freundschaft und Liebe, von der Suche nach Zugehörigkeit und dem Wunsch verstanden zu werden. Lize Spit erzählt in ruhigen Bildern, scheinbar unspektakulär, aber mit grösstmöglicher Empathie. Kein Wunder, hat dieses warmherzige und ehrliche Buch über eine Freundschaft zwischen einem belgischen und einem kosovarischen Jungen in Belgien Diskussionen ausgelöst. Das Buch hat es in sich!
Lize Spit wurde 1988 geboren, wuchs in einem kleinen Dorf in Flandern auf und lebt heute in Brüssel. Sie schreibt Romane, Drehbücher und Kurzgeschichten. Ihr erster Roman «Und es schmilzt» stand nach Erscheinen ein Jahr lang auf Platz 1 der belgischen Bestsellerliste, gewann zahlreiche Literaturpreise und wurde in 15 Sprachen übersetzt. Auch ihr zweiter Roman, «Ich bin nicht da», war ein großer Erfolg. Mit ihrem dritten Roman, «Der ehrliche Finder», hat sie ein ganzes Land aufgewühlt.
Helga van Beuningen ist die Übersetzerin von Margriet de Moor, A. F. Th. van der Heijden, Marcel Möring, Cees Nooteboom u.a. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Martinus-Nijhoff-Preis, dem Helmut-M.-Braem-Preis und dem Else-Otten-Preis. 2021 wurde ihr der Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW verliehen.
Beitragsbild © Lieve Blanquaert






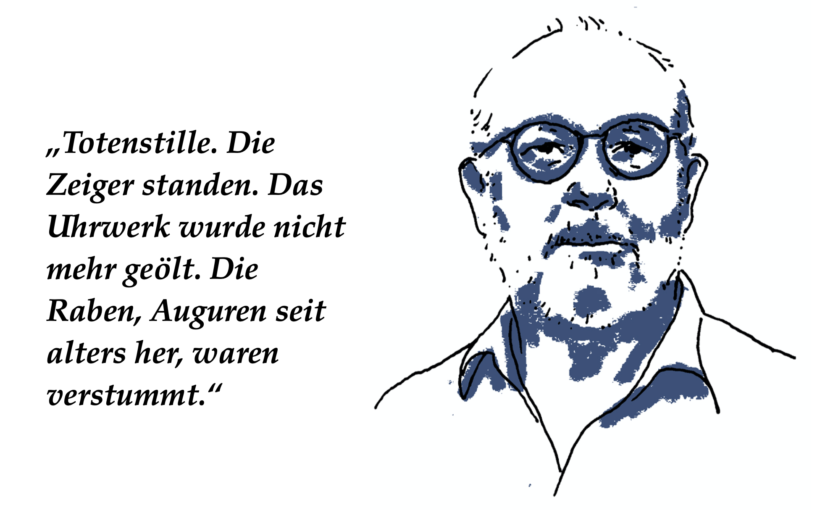


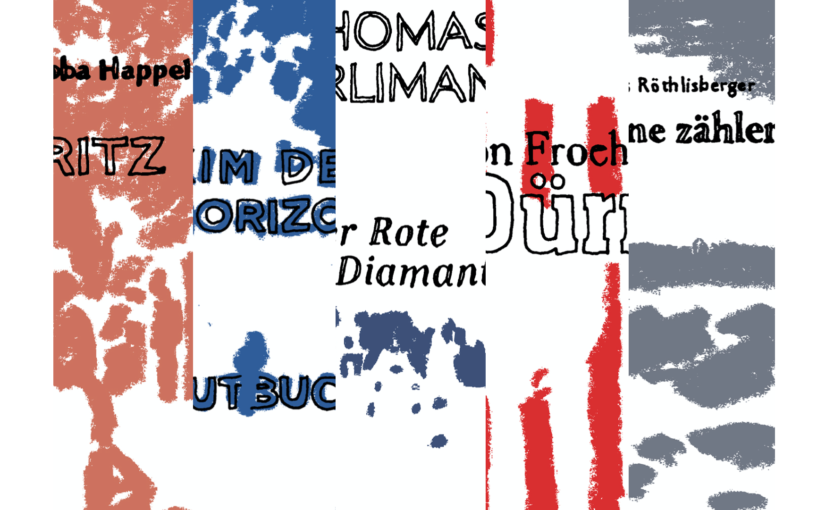

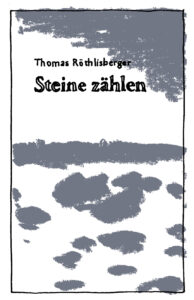 Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese
Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese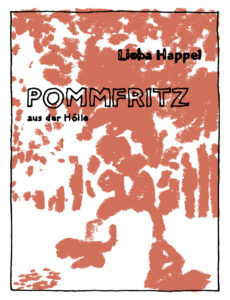 Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher
Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher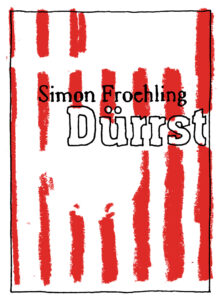 Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag
Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont
Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont
 Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel
Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel