 Christoph Geiser, Träger des Schweizer Literaturpreises 2020, über den es auf der Webseite des Bundesamtes für Kultur heisst: Ein scharfzüngiger, sprachmächtiger Erzähler zeigt sich als Chronist, Museumsbesucher, Leser, Beobachter, Tourist, Gourmet und verhinderter Gerichtsreporter, bot mit der jungen «Literaturaktivistin» Svenja Gräfen aus Leipzig und der in Moskau geborenen Katerina Poladjan ein vielseitiges Kontrastprogramm.
Christoph Geiser, Träger des Schweizer Literaturpreises 2020, über den es auf der Webseite des Bundesamtes für Kultur heisst: Ein scharfzüngiger, sprachmächtiger Erzähler zeigt sich als Chronist, Museumsbesucher, Leser, Beobachter, Tourist, Gourmet und verhinderter Gerichtsreporter, bot mit der jungen «Literaturaktivistin» Svenja Gräfen aus Leipzig und der in Moskau geborenen Katerina Poladjan ein vielseitiges Kontrastprogramm.


Katerina Poladjan schreibt von «unbekannten Gebieten», nicht Kartographiertem, jenem Unerschlossenen, Unentdeckten in uns. In ihrem aktuellen Roman «Hier sind Löwen» erzählt Katerina Poladjan von Helen, die wie die Autorin selbst einen armenischen Familiennamen trägt. Helen ist auf der Suche nach Spuren, verwickelt sich in neuen Zugehörigkeiten, in einer Geschichte, die weit in die tragische Geschichte des armenischen Volkes zurückgreift. Helen ist Buchrestauratorin, flickt aber nicht einfach alte Folianten. Sie macht Geschichte und Geschichten sichtbar. Die Geschichte Armeniens, ihrer Familie, ihre eigene Geschichte. Katerina Poladjan nennt ihren Roman ein Erinnerungsfenster, ihr Fenster in die Erinnerung eines Landes. «Hier sind Löwen» löste in Armenien selbst ganz gemischte Reaktionen aus, war es doch den einen zu zahm, zu wenig dramatisch. Die Autorin selbst zeigt sich aber überrascht, dass ihr Roman sowohl ins Türkische wie ins Armenische übersetzt wurde, dass es das Buch schaffte, auf «beiden Seiten» gelesen zu werden. Etwas, das nur gelingen konnte, weil die Autorin es schafft über den Genozid zu schreiben ohne in das übliche Täter-Opfer-Muster zu verfallen.


Christoph Geiser ist mit vielen seiner Romane als Familienchroniker, als Seismograph und Kritiker der «heiligen» Familie in die Literaturgeschichte eingegangen, genauso wie als Stimme der Verbannten und Verstossenen. Christoph Geiser ist ein «Entfesselungskünstler», sprachlich, formal und inhaltlich.
Sein preisgekrönter Erzählband «Verfehlte Orte» ist der Schnittpunkt seiner Motive, ein Band, in dem Christoph Geiser sämtliche Register seines Könnens zeigt, seine Radikalität, seine Lust zu fabulieren genauso wie jene zu provozieren.
Selbst in seinem neuen Romanprojekt, seinem «letzten Manuskript» ist der Ursprung des Schreibens eine Art Provokation. Der Protagonist, Christoph Geiser sitzt auf seiner Grabkiste und räsoniert. Aber der Schriftsteller Christoph Geiser ist zurückgebunden, denn sein neuer Roman über seine jüdische Grossmutter la grandmama russe verlangt nach Recherche in Minsk, Moskau, Gorki und Nazareth. Aber wer fährt jetzt dorthin. 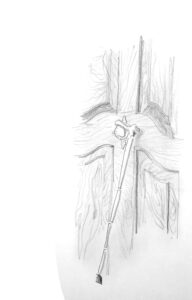 Christoph Geiser ist auf der Suche nach den «Hasen», einer Familie, deren Name sich verloren hat in Geschichte, Verfolgung, Verbannung und Genozid. Die Geschichte einer verrückten Grossmutter, wieder eine Familiengeschichte, die sich nach der jüdischen Apokalypse verlor. Über eine Frau, die in der Engelgasse in Basel die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte, nachdem sie aus dem Irrenhaus entlassen wurde.
Christoph Geiser ist auf der Suche nach den «Hasen», einer Familie, deren Name sich verloren hat in Geschichte, Verfolgung, Verbannung und Genozid. Die Geschichte einer verrückten Grossmutter, wieder eine Familiengeschichte, die sich nach der jüdischen Apokalypse verlor. Über eine Frau, die in der Engelgasse in Basel die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte, nachdem sie aus dem Irrenhaus entlassen wurde.
Christoph Geiser ist ein lustvoll Massloser, dessen Virtuosität und sprachliche Leidenschaft in krassem Gegensatz steht zu seinem Gehstock, der hinter ihm am Türknauf zum Nebenraum hängt. «Was bleibt? Die Geschichte. Der Wahnsinn.» In seinem kommenden Roman «Die Spur der Hasen» wird Christoph Geiser von der Tragödie des Ostjudentums erzählen, die Opfergeschichte eines Kollektivs, sich einmal mehr mit dem Vergessen auseinandersetzen.


Ein wunderbar angenehmer Kontrast zu Christoph Geiser bot Svenja Gräfen mit ihrem 2019 erschienen Roman «Freiraum». Er, der sich an seiner Geschichte, seinem Leiden abarbeitet, sie, die sich locker und flockig mit dem Personal einer ganz besonderen Bühne beschäftigt; einer Hausgemeinschaft, einem Versuch alternativen Wohnens am Stadtrand, von den Träumen einer noch offenen, vielversprechenden Zukunft und den Ernüchterungen in den aufkommenden Zwängen. Svenja Gräfen macht ein Haus zu einem eigentlichen Experimentierfeld, witzig mit starken Dialogen – eine eigentliche Soziostudie über Lebens- und Wohnentwürfe.
Und am Sonntag? Elsie Schmit liest aus ihren Erzählungen «Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen», Miku Sophie Kühmel aus «Kintsugi», einem flimmernden Roman über die Liebe in all ihren Facetten, Kirstin Köhler aus ihrem Roman «Schöner als überall», der bei Suhrkamp erschien und Simone Lappert aus ihrem Bestseller «Der Sprung»! Unbedingt hingehen! (Festivalprogramm)
![]() Illustrationen © leafrei.com
Illustrationen © leafrei.com












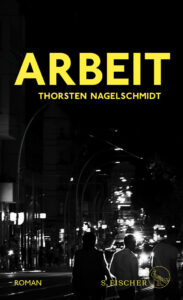


 Joe Haak ist Analyst einer Londoner Bank, die sich darauf spezialisierte, dann die grossen Gewinne zu verzeichnen, wenn alle andern in Panik ihre Aktien abstossen. Zusammen mit einem Team entwickelt er «Cassie», ein Programm, das mit Hilfe von Algorhithmen aus dem Meer von Netzinformationen Vorhersagen generiert, die die Bank stets einen Schritt voraus reagieren lassen. Ein Programm, das riesige Gewinne erzielen soll. Aber als dem jungen Mathematiker bewusst wird, welche Auswirkungen ein solcher Rechner haben kann und erste Ergebnisse ihn das Fürchten lehren, kappt er das Wenige, was ihn in jener Welt hält, fährt los bis zu dem kleinen Fischerdorf, an dem die Strasse am Meer endet.
Joe Haak ist Analyst einer Londoner Bank, die sich darauf spezialisierte, dann die grossen Gewinne zu verzeichnen, wenn alle andern in Panik ihre Aktien abstossen. Zusammen mit einem Team entwickelt er «Cassie», ein Programm, das mit Hilfe von Algorhithmen aus dem Meer von Netzinformationen Vorhersagen generiert, die die Bank stets einen Schritt voraus reagieren lassen. Ein Programm, das riesige Gewinne erzielen soll. Aber als dem jungen Mathematiker bewusst wird, welche Auswirkungen ein solcher Rechner haben kann und erste Ergebnisse ihn das Fürchten lehren, kappt er das Wenige, was ihn in jener Welt hält, fährt los bis zu dem kleinen Fischerdorf, an dem die Strasse am Meer endet.


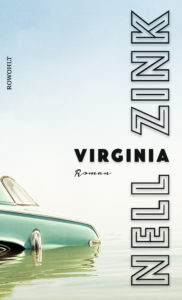 In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.
In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.
 zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,
zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,  verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.
verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.
 mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!
mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!
 Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.
Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.

 grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.
grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.
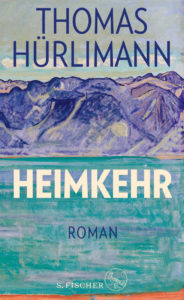 Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!
Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!