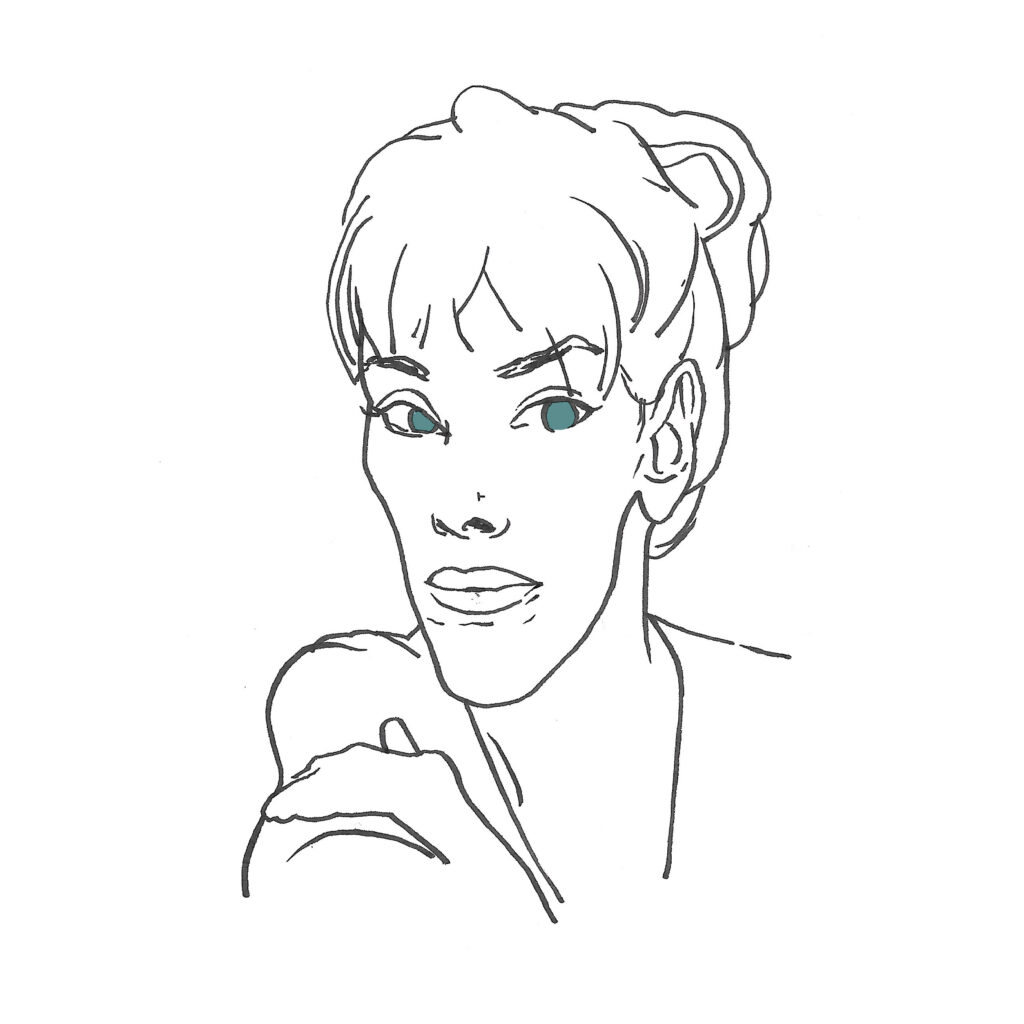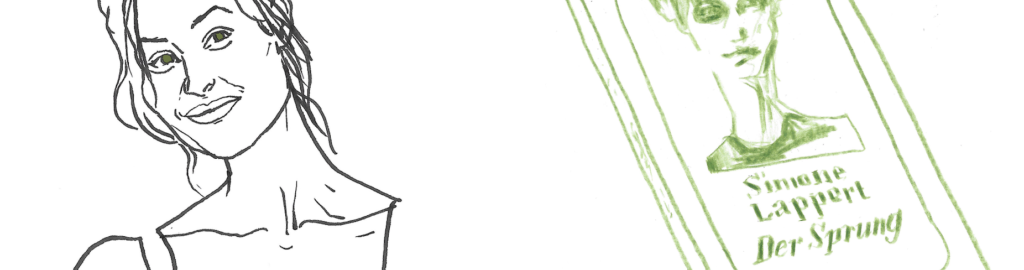Es gibt Dichter*innen und solche, die Gedichte schreiben. Christine Lavant war Dichterin, durch und durch. Hätte man ihr das Dichten genommen, wäre sie noch viel früher aus einer Welt entschwunden, in der es keinen Platz für sie zu geben schien, nie, nicht einmal nachdem man ihr den Österreichischen Staatspreis für Literatur verliehen hatte.

Dass Christine Lavant nicht vergessen ist, verdanken wir Verlagen, die sich durch Gedichte nicht abschrecken lassen, Freundschaften der Dichterin weit über ihren Tod 1973 hinaus und der Wirkung, die Texte und Person bis heute ausstrahlen. Sehnsuchtsgedichte, Liebesgedichte, schwärmerisch, aber nie entrückt, verklärt durch einen Blick, der weit mehr als die Oberfläche erfasst, Gedichte in vollendeter Rhythmik, als wären sie stille Lieder. Gedichte, die, wenn man sie laut liest, zu Musik werden. Gedichte, die ihrem Schmerz eine Stimme, eine Spur geben. Gedichte, die in Verbindung mit Fotos ihrer Person, Bildern und Holzschnitten des Künstlers Werner Berg in ein ganz eigenes Licht getaucht werden.
Ich lernte die Dichterin in einer kleinen Buchhandlung in Südkärnten, in Völkermarkt, kennen, der Buchhandlung und Galerie Magnet. Dort gibt es ein Regal mit Kärntner Dichter*innen; u. a. Peter Handke, Maja Haderlap, Florjan Lipuš. Wäre in einer Buchhandlung in meiner Wohngegend etwas von «Dichter*innen aus dem Thurgau» auf einem Regal zu finden? Es war „Die Schöne im Mohnkleid“, eine Erzählung über ihre eigene Herkunft und Geschichte, über Armut und Entbehrung. Eine Erzählung, die mich damals nicht zum ersten Mal nach Bleiburg nahe der slowenischen Grenze führte. Dort, in einem Museum zum Werk des Künstlers Werner Berg, fielen mir schon zuvor die Bilder einer ausgezehrten Frau mit grossen Augen und Kopftuch auf. Werner Berg malte sie immer und immer wieder. Zwischen den beiden musste etwas gewesen sein, dass viel mehr war als Maler und Modell.

Sie beide, die Dichterin Christine Lavant und der Maler Werner Berg waren Künstler, die sich fern ab der Szene ihrer Arbeit verschrieben hatten. Beide mit einem ganz eigenen Blick auf die Welt. In Gedichten, Texten und Briefen wird deutlich, dass zwischen den beiden mehr war als Freundschaft. Eine Form des Verstandenseins, die sie nur in dieser einen Beziehung fanden. Eine Liebe, die nicht sein durfte, weil beide verheiratet waren, Christine Lavant mit dem glück- und erfolglosen Landschaftsmaler Josef Habernig, 36 Jahre älter als sie. Eine Heirat wohl auch aus einer Not heraus, denn kurz vor jener Heirat musste sie nach dem Tod ihrer Eltern die gemeinsame Wohnung verlassen.
Christine Lavants Kindheit war eine schwierige. Als Jüngste einer armen Familie, oftmals krank, immer wieder mit Lungenentzündungen knapp am Tod vorbeischrammend, verdiente die Dichterin ihren kleinen Beitrag zum Lebensunterhalt mit Handarbeiten. Erst in den letzten Jahren ihres entbehrungsreichen Lebens kam Christine Lavant durch Preise und Ehrungen zu etwas Geld, mit dem sie aber nicht sich selbst, sondern ihre Familie unterstützte. Sie selbst war sich nie die nächste, auch in ihrer Dichtung.
Immer wieder liegen Bücher der Dichterin auf meinem Nachttisch. Nicht nur weil ich einen persönlichen Bezug zur Herkunft der Schriftstellerin habe, sondern weil ihr Schreiben in ihrer Sprache zeitlos und von grösster Musikalität ist, weil Lavants Sprache sowohl in Lyrik wie in Prosa kompromisslos, leidenschaftlich und ehrlich ist. Dass ihre Dichtung auch mit religiösen Bildern durchsetzt ist, befremdet höchstens dann, wenn man keine Ahnung von der Herkunft der Dichterin hat, sowohl geographisch wie gesellschaftlich.
Aber warum beschäftigt sich die hochdekorierte Schriftstellerin Jenny Erpenbeck mit der grossen Unbekannten Christine Lavant? Ist es die Faszination einer Künstlerin, die es im Gegensatz zu Jenny Erpenbeck nie schaffte, sich im
Literaturbetrieb zu etablieren? Weil Christine Lavant dichtete, weil es ihre einzige Möglichkeit war, nicht zu verkümmern? Weil da jemand trotz aller Widrigkeiten in ihre Schreibmaschine hämmerte, mit der permanenten Angst, das Klappern könnte stören? Weil Christine Lavants Dichtkunst funkelt wie ein dunkler Kristall! Weil die Dichterin beweist, was Sprachleidenschaft entstehen lassen kann! Weil Jenny Erpenbeck mit aller möglichen Ernsthaftigkeit einer Dichterin begegnet, die damals in Kontakt mit den ganz Grossen war und doch nie einen Platz an der Sonne bekam.
Christine Lavant ist immer ein Geschenk, eine Offenbarung und ihr Leben ein Denkmal dafür, was Entschlossenheit bedeuten kann.
Lesen und geniessen!
Christine Lavant (1915-1973), geb. als Christine Thonhauser in St. Stefan im Lavanttal (Kärnten) als neuntes Kind eines Bergmanns, war Lyrikerin und Erzählerin. Ihre Schulbildung musste sie aus gesundheitlichen Gründen früh abbrechen. Jahrzehntelang bestritt sie den Familienunterhalt als Strickerin. Sie erhielt u. a. den Georg-Trakl-Preis (1954 und 1964) und den Großen Österreichischen Staatspreis (1970). Seit 2014 erscheint eine Werkausgabe von Christine Lavant im Wallstein Verlag.

Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Ost-Berlin, ist die Autorin zahlreicher Romane, Erzählungen und Essays. Ihre Werke sind in 30 Sprachen übersetzt und wurden im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Independent Foreign Fiction Prize, dem Thomas-Mann-Preis, dem Premio Strega Europeo und dem Internationalen Stefan-Heym-Preis. Zuletzt erschienenen die Romane »Gehen, ging, gegangen«, »Kairos« und ihr Buch über Christina Lavant. 2024 gewann sie als erste deutsche Autorin den International Booker Prize.
Webseite über Christine Lavant
Beitragsbild © Ernst Peter Prokop (Christine Lavant, 1963 in ihrer Wohnung in St. Stefan im Lavanttal)








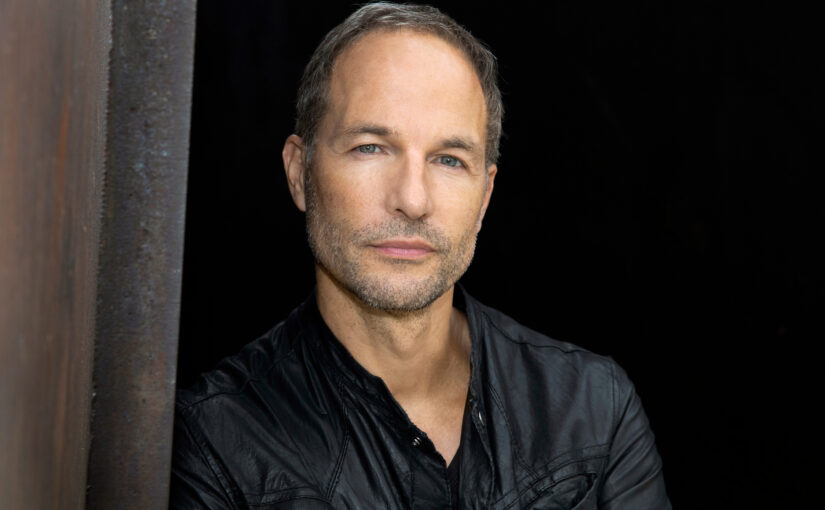




 Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.
Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.  Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur!
Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur! Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen.
Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen. Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»
Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

 Höhepunkte versäumt hatte. Nachdem ich andere Festivalbesucher:innen immer wieder nach ihrem absoluten Highlight fragte, wurde immer wieder der eine Name genannt: Jakub Małecki! Der 1982 in Polen geborene Schriftsteller ist in seinem Heimatland ein gefeierter Autor, veröffentlichte fast ein Dutzend Romane. «Rost», sein erster auf Deutsch erschienener Roman ist die Geschichte des siebenjährigen Szymek, dessen Eltern bei einem Autounfall sterben, den man zu seiner Grossmutter Tosia bringt, raus in die Provinz, in ein Leben, dass so ganz anders tickt als das alte. Jakub Małecki erzählt aber auch die Geschichte der Grossmutter, die Auswirkungen jener Brüche, die der Krieg hinterliess, was mit den Menschen im kleinen Ort Cholny passierte. Dass «Rost» nun im Buchhandel liegt, sei einem reinen Zufall zu verdanken. Der Verleger sah den auf Polnisch ebenfalls „Rost“ betitelten Roman aufliegen, nahm ihn zur Hand und liess danach nicht mehr los. Jakub Małecki hat mit «Rost» ein im Licht der dörflichen Besonderheit erstrahlendes Lebenspanorama erschaffen, das aus Cholny heraus tief in unsere Welt zu leuchten vermag.
Höhepunkte versäumt hatte. Nachdem ich andere Festivalbesucher:innen immer wieder nach ihrem absoluten Highlight fragte, wurde immer wieder der eine Name genannt: Jakub Małecki! Der 1982 in Polen geborene Schriftsteller ist in seinem Heimatland ein gefeierter Autor, veröffentlichte fast ein Dutzend Romane. «Rost», sein erster auf Deutsch erschienener Roman ist die Geschichte des siebenjährigen Szymek, dessen Eltern bei einem Autounfall sterben, den man zu seiner Grossmutter Tosia bringt, raus in die Provinz, in ein Leben, dass so ganz anders tickt als das alte. Jakub Małecki erzählt aber auch die Geschichte der Grossmutter, die Auswirkungen jener Brüche, die der Krieg hinterliess, was mit den Menschen im kleinen Ort Cholny passierte. Dass «Rost» nun im Buchhandel liegt, sei einem reinen Zufall zu verdanken. Der Verleger sah den auf Polnisch ebenfalls „Rost“ betitelten Roman aufliegen, nahm ihn zur Hand und liess danach nicht mehr los. Jakub Małecki hat mit «Rost» ein im Licht der dörflichen Besonderheit erstrahlendes Lebenspanorama erschaffen, das aus Cholny heraus tief in unsere Welt zu leuchten vermag.
 Der Roman «Dunkelblum», der im kommenden August erscheinen wird, leuchtet in einen fiktiven Ort, eine Kleinstadt an der österreichisch-ungarischen Grenze. Während man 1989 Zeuge wird einer Massenflucht aus der sich auflösenden DDR, taucht ein rätselhafter Besucher im Städtchen auf, findet man ein Skelett in einer Wiese am Stadtrand und verschwindet eine junge Frau. Alles an dem Ort beginnt sich zu verschieben. Mit einem Mal tritt hervor, was man über Jahrzehnte totzuschweigen versuchte; all die Massaker, die in den Wirren des letzten Krieges geschahen. «Dunkelblum» ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen. Eva Menasses Sprache ist gestochen scharf, ihr Erzählen gekonnt konstruiert und alles durchsetzt mit einer bissigen Prise Humor.
Der Roman «Dunkelblum», der im kommenden August erscheinen wird, leuchtet in einen fiktiven Ort, eine Kleinstadt an der österreichisch-ungarischen Grenze. Während man 1989 Zeuge wird einer Massenflucht aus der sich auflösenden DDR, taucht ein rätselhafter Besucher im Städtchen auf, findet man ein Skelett in einer Wiese am Stadtrand und verschwindet eine junge Frau. Alles an dem Ort beginnt sich zu verschieben. Mit einem Mal tritt hervor, was man über Jahrzehnte totzuschweigen versuchte; all die Massaker, die in den Wirren des letzten Krieges geschahen. «Dunkelblum» ist ein schaurig-komisches Epos über die Wunden in der Landschaft und den Seelen der Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht vergehen. Eva Menasses Sprache ist gestochen scharf, ihr Erzählen gekonnt konstruiert und alles durchsetzt mit einer bissigen Prise Humor.
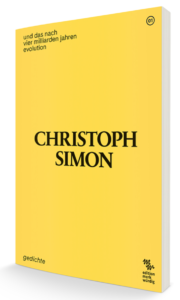 Festivaltag wollte ich mich vor der Bergfahrt nur ganz kurz auf meinem Bett im Hotel niederlegen, nur einen Augenblick. Als ich irgendwann in meinen Kleidern aufwachte, pfiffen bereits die Vögel. Glücklicherweise las Christoph Simon aber auch noch am Samstag. Neben literarischen Kostbarkeiten aus verschiedenen Büchern auch aus seinem neuen mit dem sinnigen Titel «und das nach vier milliarden jahren evolution», dem bislang einzigen Buch aus der edition merkwürdig. Wer bewiesen haben will, dass Lyrik alles andere als kopflastig, verschroben oder verunsichernd sein muss, lese in den Gedichten Christoph Simons. Da geht des Herz gleich mehrfach auf! Simons Gedichte sind als lyrische Stories angelegt. Sie haben alle einen Inhalt, der sich sogar nacherzählen lässt. Aber das lyrisch Unsagbare lauert zwischen den Zeilen und in jenen Zeilenabbrüchen, die immer dann auftauchen, wenn man glaubt, etwas linear kapiert zu haben
Festivaltag wollte ich mich vor der Bergfahrt nur ganz kurz auf meinem Bett im Hotel niederlegen, nur einen Augenblick. Als ich irgendwann in meinen Kleidern aufwachte, pfiffen bereits die Vögel. Glücklicherweise las Christoph Simon aber auch noch am Samstag. Neben literarischen Kostbarkeiten aus verschiedenen Büchern auch aus seinem neuen mit dem sinnigen Titel «und das nach vier milliarden jahren evolution», dem bislang einzigen Buch aus der edition merkwürdig. Wer bewiesen haben will, dass Lyrik alles andere als kopflastig, verschroben oder verunsichernd sein muss, lese in den Gedichten Christoph Simons. Da geht des Herz gleich mehrfach auf! Simons Gedichte sind als lyrische Stories angelegt. Sie haben alle einen Inhalt, der sich sogar nacherzählen lässt. Aber das lyrisch Unsagbare lauert zwischen den Zeilen und in jenen Zeilenabbrüchen, die immer dann auftauchen, wenn man glaubt, etwas linear kapiert zu haben
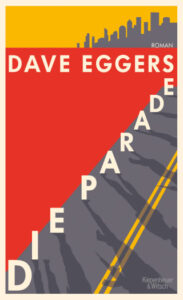


 «GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.
«GRM Brainfuck» ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie leben in der schlimmsten, heruntergekommensten Stadt Grossbritanniens. Dort, wo niemand hin will, wo man am Ende hingespült wird. Sie leben in Zeiten der Superlativen; die Meere steigen, das Eis schmilzt, die Tiere sterben aus, alles in Rekordzeit. Sie schwören sich ewige Freundschaft, bezeugen sie mit Blut, erstellen eine Liste mit den Namen, an denen sie sich zu rächen gedenken.
 Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!
Warum „GRM“ lesen? Weil „GRM“ mächtig ist, ein literarischer Titan. Weil „GRM“ Fragen stellt, komplexe Fragen, an deren Antworten man scheitern kann. Weil die Lektüre ein Gang durch ein Minenfeld ist, man dem Grauen ins Gesicht schaut und man sich fragt, wie eine Autorin einen solchen Titan mit sich herumschleppen konnte. „GRM“ ist mutig und grenzenlos. Wer sich nicht einfach nur einlullen lassen will durch brave Geschichten, wer riskieren will, mit der Lektüre des Buches Akzeptiertes zu hinterfragen, lese dieses Buch!