„Krähen im Park“ sticht mitten in die Zeit. Christoph Peters verwebt ein Geschehen vieler ProtagonistInnen an einem einzigen Tag, Lebensläufe, die sich manchmal streifen oder auch nur in der gleichen Stadt, ab diesem 9. November 2021 in Berlin, abspielen, meisterhaft gespiegelt in den verschiedensten Perspektiven, die Oberflächlichkeiten einer Gesellschaft am Wendepunkt entlarvend.
Zu Besuch in der Stadt meines Freundes stand ich nachts manchmal am Fenster seiner Wohnung oder auf dem kleinen Balkon, auf dem nur ein Stuhl Platz hatte. Bei Dunkelheit sah man in all die Wohn- und Schlafzimmer auf der Gegenseite, die die Sicht nicht mit Gardinen versperrten. Ich sah für eine Weile in die Leben all der mir Unbekannten, ein ins Licht gesetztes Szenario vieler gleichzeitiger Leben, die nichts miteinander zu tun hatten. Damals nahm mich mein Freund weg vom Fenster, weil er Kommentare fürchtete.
Ganz anders Christoph Peters mit „Krähen im Park“. Er nimmt mich mitten hinein in die Leben vieler, erzählt vom erfolglosen Schriftsteller Urban, dem es seit Jahren nicht gelingt, wieder zurück in jene Spur zu kommen, die mit zwei Romanen so vielversprechend begonnen hatte. Von einer Frau Irma, einer ehemals erfolgreichen Schauspielerin, nun Influencerin, die alles versucht, nun wenigstens ihre Tochter Leonie gewinnbringend zu vermarkten. Von Joyce, einer Fluggastkontrolleurin, enttäuscht von den Männern, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von ihrer Tochter Dina, die sich unverständlicherweise an einen Türken gehängt hat. Von Dina selbst, mit achtzehn nach dem Abitur von Emre schwanger geworden, eigentlich glücklich und doch ganz verunsichert, wie sie an diesem Tag zum Arzt geht, um sich ihrer Schwangerschaft sicher zu sein und aus ihrem Glück gerissen wird. Von Emre, dem türkischen Paketboxer, der eigentlich Dina zum Arzt hätte begleiten sollen, dem aber die Tekwando-Prüfung wichtiger ist, sich gleichzeitig aber in seinen schlechten Gefühlen windet. Von Ali Zayed, einem afghanischen Flüchtling, erst seit ein paar Stunden von Belarus kommend in der ihm vollkommen fremden Stadt, auf der Suche nach seinem Cousin…

Was wie ein Wimmelbild erscheinen mag, ist ein sorgfältig konstruierter Teppich aus unterschiedlichsten Biographien, ganz und gar nicht wirr zu lesen, so glasklar arrangiert und inszeniert, dass ich staune, wie gut es dem Autor gelingt, die verschiedenen Charaktere auch aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Wie scheinbar Objektives aus der Sicht eines andern meinen permanenten Versuch einzuordnen unterbricht. Wie tief man in sich selbst versenkt ist und es nicht schafft, den eigenen Tunnel zu verlassen.
Zusammengehalten werden all die Leben durch den Besuch des französischen Starschriftstellers Bernard Entremont, der aus Paris angereist ist, um einen mit 30 000 Euro dotierten Literaturpreis entgegenzunehmen. Eine Veranstaltung in den Coronabeschränkungen, vielleicht die letzte ihrer Art, mit einem Schriftsteller, den man hasst oder vergöttert, der sich gelangweilt zeigt und sich über sich selber wundert, dass er nicht einfach via Leinwand ein kurzes Lächeln hätte zeigen können. Entremont (unschwer als Michel Houellebecq zu erkennen) in seinem nachlässigen Parka, dauernd rauchend, auch wenn sich sonst alle an Verbote halten, immer nach einem attraktiven Gegenüber suchend.
Die Kulturschickeria ist in heller Aufregung. Während sich die einen um jeden Preis ihre ganz persönliche Scheibe von dem Literaturspektakel abschneiden wollen, sich der geehrte Bernard Entremont sich in seiner Langeweile suhlt, geht es im gleichen Moment nicht unweit vom diesem Geschehen ums unmittelbare Überleben, knallen kleine und grosse Katastrophen.
Corona hat unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Auch wenn sich die Wellen scheinbar geglättet haben, wissen wir alle, wie dünn das Eis, wie filigran die Normalität, wie flüchtig das Glück ist. Christoph Peters Roman ist eine Gesellschaftsstudie ohne Analyse. Und doch wird klar, wie sehr wir uns in einer künstlichen Blase bewegen, die einen innerhalb, die andern auf immer ausgeschlossen. Auch wenn es Christoph Peters vermeidet zu moralisieren, schmerzt die unmittelbare Nähe all der wirklichen und eingebildeten Katastrophen. Christoph Peters verblüfft und überrascht. Sein Roman ist ein oppulentes Sittengemälde einer Zeit, die sich mit aller Macht über Wasser hält.
Interview
Es geht ihnen nicht um ihre eigenen Befindlichkeiten, aber sehr wohl um die Befindlichkeit der Welt. Ich spüre ihre Betroffenheit. Aber es ist eine in den beschriebenen Personen gespiegelte Befindlichkeit. Nicht zuletzt auch jene der Ausweglosigkeit.
Es gab in den schwierigen Zeiten der Pandemie und mit den grossen Friedens- und Klimademonstrationen kurz davor auch die kleine Hoffnung, es würde sich etwas ändern. Ist ihr Roman auch ein Bild dessen, wie wir weiter feiern auf dem lecken Dampfer?
Soweit ich mich selbst erinnere und wenn ich dann noch die Erzählungen meiner Eltern und Grosseltern dazunehme – zwei Weltkriege, Weltwirftschaftskrise, der Verlust von allem, was sie besessen haben, im Bombenhagel -, war der Dampfer eigentlich immer leck. Die Menschen haben trotzdem gefeiert. Neulich habe ich eine Dokumentation über die 1950er Jahre gesehen: Da wurden überall Atombunker gebaut und ABC-Waffen-Trainings durchgeführt, gleichzeitig kam der Rock ’n’Roll auf – der bis dahin vermutlich wildeste Tanz der Neuzeit. Während der 1980er, als ich selbst erwachsen wurde, standen neben der weiterhin dramatischen Atomkriegsdrohung Waldsterben, Ozonloch, tote Flüsse im Fokus der Weltuntergangsszenarien. Auch wir haben damals in der permanenten Angst gelebt, die „letzte Generation“ zu sein, sind zu politischen Aktionsgruppen und Demonstrationen gegangen, aber am Wochenende eben auch in die Grossraumdisco. Da, wo im Roman gefeiert wird – bei der Preisverleihung zu Ehren des französischen Starliteraten Bernard Entremont in der Akademie der Künste und auf der halboffiziellen After-Show-Party im Haus der Schauspielerin und Salonniere, Mariann Krüger –, ist es eher der Versuch, trotz der heiklen Lage, die Rituale bougeoisen Kulturlebens aufrecht zu erhalten, beziehungsweise vorsichtig wieder aufzunehmen. Das klappt natürlich nur teilweise. Einige der Figuren interessieren sich ohnehin nur am Rande für die globale Lage, sondern sind hauptsächlich mit ihren eigenen, persönlichen Problemen beschäftigt, wie das ja auch im wirklichen Leben nicht selten der Fall ist.
Was mich an ihrem Roman auch fasziniert, sind die verschiedenen Perspektiven. Während sie stets sehr nahe an ihrem Pesonal schreiben, die Welt aus ihrer Sicht schildern, relativiert sich diese Ansicht bei einem Szenenwechsel, wenn das Licht auf eine andere Bühne gerichtet wird. Alles ist sowohl als auch, selbst bei der Person des afghanischen Flüchlings Ali Zayed, dessen Geschichte bewusst macht, dass es gleich neben Luxus, Hochglanz und kalt gestelltem Sekt um Leben und Tod geht. Es scheint ihnen um viel mehr zu gehen, als nur eine Geschichte zu erzählen.

Ich habe versucht, eine Art Momentaufnahme der Gesellschaft im Brennpunkt und Schmelztiegel Berlin zu Beginn des 2. Corona-Winters zu zeichnen. Es gibt viele, etwa gleich wichtige Figuren aus sehr verschiedenen Milieus – Kulturschickeria, Gross- und Kleinbürgertum, Migranten, junge und alte Paare unterschiedlicher Orientierung, einige, die im Westen, andere die im Osten sozialisiert sind. Einerseits leben sie alle in ihren eigenen Welten, andererseits greifen diese Welten dann doch stärker ineinander, als man auf den ersten Blick vermuten würde, teils zufällig, teils – wenn man so will – fast schicksalhaft. Das Private wird politsch und der Politiker wird von seinen privaten Konflikten eingeholt. Für andere, wie den afghanischen Flüchtling Ali Zayed oder den Paketfahrer Emre, spielt das alles kaum eine Rolle. Der eine versucht, sich irgendwie in der Fremde zu orientieren, der andere hat eine junge Freundin, Dina, die schwanger ist, und träumt vom künftigen Familienglück. Fast alle sind auf der Suche nach etwas, das dem eigenen Leben eine Wendung zum entschieden Besseren geben könnte, wobei jeder andere Vorstellungen hat, was es sein könnte. In gewisser Weise ist der Roman auch der Versuch, aus den sogenannten „Blasen“, in denen wir uns mehr und mehr abgekapselt haben, herauszukommen und einen etwas grösseren Ausschnitt aus den vielen, extrem heterogenen Lebenswelten zu zeigen, aus denen unsere nach-postmodernen Grossstädte bestehen.
Ausgerechnet der Sohn von Professor Bernburger, der Gesundheitspolitiker mit Ambitionen ist und Verfechter einer rigorosen Impfpflicht, entpuppt sich als Coronakritiker und Anhänger kruder Verschwörungstheorien. Eine Szenerie, die wir sehr gut kennen; Familien, in denen der Coronatsunami tektonische Verschiebungen verursacht hat. Trotzdem ist ihr Roman kein Coronaroman. Und doch ist der Vius da. Ein schreibender Freund meinte einmal, es wäre unmöglich, einen vernünftigen Coronaroman zu schreiben. Mussten sie sich um eine richtige Dosierung bemühnen?
Als ich wusste, dass ich diesen Roman schreiben würde und dass er am 9. November 2021 spielen sollte, sah es noch ganz so aus, als wäre Corona bis dahin kein grosses Thema mehr. Ursprünglich wollte ich erzählen, wie das Leben nach der Krise allmählich wieder zur vor-pandemischen Normalität zurückkehrt. Als sich dann abzeichnete, dass das Virus doch hartnäckiger sein würde als erhofft, habe ich entschieden, diese zeitgeschichtlichen Rahmenbedingungen einfach als gegeben hinzunehmen – ein bisschen wie eine schwierige Wetterlage. Corona und die Art, wie die Figuren im Roman darauf reagieren, spielt also eine Rolle, ist aber nicht der alles determinierende Faktor. Zu diesem Zeitpunkt dauerte die Pandemie ja auch schon gut anderthalb Jahre und man hatte sich allmählich daran gewöhnt. Da ich diese vielen verschiedenen Protagonisten hatte, konnte ich von sehr unterschiedlichen Arten erzählen, wie die Leute mit dem Virus umgehen: Von der panischen Sorge, über gelassene Bereitschaft, sich den Regeln entsprechend zu verhalten, bis hin zu verschwörungsgläubigem Verfolgungswahn. Nicht wenige der Figuren haben aber bereits wieder oder von vorneherein ein achselzuckendes Desinteresse dem ganzen Themenkomplex gegenüber. Dadurch musste ich nicht ständig aufpassen, dass das Virus den Text vollständig unter seine Kontrolle brachte.
Nicht zuletzt ist ihr Roman auch eine Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb. Auf der einen Seite der erfolgsverwöhnte Misanthrop und Lebemann Bernard Entremont, um den eine bunte Schar Kulturbeflissener Bücklinge macht, auf der anderen Seite Urban Fischer, ein fast vergessener Schriftsteller, dessen Selbstverständnis mehr als angekratzt ist. Auf der einen Seite ein aufgeblasener Hype um einen grossen Namen, der Aufmerksamkeit generiert, auf der anderen Seite die pure Selbstzerfleischung. Beide haben die Bodenhaftung verloren. Aber ist nicht Bodenhaftung eine Unabdingbarkeit für gute Literatur?
„Bodenhaftung“ finde ich einen eher schwierigen Begriff im Zusammenhang mit Literatur. Er suggeriert, dass Literatur eine realistische, gesellschaftspolitisch reflektierte, auf genauer Beobachtung der Verhältnisse durch einen souveränen Autor basierende Perspektive haben sollte. Diese Art des „relevanten Realismus“ ist aber nur eine von sehr vielen Möglichkeiten interessante Texte zu schreiben. Grundsätzlich kann der Blick eines Autors natürlich hauptsächlich nach Aussen gehen, sich also der möglichst genauen Wahrnehmung der menschlichen Verhältnisse um ihn herum in seiner Zeit zuwenden. Andererseits bietet aber auch die radikale Selbstbeobachtung bis hin zur völligen Isolation von Autor, Erzähler und/oder Protagonisten Möglichkeiten, Dinge aus innerseelischen Dunkelkammern und psychischen Grenzbereichen ans Licht zu bringen und gerade dadurch neue Perspektiven auf die menschliche Existenz zu öffnen. Das Imaginieren, Phantasieren, der Entwurf völlig anderer Welten und Wirklichkeiten ist eine weitere Möglichkeit, so alt wie die Literatur selbst und ebenso berechtig wie wichtig, um Alternativen zu den gegebenen Verhältnissen ins Auge zu fassen oder Fluchtrouten aufzuzeigen. Daneben kann sich der Fokus auf die Sprache selbst, ihre Strukturen, Grenzen und Entgrenzungen richten und gerade dadurch neue Zugänge zur inneren und äusseren Welt ermöglichen, die verschlossen bleiben, solange der Autor am „Boden haftet“.

Es gibt eine Szene in ihrem Roman, in der der Afghane Ali Zayed in einem der vielen Berliner Parks sitzt und Krähen beobachtet. Afghanische und deutsche Krähen scheinen sich genauso zu unterscheiden wie afghanische und deutsche Menschen. Aber zumindest können deutsche Krähen mit den Abfällen aus Mülleimern in Parks ganz gut leben. In vielem tönen sie nur an. Auch die Geschichte von Ali Zayed ist „nicht zu Ende erzählt“. Das Personal ihrer Romane kommt immer wieder mal vor, wenn auch mit anderem Gewicht. Was entscheidet, ob eine Figur wie Ali Zayed wieder auftauchen wird?
Die Unterschiede zwischen afghanischen und berliner Nebelkrähen sind ornithologisch nicht hundertprozentig abgesichert: Ich habe in Pakistan immer wieder grosse Schwärme dieser Art gesehen und bin einfach mal davon ausgegangen, dass in Afghanistan eher der pakistanische Typ verbreitet ist: etwas kleiner, schlanker, insgesamt eleganter im Erscheinungsbild und das Grau ein bisschen blaustichig – was gut zu den „crows which are blue“ des Edith-Stein-Mottos zu Beginn des Romans passt. Ob sich die Charakteristika der Krähen auf die Menschen übertragen lassen, sei mal dahingestellt. – Tatsächlich wandern gelegentlich Figuren von Text zu Text weiter oder tauchen nach Jahren, manchmal Jahrzehnten plötzlich wieder auf. Wie genau es dazu kommt, weiss ich nicht. Irgendwie haben alle diese Gestalten eine Art Eigenleben in meinem Kopf oder sonstwo, und dort gehen sie, auch wenn ich sie gerade nicht erzählend im Blick habe, ihren jeweiligen Beschäftigungen nach. Manche widersetzen sich gezielt den Lebensplänen, die ich für sie gedacht hatte. So ist der Yakuza Fumio Onishi ursprünglich nur Protagonist einer Kurzgeschichte, „Maneki neko“, gewesen, die im Berliner Hauptzollamt spielte und eigentlich mit seinem Tod enden sollte. Dazu kam es dann aber nicht, so dass Fumio zur Hauptfigur in „Der Arm des Kraken“ wurde, wieder mit der Aussicht, am Ende getötet zu werden. Doch er hat auch den Roman überlebt und sich nach Tokio bzw. in „Das Jahr der Katze“ geflüchtet. Aktuell agiert er vermutlich in der Unterwelt von Los Angeles. Ich würde ihm eigentlich sehr gern dabei zuschauen, aber bislang hat er mir seinen genauen Aufenthaltsort nicht verraten. Ob Ali Zayed sich noch einmal melden wird, kann ich momentan nicht sagen – ausgeschlossen ist es nicht.

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände und wurde für seine Bücher vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018), dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021) sowie dem Niederrheinischen Literaturpreis (1999 und 2022). Christoph Peters lebt heute in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand «Tage in Tokio» (2021) und «Der Sandkasten» (2022).
Beitragsbild © Peter von Felbert






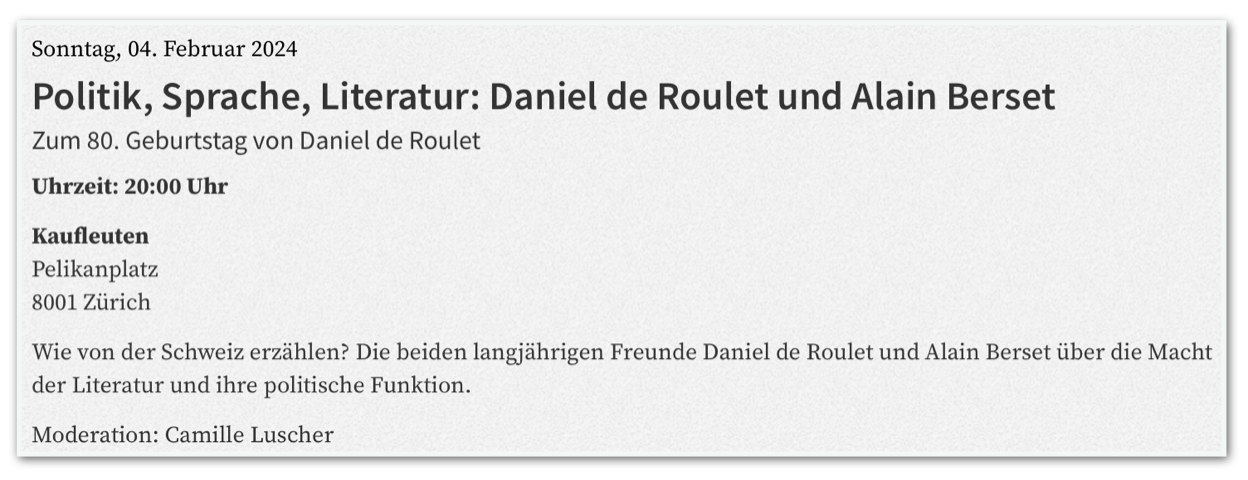
 Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.
Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.









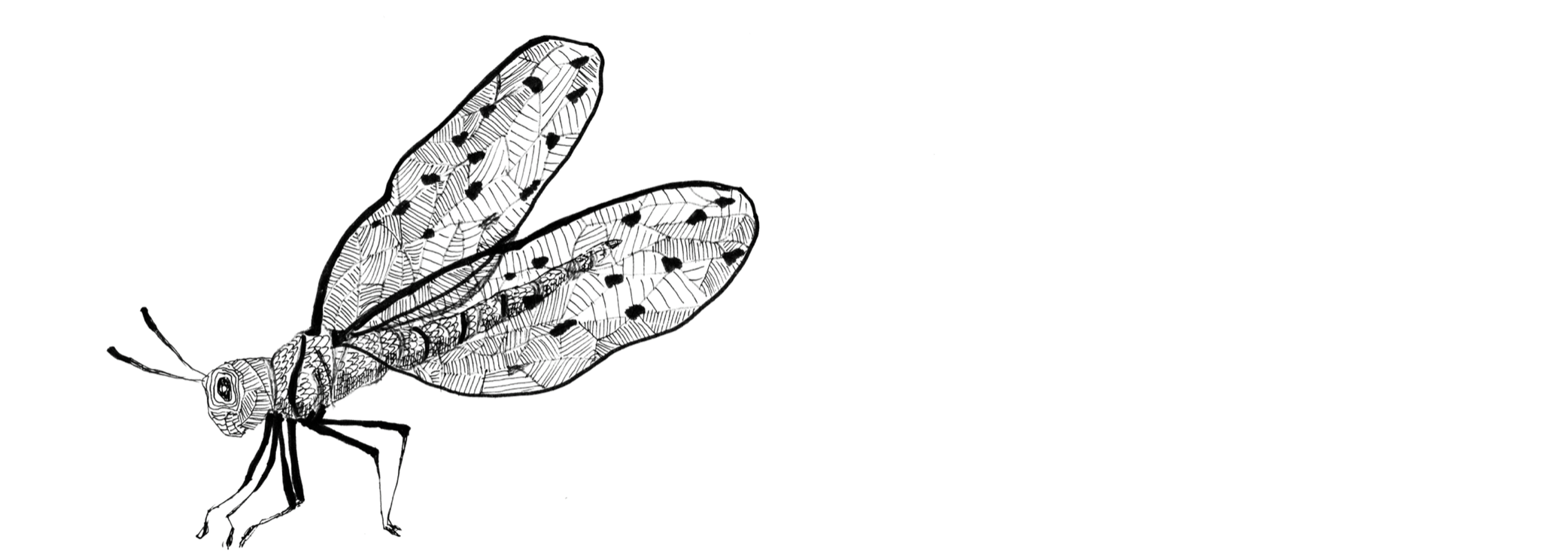

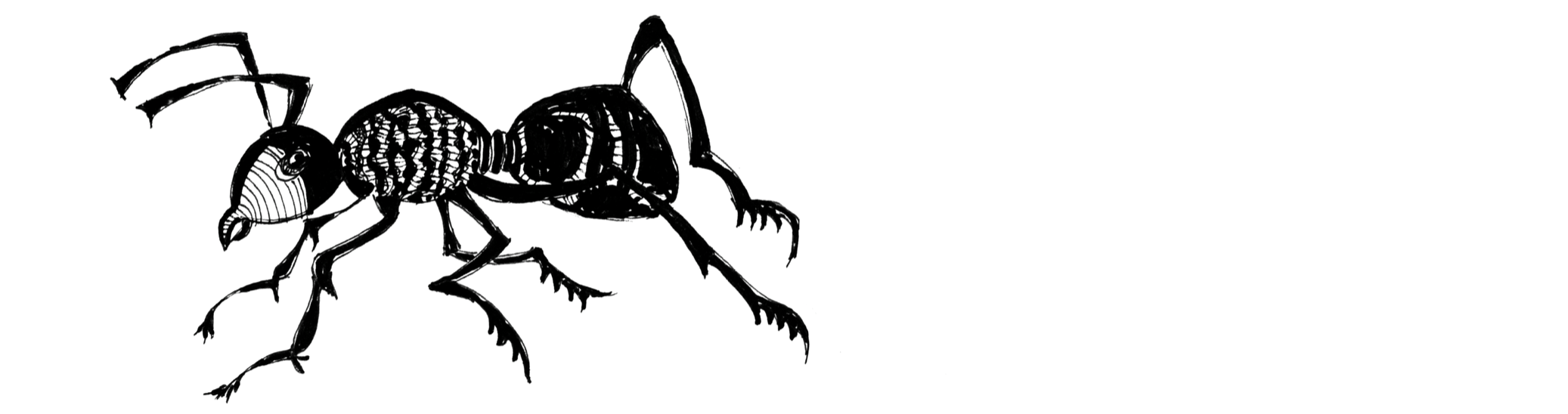

 Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «
Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «





 Demian Lienhard, geboren 1987 in Bern. Studium der Klassischen Archäologie, der Latinistik und der Hispanistik in Zürich, Köln und Rom.
Demian Lienhard, geboren 1987 in Bern. Studium der Klassischen Archäologie, der Latinistik und der Hispanistik in Zürich, Köln und Rom. 
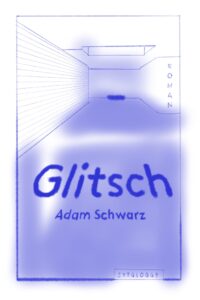
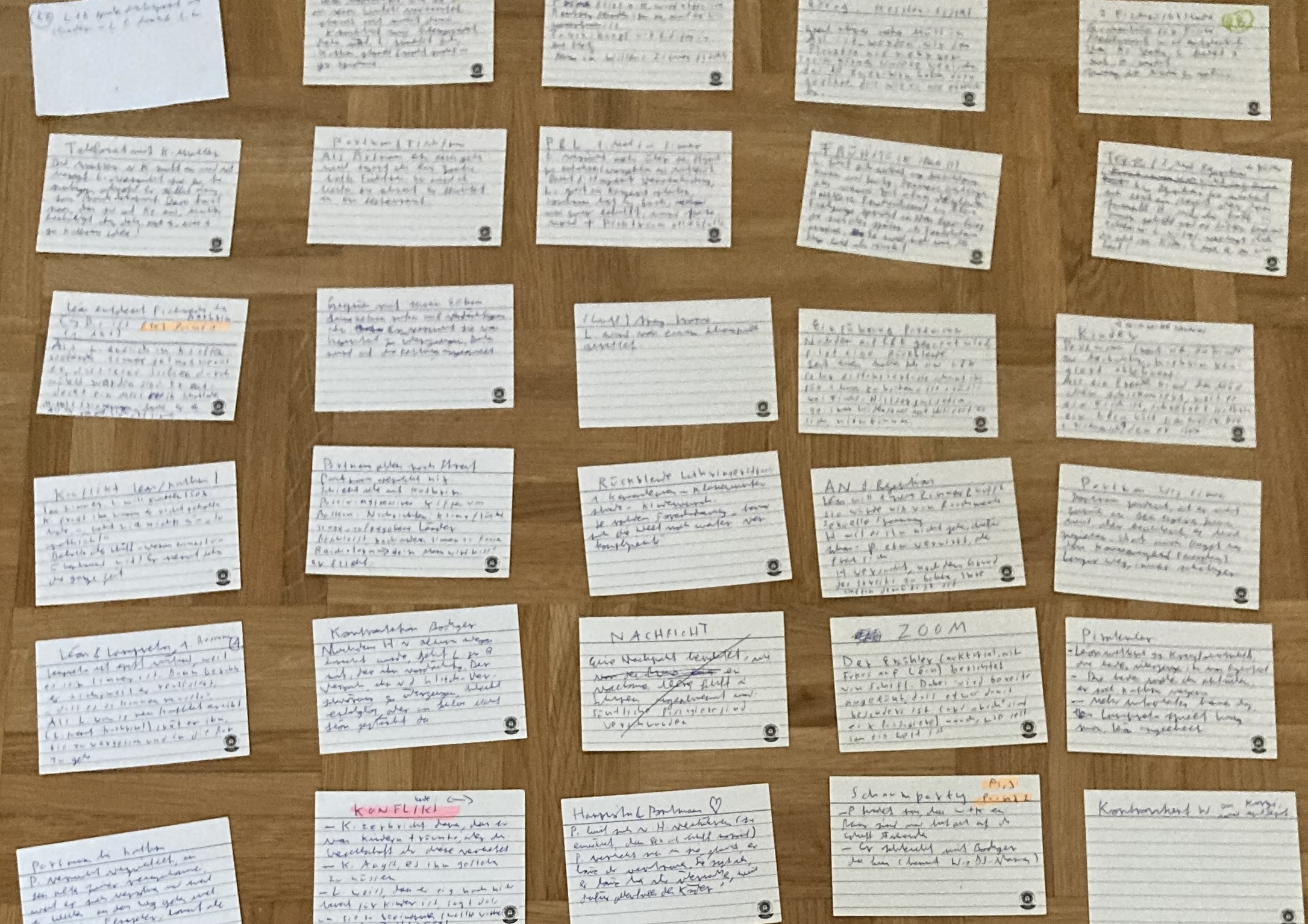
 Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.
Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. 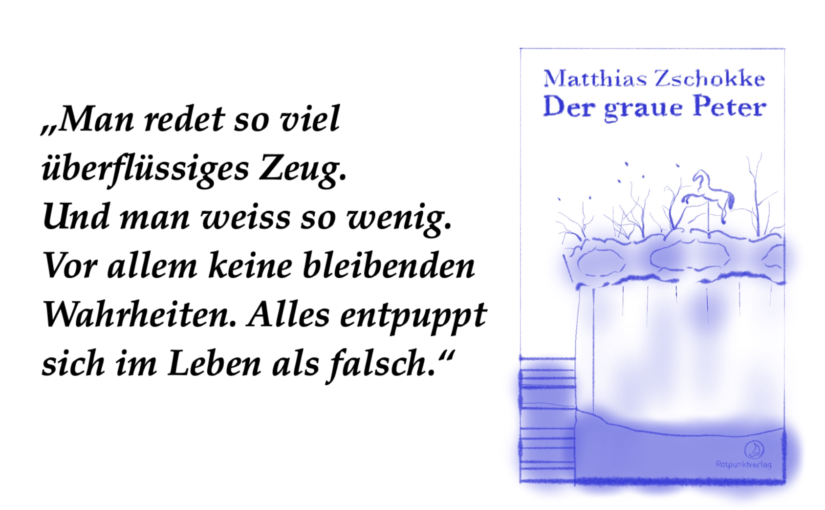

 Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen?
Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen? Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher;
Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher;