An meine erste Taufe erinnere ich mich nicht. 1967, Scuol, Unterengadin. Sommer. Ich war wenige Monate alt, ein pausbäckiges Dutzendkind mit rabenschwarzen Augen. Von wem sind denn die? Auf den Fotos bettet mich meine schöne Mutter auf ihren Arm, sie trägt ein graues Deux-pièce, das man in den 60iger Jahren chic nannte, und auch meine Patin Miggi hält mich, die Halbschwester meines Vaters, die in der Familie als schön galt, in Wahrheit war sie recht gewöhnlich und dazu bösartig, aber sie war blond. In der Familie war nur sie blond. Neben Miggi steht mein Pate; er heisst Heinrich, genannt Bum-Bum, er ist Metzger, schnittlauchlang, dünne Arme, dünne Beine, mit Teigbauch, als hätte er einen dieser Sitzbälle, die später aufkamen, verschluckt, ein gutmütiger Pate, der viele Schnäpse verträgt und in der Nacht unter den falschen Fenstern singt.
Meine Taufe war, ausser dass ich in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen wurde, ein Skandal. Denn es war eine katholische Taufe, meine Mutter hatte das verlangt, aus Angst vor der Hölle, mein Vater hatte zugestimmt, mein Grossvater war auch gekommen, der alte Katholikenhasser mit dem edlen Profil. Mein Vater und mein Grossvater lachen nicht auf den Fotos. Und ich auch nicht. Ich weiss gar nicht, ob pausbäckige Kinder lachen können, die Backen, die allen als süss gelten, damit sie sie unter einem Vorwand zwicken können, belasten doch diesen kleinen Mund ungemein. Aber nicht die Nase, noch heute weiss ich, wie der reformierte Bart meines Grossvaters, den ich später Neni nannte, roch. Er roch streng. Ich liebte den Grossvater mehr als alle anderen. Ich sagte in der Primarschule: Wenn ich sterbe, holt mich der Neni ab. Das glaube ich auch heute noch.
Die zweite Taufe erlebte ich 2014 in Klagenfurt. Das ist eine Provinzstadt in Österreich. Schon wieder Sommer. Die zweite Taufe nach der ersten Taufe, die mich einst aufgenommen hatte in die Gemeinschaft der Gläubigen – fälschlicherweise sind damit die Christen gemeint. In Wahrheit wurde ich in die geschriebene und gesprochene Sprache aufgenommen, die niedergelegt ist im Alten Testament, ein ewiger Bund, dort liegt das Wort und dampft, es ist voller Zorn, voller Wucht und Kraft, es ist rücksichtslos und hart. Wo kommt es her? Von weit, du Anfängerin! – War ja nur eine Frage.
Ich war mit der ersten Taufe offiziell in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen worden, und ich wollte die Gläubigste sein von allen. Das Alte Testament nahm mich ins Wort auf, damit ich meinen Glauben ausdrücken konnte, das Evangelium nahm mich in seinen Schlepptau, und, siehe da, es erzählte die beste Geschichte von allen. Ich las und hörte zu. Ich glaubte alles, fragte mich aber, obwohl man das nicht darf: Wer erzählt hier? Wer schrieb auf? Der Meistererzähler, der Erzählmeister? Ja, ganz recht, Gott erzählt, sagte einer. Gott erzählt? Gott schreibt? Nein, nein, Gott schreibt nicht, er hat keine Hände, er diktiert nur. Aha. Das hiesse, alle Erzähler äffen ihn nach, es dürfte keine Geschichten geben. Selbst erzählen, falls das überhaupt geht, und schreiben wäre ein Verstoss. Oder aber: Gott erzählt uns alle Geschichten, wir schreiben sie nur auf? Dann blieben wir unschuldig.
Und was ist mit den schlechten Geschichten? Kommen die vom Teufel? Ja, die kommen vom Teufel oder von seiner vorwitzigen Grossmutter, sie ist die Gefährliche, weil sie so gefällig tut. Die schlechten Geschichten sind ein Hohn auf den Meistererzähler, sie äffen den Erzählmeister nach, man sollte die Ohren verschliessen, sie nie zu Ende hören oder lesen und niemals weiterempfehlen. Sind denn die schlechten Geschichten die bösen Geschichten oder was bedeutet schlecht? Schlecht bedeutet schlecht erzählt, nichts weiter. Schlecht erzählen ist des Teufels Grossmutter.
Die zweite Taufe, die in Klagenfurt am Wörthersee, war die Aufnahme in die Gemeinschaft derer, die alles aufschreiben – mit Lizenz von oben. Nennen wir die, die alles aufschreiben, die Schreiber und Schreiberinnen; es ist eine Kaste, nicht ganz oben angesiedelt und auch nicht ganz unten. Eine graue Mittelschicht aus Halbverhungerten.
Ich reiste nach Klagenfurt, weil ich in die Provinzstadt nach Österreich eingeladen worden war, im Restaurantwagen nach Salzburg ass ich drei Gänge, weil ich bald zu den Halbverhungerten gehören würde. In Klagenfurt stieg ich aus dem Zug und stand herum, ich wartete auf einen, der mich aufnehmen würde in die Gemeinschaft derer, die zum lebenslänglichen Diktat antreten wollen, die alles aufschreiben, die Geschichten erzählen, und dabei hoffen, sie seien nicht auf die vorwitzige Grossmutter des Teufels hereingefallen.
Ich wartete, aber es kam keiner, und als ich schon davon ausging, dass keiner komme, kam einer, er hiess Burkhard, er stammte aus Deutschland, das war klar, denn er sprach Deutsch und deutlich, in perfekter Intonation. Er dirigierte mich vom Bahnhof auf den Domplatz und sagte: Lesen Sie vor, was Sie geschrieben haben! Ich las vor, was dastand, und als die Geschichte zu Ende war, schaute Burkhard aus Deutschland mich böse an und sagte: Next please! Sein Wort dampfte, weil er mich Scheisse fand. Und der Gestank seines Wortes war so mächtig, dass ich auch zu stinken begann, deshalb begab ich mich gleich nach der Nichtaufnahme in die Gemeinschaft der Schreibenden in mein Hotel Zum goldenen Brunnen, um ein Bad zu nehmen, aber da ich den Hotelprodukten nicht traute, ging ich etwas benommen, aber sehr badewillig in die Kramergasse, wo ein Wunder geschah.
Adam kam auf mich zu. Er sagte, er sehe, dass ich seine Produkte brauche, er lotste mich in seinen Laden, aber ich wäre auch freiwillig mitgegangen. Als er sagte, er heisse Adam und wolle mich beraten, wusste ich, jetzt wird alles gut. Bevor ich etwas sagen konnte, hatte Adam mir die neuste Handcrème der Wundermarke Kedem angeschmiert, die er als galaktisch anpries, in Wahrheit war der Geruch aufdringlich, oberkünstlich und unangenehm, ich begriff, dass ich so richtig angeschmiert war, denn mir kam Burkhard in den Sinn, der mir die Lizenz verweigert hatte, obwohl ich die Gläubigste von allen war.
Hatte er das etwa gemerkt? War alles nur eine Prüfung? Versteckte Kamera? Hatte er Adam geschickt, um zu schauen, wie ich auf ein zweites künstliches Angeschmiertsein reagieren würde? Ich dachte nach.
Adam fragte, ob ich eine Antifaltenbehandlung wünsche. Er schaute mir tief in die Augen. Nein, danke. Adam hüpfte im Geschäft herum, die Handcrème hielt er für verkauft, statt 25 Euro 19 für die Dame. Okay. Ich sagte, ich wolle baden. Einen Augenblick und tadaaa, sagte Adam. Und schon stand dieser Tiegel mit dem goldenen Deckel Salt Scrub Peach & Honey vor mir. Um Gottes Willen, nein! Da las ich: Made in Israel.
Salt Scrub aus dem Heiligen Land. Das konnte kein Zufall sein, und auch nicht, dass es saftige 60 Euro kostete. Qualität kostet, biblische ist unbezahlbar. Adam winkte ab, wir schauen dann noch mit Preis, sagte Adam, ein Ungare, der out of the Blue sagte, es sei schwierig mit den Israelis, oioioi, sehr schwierig, geschäftlich, sagte er. Ich wollte etwas sagen und so ein bisschen in Richtung Ungarn verbinden, da stand bereits das zweite israelische Top-Produkt vor mir: Body Butter Kiwi. 60 Euro. Adam machte aus 145 Euro deren 90 und strahlte.
Ich bezahlte und hastete ins Hotel, wo ich mir ein Bad einlaufen liess. Ich legte mich ins lauwarme Wasser. Nach einer geschätzten Viertelstunde stand ich auf, ohne das Wasser abzulassen, und rieb mich mit dem Pfirsich-Honig-Meersalz ein, ich griff in die Dose und verteilte das teure Mousse grosszügig auf meinem Körper. Peeling, das muss sein, zwei Mal pro Monat, hatte Adam gesagt. Ich zog das durch mit der Schälkur. Ich rieb die ganze Dose ein, ein halbes Kilogramm. Aus Israel, dem Heiligen Land, für weniger als 60 Euro. Ich war rot wie ein Hummer. Hummer sind schöne Tiere, ich esse sie nicht.
Ich setzte mich ins Bad und tauchte unter. Ich tauchte auf und tauchte nochmals unter, ich hielt die Luft an, bis es eng wurde, dann tauchte ich wieder auf, um sehr schnell, mit halb gefüllter Lunge, wieder unterzutauchen. Ich tauchte auf und sagte: Ich taufe dich, Romana, im Namen von Ingeborg Bachmann, die dich höchstpersönlich aufnimmt in die Gemeinschaft der Schreibenden, auf keinen weiteren Namen, vergiss das mit dem Pseudonym, das ist affig, ich taufe dich, weil Ingeborg Bachmann dich für würdig befunden hat, einzutreten in die Welt der Schreibenden, als du heute Morgen ihre Gedichte lasest und weintest. Sie hat dich erkannt als grosse Gläubige. Ich ermächtige dich, Romana, das zu sagen und Geschichten zu schreiben, bis du tot umfällst. Du sollst das nicht nur tun, du musst das tun, ich befehle es dir.
Ich glaubte mir, stand auf, duschte, wusch mir die Haare mit dem Billigprodukt, das das Hotel mir überlassen hatte, und stieg aus der Wanne. Nun schmierte ich mich ein mit der Kiwibutter With Dead Sea Minerals and Shea Butter (Paraben-Free) von Kedem aus dem Heiligen Land, ich schmierte meine Seele, ich ölte mich und versiegelte meinen Leib.
 Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
Webseite der Autorin
Beitragsbild © Laura Giannini
 Gastrezension von
Gastrezension von


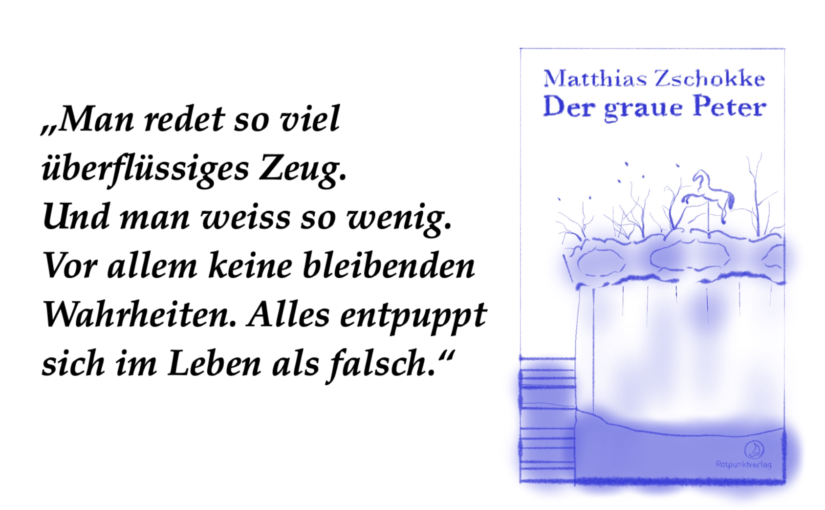


 Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen?
Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen? Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher;
Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher; 
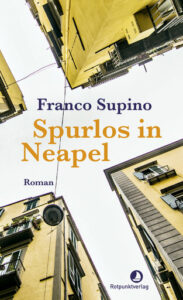







 Annette Hug, die mit ihrem vierten Roman «Tiefenlager» die Geschichte einer ganz besonderen Gemeinschaft erzählt. Fünf Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, mit ganz verschiedenen Herkunftsgeschichten gründen eine Gemeinschaft. «Die Müllmänner». Eine Krankenpflegerin, ein Kraftwerkarbeiter, ein Nuklearphysiker, eine Finanzberaterin und eine Linguistin gründen einen Orden und entwickeln Methoden, um das Wissen über die Gefahren des Atommülls verlässlich zu dokumentieren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Vision: Kein Mensch soll durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet werden. Annette Hug wollte keinen dystopischen Roman schreiben. Sie leuchtet in dieses Pentagon, mäandert in Perspektiven und Erzähltypen und überzeugt durch eine fein ziselierte Sprache.
Annette Hug, die mit ihrem vierten Roman «Tiefenlager» die Geschichte einer ganz besonderen Gemeinschaft erzählt. Fünf Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, mit ganz verschiedenen Herkunftsgeschichten gründen eine Gemeinschaft. «Die Müllmänner». Eine Krankenpflegerin, ein Kraftwerkarbeiter, ein Nuklearphysiker, eine Finanzberaterin und eine Linguistin gründen einen Orden und entwickeln Methoden, um das Wissen über die Gefahren des Atommülls verlässlich zu dokumentieren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Die Vision: Kein Mensch soll durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet werden. Annette Hug wollte keinen dystopischen Roman schreiben. Sie leuchtet in dieses Pentagon, mäandert in Perspektiven und Erzähltypen und überzeugt durch eine fein ziselierte Sprache.  Stefan Keller, der neben Reportagen, journalistischen Arbeiten und Sachbüchern auch literarische Texte schreibt, las aus «Spuren der Arbeit». Ein erzählte Sprache gewordenes Archiv aus 200 Jahren, dass den Kanton Thurgau, die Ostschweiz zu einem Spiegel der Weltgeschichte macht. Von den feudal organisierten «Manufakturdörfern», über das Leiden von schwerst arbeitenden Kindern, das koloniale Selbstverständnis wachstumsberauschter Jungunternehmer bis nach Hinterindien, Hungersnöte und verzweifelter Aufstände bis hin zur Datenfabrik hinter Stacheldraht. Stefan Keller spinnt in seinem Buch ein feines Netz von Namen und Fakten, das Zuhörer:innen und Leser:innen bewusst macht, das Weltgeschehen vor der Haustüre stattfindet – und auf wie viel Schmerz, Leiden und Blut unser gegenwärtiger Reichtum aufbaut.
Stefan Keller, der neben Reportagen, journalistischen Arbeiten und Sachbüchern auch literarische Texte schreibt, las aus «Spuren der Arbeit». Ein erzählte Sprache gewordenes Archiv aus 200 Jahren, dass den Kanton Thurgau, die Ostschweiz zu einem Spiegel der Weltgeschichte macht. Von den feudal organisierten «Manufakturdörfern», über das Leiden von schwerst arbeitenden Kindern, das koloniale Selbstverständnis wachstumsberauschter Jungunternehmer bis nach Hinterindien, Hungersnöte und verzweifelter Aufstände bis hin zur Datenfabrik hinter Stacheldraht. Stefan Keller spinnt in seinem Buch ein feines Netz von Namen und Fakten, das Zuhörer:innen und Leser:innen bewusst macht, das Weltgeschehen vor der Haustüre stattfindet – und auf wie viel Schmerz, Leiden und Blut unser gegenwärtiger Reichtum aufbaut.

 ihren Eltern zuhause, bei Danielle, ihrer Mutter und Oliver, ihrem Vater, der erst vor kurzem sein neues Leben als Rentner aufgenommen hat. Lous Schwester Mathilde ist von Barcelona hergefahren, auch der Bruder Edouard ist da. Nur einer fehlt. Einer fehlt immer. Romain, der älteste, den Danielle aus ihrer ersten Ehe in die wachsende Familie gebracht hatte. Romain, der schon als Jugendlicher nicht den Weg eingeschlagen hatte, den man ihm gewünscht hätte, der sich immer mehr verselbstständigte, sich immer mehr dem Einfluss seiner Eltern entzog. Ein junger Mann, der sich durch seinen exzessiven Alkoholkonsum bis ins Koma saufen, von dem man über Monate und Jahre nichts hören konnte, der verschwand, den Edouard irgendwann in Paris in der Gosse wiederfinden musste, weit weg von jeglicher Bereitschaft, in ein normales Leben zurückzukehren.
ihren Eltern zuhause, bei Danielle, ihrer Mutter und Oliver, ihrem Vater, der erst vor kurzem sein neues Leben als Rentner aufgenommen hat. Lous Schwester Mathilde ist von Barcelona hergefahren, auch der Bruder Edouard ist da. Nur einer fehlt. Einer fehlt immer. Romain, der älteste, den Danielle aus ihrer ersten Ehe in die wachsende Familie gebracht hatte. Romain, der schon als Jugendlicher nicht den Weg eingeschlagen hatte, den man ihm gewünscht hätte, der sich immer mehr verselbstständigte, sich immer mehr dem Einfluss seiner Eltern entzog. Ein junger Mann, der sich durch seinen exzessiven Alkoholkonsum bis ins Koma saufen, von dem man über Monate und Jahre nichts hören konnte, der verschwand, den Edouard irgendwann in Paris in der Gosse wiederfinden musste, weit weg von jeglicher Bereitschaft, in ein normales Leben zurückzukehren. Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat eine Anzahl Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Für «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» wurde sie mit dem Schillerpreis, dem Prix Rambert und dem Grand Prix du roman de la SGDL ausgezeichnet. Mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2017 konnte Pascale Kramer erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.
Pascale Kramer, 1961 in Genf geboren, hat eine Anzahl Romane veröffentlicht, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Lausanne, verbrachte sie einige Jahre in Zürich und ging 1987 nach Paris, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Mit ihrem vierten Roman «Die Lebenden» (Prix Lipp Suisse), 2000 in Frankreich und 2003 erstmals auf Deutsch in der Übersetzung von Andrea Spingler erschienen, kam der literarische Durchbruch. Für «Die unerbittliche Brutalität des Erwachens» wurde sie mit dem Schillerpreis, dem Prix Rambert und dem Grand Prix du roman de la SGDL ausgezeichnet. Mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2017 konnte Pascale Kramer erstmals eine Auszeichnung für ihr Gesamtwerk entgegennehmen.
 Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
Romana Ganzoniwurde 1967 in Scuol, Unterengadin, geboren, wo sie auch aufwuchs. Geschichts- und Germanistikstudium an der Universität Zürich, Aufenthalt in London. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Gymnasiallehrerin widmet sie sich heute ganz dem Schreiben und lebt als freie Autorin in Celerina, Oberengadin. Seit 2013 Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. 2014 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Förderpreis des Kantons Graubünden. Seit 2015 Kolumnen in der Schweiz am Sonntagund im KulturBlog der Engadiner Post. «Granada Grischun» in der Reihe Edition Blau, Rotpunktverlag ist ihre erste Buchveröffentlichung.
 Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.
Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.
 «Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.
«Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.
 «Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.
«Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.
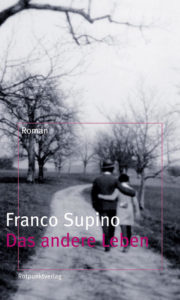 Franco Supino, geboren 1965 in Solothurn, wuchs als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Studium der Germanistik und Romanistik in Zürich und Florenz. Heute lebt er in Solothurn und unterrichtet an der Pädagogischen Fachhochschule. Franco Supino erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Preis für Literatur des Kantons Solothurn 2001.
Franco Supino, geboren 1965 in Solothurn, wuchs als Kind italienischer Eltern zweisprachig auf. Studium der Germanistik und Romanistik in Zürich und Florenz. Heute lebt er in Solothurn und unterrichtet an der Pädagogischen Fachhochschule. Franco Supino erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Preis für Literatur des Kantons Solothurn 2001.