Eine Frage, mit der sich die Literatur wie keine andere Kunstgattung immer und immer wieder beschäftigt; Was ist wichtig im Leben? Wonach streben wir? Wo liegt der Kern unseres Daseins. Annette Mingels beschäftigt sich in ihrem neuen Roman „Der letzte Liebende“ einmal mehr ganz direkt mit diesen Fragen. Mit Fragen, die wir uns irgendwann fast alle stellen werden.
Annette Mingels Roman erzählt die letzten Monate der Ehe von Helen und Carl Krüger – Helen ist todkrank und wird im Laufe des Romans sterben – und die ersten Monate nach ihrem Tod. «Der letzte Liebende“ erzählt aus der Sicht des eremetierten Professors, der mit seinem Ruhestand alles andere als seine innere Ruhe gefunden hat. Von einem Mann, der mit existenzieller Not konfrontiert wird und mit der Tatsache, dass gewisse Dinge uneinholbar verloren sind, Türen verschlossen bleiben.
Die Ehe zwischen Helen und Carl war schon lange nicht mehr das, was man sich unter einer funktionierenden Ehe vorstellt. Schon früh begann das Fundament zu bröckeln, nicht nur weil vorest der Kinderwunsch verwehrt blieb, sondern vor allem deshalb, weil Carl es nicht lassen konnte, aussereheliche Beziehungen entstehen zu lassen, nicht zuletzt in der Machtposition eines Professors einer Uni. Beziehungen, die sich nicht verheimlichen liessen. Selbst als sich mit dem Adoptivkind Lisa doch noch so etwas wie Familie einstellte. Irgandwann wurde Helens Leidensdruck so gross, dass sie Carl vor ein Ultimatum stellte. Aber selbst Carls Entscheidung gegen seine Geliebte rettete weder Ehe noch Familie. Helen zog sich in die oberen Stockwerke des grossen Hauses zurück. Man traf sich höchstens noch zufällig. Und als Helen krank wurde und ihre Ablehnung ihrem Ehemann gegenüber immer mehr zur Aversion, kippte auch Carls längst ramponierte Beziehung zu seiner Tochter Lisa in blanke Abneigung. Helens Sterben, ihr Tod gab Carl keine Möglichkeit mehr, an etwas Konstruktives anzudocken. Er hatte es verpasst.
«Ob das, was er fühlte, Einsamkeit war oder nur Erschöpfung, wusste er selbst nicht.»

Was sich nach dem Tod seiner Frau in Carl ausbreitet, hat schon lange zuvor begonnen. Eine lähmende Einsamkeit. Er weiss um seine Fehler, aber die Adressatin für eine aktive Wiedergutmachung, wenn sie dann überhauptmöglich wäre, ist tot. Carl weiss um seine Versäumnisse. Die Autorin beschreibt subtil, wie sehr sich Carl nur mühsam aus seiner Egozentrik herausschälen kann. Wäre da nicht Lisa, die selbst mit ihrem eingeschlagenen Berufsweg ihre Abneigung Carl gegenüber verdeutlicht; nur ja keine akademische Karriere! Helen stirbt und Carl droht damit noch viel mehr zu verlieren, als „nur“ eine Weggefährtin.
Bis ihm ein ehemaliger Kollege ein Romanmanuskript in die Hand drückt, in dem die Hauptperson ziemlich genau die Züge von Carl trägt. Ein Roman, den Karl mit ebensoviel Ekel wie Entrüstung liest. Bis Carl dem Sohn seiner Tochter, seinem Enkel, eine Reise in Carls Herkunftsland verspricht und sich auf dieser Reise in die Vergangenheit Perspektiven verschieben. Bis allen Teilnehmenden dieser anstrengenden Reise klar wird, dass sich hinter den Geschichten andere Geschichten verbergen und nur diese Geschichten klären können.
«Womöglich hatte er sein ganzes Leben lang etwas Entscheidendes übersehen.»
Annette Mingels erzählt nicht einfach von einem „alten, weissen Mann“, von Rollenbildern, die zaghaft aufbrechen und von Szenen einer kaputten Ehe. Es braucht unsäglich viel, bis Carl seine alte Schale aufbricht. Und von genau diesem langsamen Aufbrechen erzählt dieser Roman. Als Leser schüttelte ich immer wieder einmal den Kopf, tat mich schwer mit den Reaktionen dieses Mannes. Aber genau das will Annette Mingels; Auch wenn sie dem alten, weissen Mann dann doch noch entgegenkommt, will die Autorin keine rührselige Geschichte erzählen. Wann werden Schalen zu Rüstungen? Warum kann man sich nicht mehr aus seiner Rolle befreien, auch wenn man offenen Auges in die Katastrophe schreitet?
Ich mag den Protagonisten, weil Annette Mingels ehrlich und unmittelbar erzählt. Weil sie den Mann in seiner grenzenlosen Einsamkeit nicht schont. Und weil sie selbst diesen Mann mag. Ein absolut lesenswertes Buch!

Interview
Es hätte doch auch eine emeritierte Professorin sein können. Oder bot sich der „alte weisse Mann“ als ideale Projektionsfläche an?
Tatsächlich wurde ich zur Figur des Carl durch eine konkrete Begegnung inspiriert; für ein anderes Projekt interviewte ich einen emeritierten Professor, der auf verblüffende Weise gleichzeitig modern und in alten Privilegien verhaftet war. Es hätte tatsächlich auch eine emeritierte Professorin sein können – nur wäre es dann ein anderes Buch geworden, eines über eine „alte weisse Frau“, die ja tatsächlich auch das Gegenstück zum „alten weissen Mann“ ist und in vielfältiger Weise in Interaktion zu selbigem steht. Sie kommt im Roman nur indirekt vor – in Form von Carls Ehefrau Helen. Ihre Geschichte zu erzählen, könnte tatsächlich spannend sein.
Es muss im langen Leben von Carl unendlich viele Signale gegeben haben, die seine Egozentrik verdeutlichten. Aber er wollte sie weder sehen, hören oder spüren. Er wollte sein Leben leben, geniessen, seine Möglichkeiten ausschöpfen. Erst die Gewissheit der Endlichkeit, zuerst das Sterben und dann der Tod seiner Frau, dann die Angst vor totaler Einsamkeit bringen Carl dazu, sich millimeterweise aufzutun. Leben wir nicht in einer Zeit, in der die eigene Befindlichkeit alles andere relativiert? Hätten wir wirklich ein gemeinschaftliches Bewusstsein, würde uns die Gegenwart nicht grün und blau schlagen.
Ja, Carl hat die Signale gesehen und bewusst ignoriert, weil sie ihm dabei im Weg standen, das zu tun, was ihn glücklich machte. Er selbst würde sofort zugeben, dass er ein Egozentriker (gewesen) sei, aber dies sofort mit dem jedem Menschen zustehenden individuellen Glücksstreben entschuldigen. Erst als seine Möglichkeiten im hohen Alter immer geringer werden und ihm ausserhalb seiner Familie nicht viele Menschen bleiben, lässt er die Erkenntnis und auch ein Bedauern darüber zu, wie rücksichtslos er gewesen war. Was allerdings nicht bedeutet, dass er es – gäbe es ein nächstes Mal – besser machen würde. Trotzdem mag ich Carl – vor allem, weil er sich nicht einredet, es gut gemacht zu haben. Er ist sich seiner Fehler bewusst und weiss, dass die Zuneigung und Fürsorge seiner Tochter Lisa unverdient ist.
Carl, die Familie, sie machen eine Reise. Auch wenn die Reise nicht das brachte, was sich jeder erwartete, war die Reise, schon die Entscheidung dazu, ein erster Schritt, einer aus der Komfortzone. Eigentlich ist doch Mut der Schlüssel zu so vielem! Ist man als Schriftstellerin mutig? Man kann ja seine ProtagonistInnen agieren lassen.
Ja, das sagen Sie sehr richtig: man lässt seine ProtagonistInnen agieren – und das im ganz wörtlichen Sinne: Wenn ich einmal zu schreiben angefangen habe, entwickeln sich die Figuren oft in einer auch für mich unvorhergesehenen Weise und bekommen so etwas wie ein Eigenleben. Von daher ist mein Schreiben, glaube ich, oft mutiger als ich selbst.
Den Mut, den es dann von mir als Autorin noch braucht, ist der, mich mit einer Veröffentlichung der Kritik auszusetzen. Darüber hinaus bin ich, fürchte ich, nicht besonders mutig. Aber es gibt natürlich überall da, wo eine solche Veröffentlichung tatsächlich Mut erfordert, weil nicht nur Kritik, sondern auch Bestrafung droht – in repressiven Systemen – durchaus sehr mutige Autorinnen und Autoren.
„Schon seit einigen Jahren hatte er das Gefühl, dass er kaum noch gesehen wurde“, steht ziemlich am Anfang ihres Buches. Nicht ungewöhnlich für einen Mann, der sich während seiner Berufszeit stets im Mittelpunkt sah. Aber zugleich ein symptomatischer Satz für unsere Zeit, in der sich eine Influenzerin die Lippen zu Ballons aufblasen lässt und man um jeden Preis den Mount Everest besteigt, in der man dauernd Selfies von sich macht oder es zum Lebensziel werden kann, wenigstens einmal im Fernsehen zu erscheinen. Carl zieht sich nicht zurück, er wird abgedrängt. Brauchen wir um jeden Preis Aufmerksamkeit? Wo bleibt die Bescheidenheit?
Carl hatte durch seinen Beruf und durch seine relative Attraktivität eine Position, in der ihm fast automatisch Aufmerksamkeit zuteil wurde; sie war sogar wesentlicher Bestandteil dessen, was er an seinem Beruf liebte. Die ungeliebte Emeritierung und das Alter nehmen ihm nun das, was ihm viel bedeutete. Für mich ist er nicht jemand, der um jeden Preis auffallen will und seine 15 Minuten Ruhm braucht, aber er ist durchaus angewiesen auf Anerkennung und positive Resonanz, vielleicht auch, weil er diese innerhalb seiner Familie – auch selbstverschuldet – nicht erhält. Bescheiden muss er sich zwangsläufig; Bescheidenheit ist aber nicht seine stärkste Tugend. In diesem Punkt steht er wohl im Einklang mit unserer Gesellschaft.
Mit ihrem Roman setzen Sie die Familie auf ein Podest. Als Familienmensch sollte mir das gefallen. Und doch bröckelt dieses Fundament, dieses Ideal. Nicht zuletzt deshalb, weil dieses Ideal aus dem Fokus geraten ist. Nicht verwunderlich bei all den grassierenden Problemen, die sich nicht mehr ausblenden lassen. Wo Carl am Ende ihres Romans steht, ist in der Schwebe. Wo ich am Ende meines Lebens stehe, weiss ich nicht. Aber das Wissen um die Kraft der Familie werde ich dann brauchen. Ist das Schreiben eine Schärfung des Bewusstseins um die Frage: Was ist wichtig?
Ja, ich glaube, die Frage nach dem, was uns wichtig ist, bildet für die meisten Schriftsteller und Schriftstellerinnen den Resonanzboden ihres Schreibens und tritt in diesem in verschiedenster Weise immer wieder zutage. So liegt eigentlich all meinen Büchern eine grundsätzlich humanistische Betrachtung des Individuums zugrunde – seiner Möglichkeiten und Grenzen, seiner Liebesbegabung und seiner Fehlbarkeit. Der enge Kosmos der Familie lässt all dies in besonderer Weise zutage treten; wie unter einem Brennglas zeigen sich hier die menschlichen Stärken und Schwächen.
Annette Mingels wurde 1971 in Köln geboren. Sie studierte Germanistik, Linguistik und Soziologie in Frankfurt, Köln, Bern und Fribourg und schloss mit einer Promotion in Germanistik ab. Von 1997 bis 2009 lebte sie in der Schweiz; neben der deutschen besitzt sie die schweizerische Staatsbürgerschaft. In der Schweiz hatte sie Lehraufträge an den Universitäten Neuenburg und Fribourg, ausserdem am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Von 2009 bis 2011 lebte sie in Montclair (USA), anschliessend in Hamburg. Von 2018 bis 2021 lebte sie in San Francisco, seitdem bei Berlin. Für ihre Bücher erhielt Annette Mingels zahlreiche Stipendien und Werkbeiträge. Für ihr Buch “Was alles war” (Knaus, 2017) ausserdem den Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag.







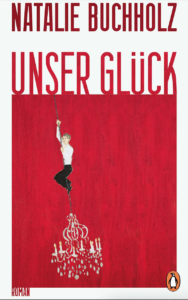









 Der Abend war tief beglückend.
Der Abend war tief beglückend.