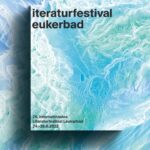 In einer von lauen Winden erwärmten Nacht im Juli – schlaflos stehst Du am Fenster, ein kraftloser Halbmond gießt sein Licht über Deinen mitternachtsblauen Schlafanzug – in einer von lauen Winden erwärmten Nacht im Juli, zwei oder drei Uhr muss es sein, blickst Du, unklare Traumbilder noch im Kopf, über die Dächer Leukerbads, blickst hinauf und hinüber zu den groben, den abschreckend anziehenden Felskaskaden, hältst ein Glas Wasser in der Hand und horchst, schaust horchend in diese einladend milde Nacht hinaus, und beim vierten, fünften Schluck aus dem Wasserglas bemerkst Du es: Es hat sich in Deinen Ohren etwas Entscheidendes verwandelt, etwas Bedeutendes ist in Dir herangereift, Du hörst die Dala rauschen, als sprudle ihr Wasser quellenklar vor Deinen nackten Füssen, und das leicht schmatzende Geräusch, das Du jetzt vernimmst, muss tatsächlich von dem staubgrauen Nachtfalter herrühren, der eben vorhin auf dem Fenstersims gelandet ist und dort nun seine vordersten Beine zum Mund führt und sie reinigt und abermals reinigt mit einer rührenden Geduld.
In einer von lauen Winden erwärmten Nacht im Juli – schlaflos stehst Du am Fenster, ein kraftloser Halbmond gießt sein Licht über Deinen mitternachtsblauen Schlafanzug – in einer von lauen Winden erwärmten Nacht im Juli, zwei oder drei Uhr muss es sein, blickst Du, unklare Traumbilder noch im Kopf, über die Dächer Leukerbads, blickst hinauf und hinüber zu den groben, den abschreckend anziehenden Felskaskaden, hältst ein Glas Wasser in der Hand und horchst, schaust horchend in diese einladend milde Nacht hinaus, und beim vierten, fünften Schluck aus dem Wasserglas bemerkst Du es: Es hat sich in Deinen Ohren etwas Entscheidendes verwandelt, etwas Bedeutendes ist in Dir herangereift, Du hörst die Dala rauschen, als sprudle ihr Wasser quellenklar vor Deinen nackten Füssen, und das leicht schmatzende Geräusch, das Du jetzt vernimmst, muss tatsächlich von dem staubgrauen Nachtfalter herrühren, der eben vorhin auf dem Fenstersims gelandet ist und dort nun seine vordersten Beine zum Mund führt und sie reinigt und abermals reinigt mit einer rührenden Geduld.
Es dauert eine Weile, bis Du Dich vom Anblick dieses Falters lösen kannst, und als Du wieder hoch in den Himmel schaust, andächtig auf das konzentriert, was Du zu hören vermagst, so ist Dir gar, als könntest Du nicht nur sehen, sondern auch hören, wie der sanfte Nachtwind zwei filigrane, auf den Horizont zulaufende Kondensstreifen allmählich zusammenschiebt zu einer Sache, welche Wolke genannt zu werden verdient.
Du verstehst nicht zu sagen, ob es sich nicht doch um eine nächtliche Täuschung Deines Wahrnehmens handelt, um einen Traum gar, aber dieser neue, dieser erstaunlich klare Gehörsinn zieht Dich unvermittelt nach draußen, zieht Dich hinaus in die Landschaft, in die Natur hinein, in eine Natur, die jetzt nichts anderes mehr ist als eine mächtige, eine unwiderstehliche Einladung der gesteigerten Akustik.
Ohne auch nur das Geringste mitzunehmen, gehst Du aus der Tür, lässt Deine Wohnung hinter Dir, lächerlich fern ist jetzt alles, was bisher wichtig schien; mit unheimlich wachen Sinnen verlässt Du barfuß das schlafende Dorf.
Talabwärts marschierst Du, der mächtig rauschenden Dala entlang, an Inden vorbei, der Rhone entgegen, und noch ehe Du überlegen kannst, biegst Du kurz vor Leuk ab und gehst den Weg hoch, der hinführt zur Bodensatellitenstation Brentjong.
Bald hast Du sie direkt vor Dir, diese sanften, weißen Riesenmuscheln, diese überdimensionierten Halbkugeln, die hier die sonst unbemerkt verhallenden Signale des Universums einfangen. Sieben, acht, neun Stück müssen es sein, je mehr Du Dich umschaust, desto zahlreicher werden diese weißen Monumente des Horchens.
Es versteht sich, dass die Anlage von einem stacheldrahtgeschmückten Maschendrahtzaun umgeben ist. Aber mit Maschendrahtzäunen verhält es sich nicht anders als mit Damenstrümpfen; früher oder später reißt eine Masche, und lange bleibt es unbemerkt.
Tatsächlich findest Du rasch eine defekte Stelle, wo Du hindurchkriechen kannst. Viel Raum bleibt nicht, Du musst gut aufpassen, dass Dein mitternachtsblauer Schlafanzug sich nicht an einem Drahtende verfängt, und vorsichtig ahnend, dass Dich große akustische Glücksmomente erwarten, betrittst Du den Satellitenstationsboden.
Wie locker im Wald verteilte Pilze stehen diese mächtigen, allesamt in einem unbestechlichen Weiß gehaltenen Konstruktionen auf dem Areal verstreut. Manchmal stehen zwei ganz ähnliche dicht beieinander und horchen in die exakt selbe Richtung, als hätten sie sich verbrüdert und würden sich eine schwierige Aufgabe teilen. Andere behaupten eine spezielle Himmelsrichtung ganz für sich allein, scheinen stolz darauf und wollen mit den anderen, die scheinbar nur zufällig auch noch da sind, möglichst nichts zu schaffen haben. Ein ganz großer Empfänger hat seine Schüssel nicht nach Ost und nicht nach West, hat seine Schüssel in überhaupt keine Himmelsrichtung gereckt; senkrecht hoch gehen seine Fühler, und es sieht überhaupt nicht stolz aus, eher so, als sei er dazu verknurrt worden, das hier spärlich fallende Regenwasser aufzufangen.
Schließlich wählst Du unter jenen, die ihre metallenen Körper nach Südosten ausgerichtet haben, den größten aus. Die Kanten der metallenen Treppe schneiden unsanft in Deine nackten Füße, aber das kümmert Dich nicht, Du steigst empor an nachtkühlem Metall, Hände und Fußballen fühlen ein Summen, eine sanfte, metallene Vibration, es ist die Verbindung von Dir und diesem metallenen Leib, die Dich euphorisiert, und als die Treppe schließlich endet, auf einer engen Metallplattform, befindet sich über Deinem Kopf eine runde Luke, gesichert von einem massiven Griff.
Nichts scheint deutlicher als der Umstand, dass Du zu diesem Griff hinlangen, dass Du die Luke öffnen musst. Die Einsicht, dass Du nun direkt unter dem Trommelfell dieser Anlage stehst, erfüllt Dich mit einer wunderbaren Aufregung, und Du versuchst, Dich zu sammeln, um alle Details dieses Moments zu würdigen.
Unvermittelt streift Dich etwas.
Streift Dich, ehe es Dich trifft: Der Lichtkegel einer Taschenlampe ist es, und gleich darauf trifft Dich auch die grobe Stimme jenes Mannes, der eine Uniform der Firma Securitas trägt, trifft Dich die Stimme jenes Mannes, der viele Meter unter Dir steht und furchtbar schlecht gelaunt scheint und Dir erklärt, es sei der Aufenthalt auf dem Gelände strengstens verboten.
Du weißt nichts zu erwidern, blickst ruhig hinab zu diesem uniformierten Mann, der nun den Kegel seiner Taschenlampe wegnimmt aus Deinem Gesicht, vielleicht sogar aus Höflichkeit, er weiß ja sicher, wie arg das blendet.
Du erwiderst noch immer nichts; auch er scheint nichts mehr sagen zu wollen. Vielleicht hat dieser Mann in seinem Leben schon zu viele Male zu ähnliche Worte wiederholen müssen, vielleicht hat er die Kraft verloren, auch nur einen einzigen schon gesagten Satz nochmals zu sagen, jedenfalls schweigt er, wie auch Du schweigst, und jedenfalls fühlst Du, es verbindet Dich jetzt mit diesem Mann eine wunderbare Stille, ein wunderbar stilles Einverständnis, und als Du sicher bist, dass Dich diese Stille innig verbunden hat mit dem stumm in seiner Uniform verweilenden Mann, räusperst Du Dich leise, um ihn nicht zu erschrecken, dann fragst Du: «Möchten Sie nicht hochsteigen, zusammen mit mir die Luke öffnen und es sich anhören, das liebkosende Flüstern des Universums?»
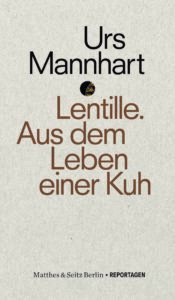 Urs Mannhart, geboren 1975, lebt als Schriftsteller, Reporter und Landwirt in der Schweiz. Er hat Zivildienst geleistet bei Raubwildbiologen und Drogenkranken, hat ein Studium der Germanistik abgebrochen, ist lange Jahre für die Genossenschaft Velokurier Bern gefahren, war engagiert als Nachtwächter in einem Asylzentrum und absolvierte auf Demeter-Betrieben die Ausbildung zum Bio-Landwirt. Für sein literarisches Werk erhielt er eine Reihe von Preisen, darunter 2017 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Im selben Jahr war er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen; sein Text stand auf der Shortlist. Sein neuster Roman «Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der Grillen» erschien 2021 bei Secession. Im Herbst 2022 erscheint bei Matthes & Seitz «Lentille. Aus dem Leben einer Kuh»: «Ein Bericht über die komplexen Beziehungsgeflechte zwischen Menschen und more-than-humans, der zeigt, wie bereichernd es ist, Zeit in der Nähe einer wiederkäuenden Kuh zu verbringen.»
Urs Mannhart, geboren 1975, lebt als Schriftsteller, Reporter und Landwirt in der Schweiz. Er hat Zivildienst geleistet bei Raubwildbiologen und Drogenkranken, hat ein Studium der Germanistik abgebrochen, ist lange Jahre für die Genossenschaft Velokurier Bern gefahren, war engagiert als Nachtwächter in einem Asylzentrum und absolvierte auf Demeter-Betrieben die Ausbildung zum Bio-Landwirt. Für sein literarisches Werk erhielt er eine Reihe von Preisen, darunter 2017 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis. Im selben Jahr war er zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen; sein Text stand auf der Shortlist. Sein neuster Roman «Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der Grillen» erschien 2021 bei Secession. Im Herbst 2022 erscheint bei Matthes & Seitz «Lentille. Aus dem Leben einer Kuh»: «Ein Bericht über die komplexen Beziehungsgeflechte zwischen Menschen und more-than-humans, der zeigt, wie bereichernd es ist, Zeit in der Nähe einer wiederkäuenden Kuh zu verbringen.»




 Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «
Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «







 Gastbeitrag von Caterina John
Gastbeitrag von Caterina John
 Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel
Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel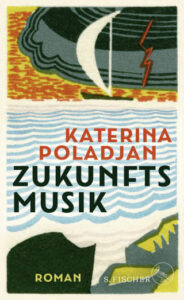


 Gastbeitrag von Nina Hurni
Gastbeitrag von Nina Hurni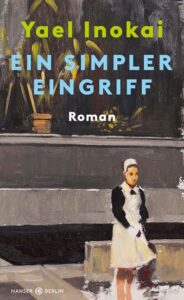


 Theres Roth-Hunkeler, geboren 1953 in Hochdorf Luzern, lebt heute in Baar bei Zug und oft in Berlin. Schreiben, Lesen und Literaturvermittlung sind ihre Schwerpunkte, die auch ihre langjährige Lehrtätigkeit an Kunsthochschulen prägten. Die Autorin hat neben Erzählungen und journalistischen Texten fünf Romane publiziert, zuletzt «Allein oder mit andern» (2019) und das Text-Bild-Werk «Lange Jahre» (2020) mit Bildern der Malerin Annelis Gerber-Halter.
Theres Roth-Hunkeler, geboren 1953 in Hochdorf Luzern, lebt heute in Baar bei Zug und oft in Berlin. Schreiben, Lesen und Literaturvermittlung sind ihre Schwerpunkte, die auch ihre langjährige Lehrtätigkeit an Kunsthochschulen prägten. Die Autorin hat neben Erzählungen und journalistischen Texten fünf Romane publiziert, zuletzt «Allein oder mit andern» (2019) und das Text-Bild-Werk «Lange Jahre» (2020) mit Bildern der Malerin Annelis Gerber-Halter.