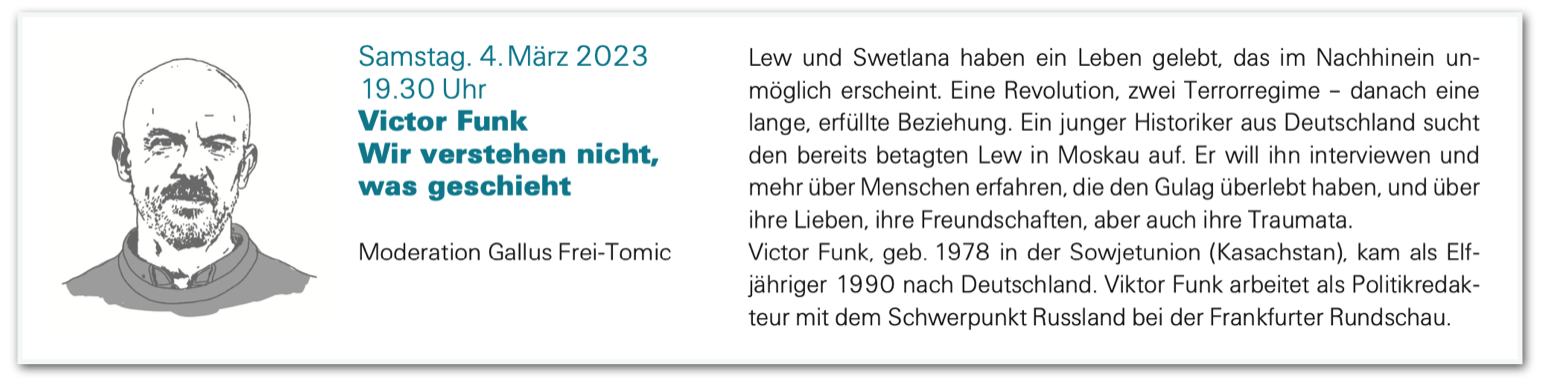Seit in Europa mit Bomben beladene Drohnen Wohnhäuser zerreissen, Panzer Radfahrer beschiessen und ein unüberwindbarer Graben zwischen Europa und Russland gähnt, ist das Interesse vieler, verstehen zu wollen, gross. Vielleicht auch ein Grund, warum das Interesse am Schriftsteller und Historiker Viktor Funk so gross war.
«Wir haben uns lange auf den Besuch in Gottlieben gefreut, und ihr habt uns mit eurer Gastfreundschaft gezeigt, dass unsere Vorfreude gerechtfertigt war. Danke für Deine sehr empathische und herzliche Moderation, Gallus, danke an Sandra für die Bilder und auch an das Publikum für alle die Aufmerksamkeit und die Neugierde. Und danke auch, dass wir dank euch Gottlieben kennengelernt haben.» Viktor Funk
Wir leben in beängstigen Zeiten. Hätten wir uns vor 13 Monaten vorstellen können, was in Europa geschieht? Viktor Funk kam 1978 in Kasachstan, einer ehemaligen Sowjetrepublik zur Welt und zusammen mit seiner Familie als Zwölfjähriger nach Deutschland. Wenn man auf seiner Webseite liest, muss das für jenen Viktor damals mehr als nur eine schwierige Zeit gewesen sein. Trotzdem gelang es ihm, Geschichte zu studieren und mit einer Magisterarbeit über den Vergleich von mündlicher und schriftlicher Erinnerungen von Gulag-Überlebenden abzuschliessen.

2017 debütierte Viktor Funk in der Literatur mit seinem Roman „Bienenstich“, eben genau mit jenen Krisen junger MigrantInnen, die sich überall abspielen, seit dem von Russland angezettelten Krieg millionenfach, bis vor unsere Haustüren.
Seit 2006 ist Viktor Funk Redakteur bei der Frankfurter Rundschau im Ressort Politik, schreibt aber nicht nur dort, sondern engagiert, intensiv und emphatisch Romane, die aktueller nicht sein könnten.
Als ich seinen aktuellen Roman „Wir verstehen nicht, was geschieht“ vor ein paar Monaten zu lesen begann, wusste ich schon während der ersten Seiten, dass ich darüber schreiben musste und am Ende der Lektüre, dass ich es versuchen musste, den Schriftsteller in die Schweiz, nach Gottlieben einzuladen. Dass Viktor Funk die Einladung annahm, freute mich ungemein.

In den Konzentrationslagern der Sowjetzeit starben über 4 Millionen Menschen an Erschöpfung, Krankheiten, Unterernährung oder den Folgen sadistischer Strafen. Es ist nicht anzunehmen, dass im Nachfolgestaat Russland die Gulags zu Geschichte wurden. „Wir verstehen nicht, was geschieht“ ist aber nicht einfach ein Versuch des Wachrüttelns und schon gar kein Vorwurf an ein träges Westeuropa, das sich neben all dem gegenwärtigen Schrecken nicht auch noch mit jenem in der Vergangenheit beschäftigen möchte.
Viktor Funk hat sich ganz intensiv mit mündlichen und schriftlichen Erinnerungen von Gulag-Überlebenden beschäftigt und stiess dabei auf die Geschichte des Physikers Lew Mischenko und seine Frau Svetlana.
Lev und Svetlana sind keine Fiktion. Genauso wie Petschora, der Gulag, in den man Lev nach seiner Zeit im KZ Buchenwald schickte. „Wir verstehen nicht, was geschieht“ ist der Versuch des Autors selbst zu verstehen; Wie kann man die Jahre in einem Gulag überstehen? Und wie schaffte es ein Mann wie Lev nicht daran zu zerbrechen?

Zentrales Element im Buch und im Überlebenskampf sind die Briefe zwischen Lev und Svetlana. Es gibt viele Gründe, warum Lev die Zeit im Gulag überlebte; sein Glück ein Techniker, ein Physiker zu sein, seine Freundschaften – aber mit Sicherheit diese Liebe zu seiner Frau.
Der Roman ist die Geschichte einer Reise; einer Reise mit dem Zug nach Petschora Richtung Sibirien, eine Reise in die Vergangenheit und eine Reise in die Tiefen eines Lebens. Viktor Funk hat Lev dort zurückgelassen, mit diesem Buch aber eigentlich wieder mitgenommen.

Vielen Dank für den wichtigen Abend!
Rezension zu «Wir verstehen nicht, was passiert» auf literaturblatt.ch
Beitragsbilder © Sandra Kottonau