Manche Begegnungen sind schicksalshaft. Selbst wenn daraus kein andauerndes Beieinander wird, wenn gemeinsame Zeit längst zerronnen ist. Aber es bleibt das Bild, der Eindruck, unauslöschlich in die Erinnerung eingegraben.
Man stelle sich vor: Irgendwann begegnet man irgendwo einem Menschen, der sich in kaum etwas von dem unterscheidet, was man einst selbst war. Man erkennt sich in jemandem, fühlt sich von der Zeit, der Vergangenheit eingeholt. Man stelle sich vor, man komme mit diesem überraschenden Gegenüber ins Gespräch, Leben würden sich kreuzen, Gegenwart mit Vergangenheit, um festzustellen, dass sich die eigene Geschichte zu löschen beginnt, während man sich immer tiefer in die Geschichte des Gegenübers verstrickt.
Peter Stamms neuer Roman, nimmt etwas von dem wieder auf, was sein erster Roman „Agnes“ zu erzählen begonnen hatte. In „Agnes“ fordert eine junge Frau ihren Geliebten, einen Schriftsteller auf, ihre Geschichte, ihre gemeinsame Geschichte zu schreiben, die Geschichte ihrer Liebe. Mehr noch; Geschichte im Erzählen vorwegzunehmen. In „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ fügt Peter Stamm jenem Drängen aus seinem ersten Roman noch weitere Schichten hinzu.
Christoph lernt die viel jüngere Magdalena kennen, muss ihr ihre Geschichte erzählen, die vor vielen Jahren damit begann, dass er eine Frau kennenlernte, die ihr in fast allem gleiche, die er aber aus den Augen verloren habe. Magdalena wundert sich über einen älteren Mann, der ihr eine Geschichte erzählen will,  die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.
die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.
In Peter Stamms neuem Roman geht es um existenzielle Fragen, wie immer in seinen Romanen. Auch in seinem letzten Roman „Weit über das Land“, in dem ein Familienvater scheinbar plötzlich aus seinem Leben abtaucht. In „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ kreuzen sich Realitäten. Die eine löscht die andere. Peter Stamm heizt dort ein, wo man meint, sicher zu sein. Er reisst auf, wie sich sonst kaum mehr jemand traut zu erzählen: von Vielbödigkeit, von den trüben Rändern der Wirklichkeit. Von dem, was die Erinnerung mit der scheinbaren Wahrheit macht. Peter Stamm tut dies in so unaufgeregter Art und Weise, dass es mich wundert, wie tief mich der schmale Roman ins Grübeln stösst.
Peter Stamm verrät, wie sehr er sich Sicherheit für sein Schreiben wünscht. Man fragt sich zwar; Glaube ich, was ich lese? Nie aber; Weiss ich, was ich lese? Ein Roman, der das Zeug zur Verunsicherung hat. Ein Roman, der Fragen stellt, die ich für mich schon lange beantwortet zu haben glaubte. Ein Roman, der konzentriert erzählt, nie abschweift, beinahe sachlich erzählt. Peter Stamm kocht nicht Altes auf. Dafür spritzt er mit heissem Wasser!

Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte verschiedene Berufe aus, u.a. in Paris und New York. Er lebt in der Schweiz. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt «Agnes» 1998 erschienen fünf weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken, zuletzt die Romane «Nacht ist der Tag» und «Weit über das Land» sowie unter dem Titel «Die Vertreibung aus dem Paradies» seine Bamberger Poetikvorlesungen.



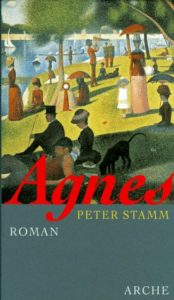 mehr verunsichert als verliebt, angezogen von der Abenteuerlust eines kühlen Entdeckers. Eines Tages öffnet er mit Agnes Schlüssel ihre Wohnung, bleibt eine Weile, beginnt zu schreiben, kramt in den Sachen, sieht den einzigen Schmuck an der Wand, ein Poster mit einer Figur des Künstlers Kokoschka mit dem Titel «Mörder, Hoffnung der Frauen», die Karte eines Freundes und in einer Schublade Tabletten. Während die Geschichte um Agnes auf Papier immer weiter gesponnen wird, er Idylle spriessen lässt, wird die Beziehung der beiden immer gereizter. Erst recht, als Agnes ihm erklärt, sie sei schwanger. Erst recht, als er darauf nicht mit Freude reagiert. Während sie enttäuscht und zornig seine Wohnung verlässt, sie, die schon von ihrer eigenen Familie abgeschnitten lebt, bleibt er, paralysiert, perplex. Er schreibt weiter, in verschiedenen Varianten. So, dass es für den Leser nie ganz klar ist, auf welche Seite die Geschichte nun wirklich kippt.
mehr verunsichert als verliebt, angezogen von der Abenteuerlust eines kühlen Entdeckers. Eines Tages öffnet er mit Agnes Schlüssel ihre Wohnung, bleibt eine Weile, beginnt zu schreiben, kramt in den Sachen, sieht den einzigen Schmuck an der Wand, ein Poster mit einer Figur des Künstlers Kokoschka mit dem Titel «Mörder, Hoffnung der Frauen», die Karte eines Freundes und in einer Schublade Tabletten. Während die Geschichte um Agnes auf Papier immer weiter gesponnen wird, er Idylle spriessen lässt, wird die Beziehung der beiden immer gereizter. Erst recht, als Agnes ihm erklärt, sie sei schwanger. Erst recht, als er darauf nicht mit Freude reagiert. Während sie enttäuscht und zornig seine Wohnung verlässt, sie, die schon von ihrer eigenen Familie abgeschnitten lebt, bleibt er, paralysiert, perplex. Er schreibt weiter, in verschiedenen Varianten. So, dass es für den Leser nie ganz klar ist, auf welche Seite die Geschichte nun wirklich kippt. Eine Inhaltsangabe des neuen Romans, der im kommenden Februar erscheinen soll: Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird.
Eine Inhaltsangabe des neuen Romans, der im kommenden Februar erscheinen soll: Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte verschiedene Berufe aus, u.a. in Paris und New York. Er lebt in der Schweiz. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt ›Agnes‹ 1998 erschienen fünf weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken, zuletzt die Romane ›Nacht ist der Tag‹ und ›Weit über das Land‹ sowie unter dem Titel ›Die Vertreibung aus dem Paradies‹ seine Bamberger Poetikvorlesungen.
Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte verschiedene Berufe aus, u.a. in Paris und New York. Er lebt in der Schweiz. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt ›Agnes‹ 1998 erschienen fünf weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken, zuletzt die Romane ›Nacht ist der Tag‹ und ›Weit über das Land‹ sowie unter dem Titel ›Die Vertreibung aus dem Paradies‹ seine Bamberger Poetikvorlesungen.
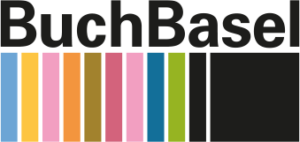
 Der 1962 in Dresden geborene und in Berlin lebende Ingo Schulze, schon lange eine Grossmacht in der deutschen Literaturszene, schrieb mit seinem neusten Roman „Peter Holtz – Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ die Geschichte eines reinen Tors. Peter Holtz ist einer, der das Gute will, nur das Gute. 1974, kurz vor seinem 12 Geburtstag haut er ab aus einem sozialistischen Kinderheim auf der Suche nach der besseren Welt, auf der Suche nach Menschen wie ihm, die
Der 1962 in Dresden geborene und in Berlin lebende Ingo Schulze, schon lange eine Grossmacht in der deutschen Literaturszene, schrieb mit seinem neusten Roman „Peter Holtz – Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ die Geschichte eines reinen Tors. Peter Holtz ist einer, der das Gute will, nur das Gute. 1974, kurz vor seinem 12 Geburtstag haut er ab aus einem sozialistischen Kinderheim auf der Suche nach der besseren Welt, auf der Suche nach Menschen wie ihm, die  ungebrochen an den real existierenden Sozialismus glauben. Der überaus witzige und tiefsinnige Roman erzählt in einem langen Bogen bis ins Jahr 1998, als aus dem bettelarmen Jungen ein wider Willen schwerreicher Mann geworden ist, dessen Tun und Lassen sich ohne Absicht in Gold und Geld verwandelt. Ingo Schulzes Roman beschreibt die Wendezeit der deutschen Geschichte. Er erzählt aber nicht bloss, sondern stellt mit seinem Erzählen ganz grundsätzliche Fragen. Ingo Schulze erzählt leicht, lädt mich ein, an der Seite eines Andersartigen die Suche nach dem Glück aufzunehmen. Lesen!
ungebrochen an den real existierenden Sozialismus glauben. Der überaus witzige und tiefsinnige Roman erzählt in einem langen Bogen bis ins Jahr 1998, als aus dem bettelarmen Jungen ein wider Willen schwerreicher Mann geworden ist, dessen Tun und Lassen sich ohne Absicht in Gold und Geld verwandelt. Ingo Schulzes Roman beschreibt die Wendezeit der deutschen Geschichte. Er erzählt aber nicht bloss, sondern stellt mit seinem Erzählen ganz grundsätzliche Fragen. Ingo Schulze erzählt leicht, lädt mich ein, an der Seite eines Andersartigen die Suche nach dem Glück aufzunehmen. Lesen! Und Rosa Yassin Hassan, eine aus Syrien geflohene Schriftstellerin und Bloggerin, die seit 2012 in Hamburg lebt und arabische Literatur unterrichtet. Vom Schriftsteller Yusuf Yeşilöz im Namen des DeutschSchweizer PEN Zentrums eingeladen ist Rosa Yassin Hassan auf einer Lesereise mit ihren Romanen „Ebenholz“ und „Wächter der Lüfte“. Am 15. November, am Writers in Prison Day wird in vielen Ländern verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gedacht. Wäre Rosa Yassin Hassan 2012 nicht aus Syrien geflohen, wäre sie wegen ihrer ganz offenen Kritik in ihrem Blog an der Syrischen Regierung und ihrem Diktator Baschad al-Assad mit Sicherheit eingesperrt und gefoltert worden, wie viele ihrer Freunde, Verwandten und Gesinnungsgenossen.
Und Rosa Yassin Hassan, eine aus Syrien geflohene Schriftstellerin und Bloggerin, die seit 2012 in Hamburg lebt und arabische Literatur unterrichtet. Vom Schriftsteller Yusuf Yeşilöz im Namen des DeutschSchweizer PEN Zentrums eingeladen ist Rosa Yassin Hassan auf einer Lesereise mit ihren Romanen „Ebenholz“ und „Wächter der Lüfte“. Am 15. November, am Writers in Prison Day wird in vielen Ländern verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gedacht. Wäre Rosa Yassin Hassan 2012 nicht aus Syrien geflohen, wäre sie wegen ihrer ganz offenen Kritik in ihrem Blog an der Syrischen Regierung und ihrem Diktator Baschad al-Assad mit Sicherheit eingesperrt und gefoltert worden, wie viele ihrer Freunde, Verwandten und Gesinnungsgenossen.  „Schreiben ist meine Krankheit und meine Therapie, die Erinnerung eine tödliche Last“, verrät die Autorin im Interview mit Michael Guggenheimer, Schriftsteller und Journalist. Rosa Yassin Hassan will eine Brücke sein zum Verständnis der arabischen Kultur, die alles andere als deckungsgleich mit islamischer Kultur ist. Sie schreibt und spricht über Tabus; Religion, Politik und nicht zuletzt über Sex. Schreiben in einer Umgebung, die in Europa vollkommen anders ist als in ihrer Heimat Syrien, einem Land, dessen Infrastruktur heute zu 70% zerstört ist. Die Autorin entschied wie viele andere, die aus Syrien flohen, nie, Flüchtling zu werden. Sie sei schlicht zur Flucht gezwungen worden, aus einem Land, in dem nichts mehr funktioniert, in dem man in jedem Augenblick mit dem Tod bedroht ist. Was im Büchlein „Eine fatale Sprayaktion – Die Geschichte dreier Freunde in Syrien“ als Revolution die Welle zum Überschwappen brachte, ist längst zu einem verlorenen Bürgerkrieg geworden. Rosa Yassin Hassan kämpft mit Worten weiter.
„Schreiben ist meine Krankheit und meine Therapie, die Erinnerung eine tödliche Last“, verrät die Autorin im Interview mit Michael Guggenheimer, Schriftsteller und Journalist. Rosa Yassin Hassan will eine Brücke sein zum Verständnis der arabischen Kultur, die alles andere als deckungsgleich mit islamischer Kultur ist. Sie schreibt und spricht über Tabus; Religion, Politik und nicht zuletzt über Sex. Schreiben in einer Umgebung, die in Europa vollkommen anders ist als in ihrer Heimat Syrien, einem Land, dessen Infrastruktur heute zu 70% zerstört ist. Die Autorin entschied wie viele andere, die aus Syrien flohen, nie, Flüchtling zu werden. Sie sei schlicht zur Flucht gezwungen worden, aus einem Land, in dem nichts mehr funktioniert, in dem man in jedem Augenblick mit dem Tod bedroht ist. Was im Büchlein „Eine fatale Sprayaktion – Die Geschichte dreier Freunde in Syrien“ als Revolution die Welle zum Überschwappen brachte, ist längst zu einem verlorenen Bürgerkrieg geworden. Rosa Yassin Hassan kämpft mit Worten weiter.

 Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den
Meer. Eine Reise, die 2381 km und 61 Tage lang dauern sollte und Jacaré mit seinen drei Gefährten in Gebiete führen sollte, die sie zuvor mit ihren einfachen Flossen nie befahren hatten. Ein waghalsiges Unternehmen, um in Rio vor dem brasilianischen Präsidenten und Diktator Getulio Vargas ihr Recht einzufordern. Als die erfolgreiche Reise in der Presse ihre Runde machte, erfuhr auch der junge Schauspieler und Filmemacher Orson Welles von dem mutigen Unternehmen und wollte mit den  Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte.
Akteuren selbst dieses Abenteuer nachspielen. «Ich will, dass ihr es genauso macht, wie es war», soll Orsen Welles die vier Männern beschworen haben. Doch bei den Dreharbeiten zu dem Film reisst eine Welle Jacaré von seinem Floss – und er verschwindet im Meer. Zurück bleibt Jacarés Frau mit ihren gemeinsamen Kindern und Orson Welles, ohne dessen Ansinnen es diesen Tod so nie gegeben hätte. Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird!
Aber Carmen Stephan, die schon mit ihrem Erstling «Mal Aria» Kritik und LeserInnen überzeugte, macht aus diesen Geschichten viel mehr. Carmen Stephan scheint durchdrungen zu sein von Bildern, Symbolik, dem Mut der Fischer, dem Leid der Familien und dem Hunger eines jungen Hollywood-Regisseurs. Was sie in ihrem Buch «It’s all true» tut, ist die Umsetzung all dieser Geschehnisse in eine Parabel auf die Wahrheit. In einer Sprache, die poetisch und verdichtet wie in Stein gehauen von den Urgeschichten der Menschheit erzählt; der Liebe zur Familie, dem Kampf ums Überleben, der Faszination des unmöglich Scheinenden, dem Mut der Verzweifelten. Carmen Stephan kommt in dem schmalen Roman ihren Gestalten dabei so nah, dass es mir nach der Lektüre des Buches fast unmöglich erscheint, so einfach zur Tagesordnung überzugehen. Das Buch ist voller Weisheit, voller Sprachmusik, intensiv und expressiv. Ein Buch mit Sätzen, die sich tief einbrennen. Ein Buch, das in meinem Regal einen ganz besonderen Platz bekommen wird! Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.
Carmen Stephan, 1974 im bayrischen Berching geboren, arbeitete mehrere Jahre als Autorin in Brasilien. Heute wohnt sie in Genf. 2005 erschien der Geschichtenband «Brasília Stories» und 2012 ihr erster Roman «Mal Aria», für den sie mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung 2012 und dem Debütpreis des Buddenbrookhauses 2013 ausgezeichnet wurde.
 Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten,
Ilija Trojanow zwingt den Leser, sich aufzutun, sich nicht hinter dem Wahn zu verbergen, es gäbe eine gelungene Flucht, es sei schon alles irgendwie gut gegangen. «Nach der Flucht» ist kein Lesevergnügen. Wer sich der Thematik nicht stellen will, lässt das Buch besser liegen. Das Leben nach der Flucht bleibt ein Leben auf der Flucht. Selbst jene, die sich hinter Zäunen und Mauern, Ideologien und Strategien verstecken, sind auf der Flucht; auf der Flucht vor der Realität, auf der Flucht davor, zum Hinsehen und Hinhören genötigt zu werden. Ilija Trojanow schont mich nicht. Im Buch geht es nicht darum, was nach der Flucht geschieht, sondern um das Gefühl des Fremdseins, ob daraus ein Mangel oder eine Kraft wird. Trojanows Miniaturen reichen von «einfachen» Fragen, Einsichten, 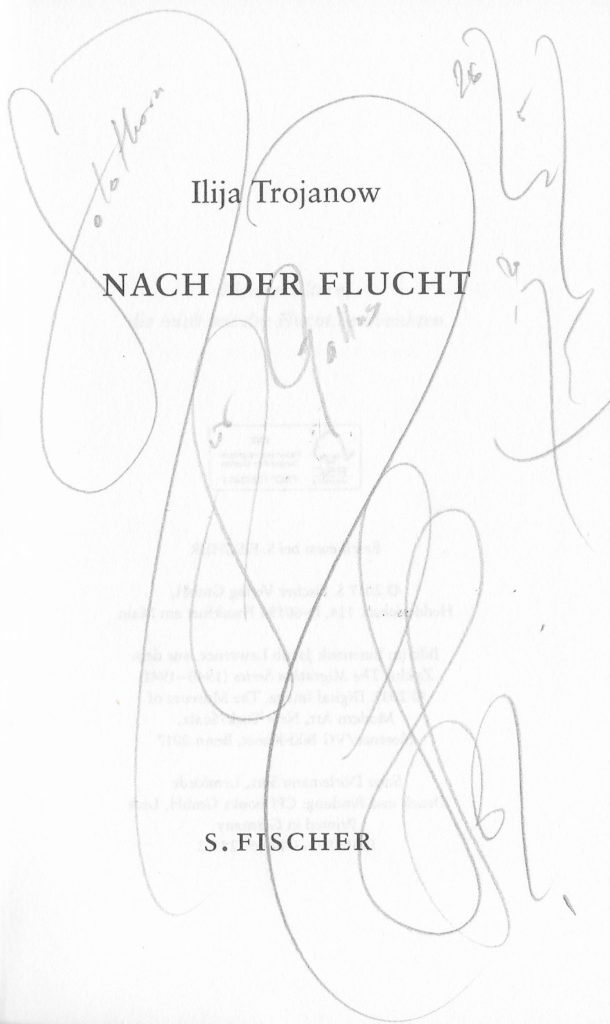 Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig!
Prosaminiaturen bis hin zu Stichen mitten ins Herz. Keine Nachttischlektüre, wenn man sich den Schlaf nicht rauben lassen will. Aber ein Brevier für unterwegs, um an Bahnhöfen, in Parks und vor Bushäuschen nicht wegzuschauen. Vielleicht als Hilfsmittel stehenzubleiben, wenn nicht physisch, dann zumindest gedanklich, um jenen zuzuhören, die man sonst kaum versteht. Trojanow will verstehen und ist davon überzeugt, das Verstehen-wollen der einzige Weg ist, um nicht in Lethargie oder gewaltsame Ausbrüche zu verfallen. Das schmale Büchlein ist mit Sicherheit Anlass genug, sich in Zeiten neu erstarkendem Nationalismus Gedanken über «Heimat» zu machen. Dringend notwendig! Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».
Ilija Trojanow, geboren 1965 in Sofia, floh mit seiner Familie 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland, wo sie politisches Asyl erhielt. 1972 zog die Familie weiter nach Kenia. Unterbrochen von einem vierjährigen Deutschlandaufenthalt lebte Ilija Trojanow bis 1984 in Nairobi. Danach folgte ein Aufenthalt in Paris. Von 1984 bis 1989 studierte Trojanow Rechtswissenschaften und Ethnologie in München. Dort gründete er den Kyrill & Method Verlag und den Marino Verlag. 1998 zog Trojanow nach Mumbai, 2003 nach Kapstadt, heute lebt er, wenn er nicht reist, in Wien. Seine bekannten Romane wie z.B. «Die Welt ist groß und Rettung lauert überall», «Der Weltensammler» und «Eistau» sowie seine Reisereportagen wie «An den inneren Ufern Indiens» sind gefeierte Bestseller und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschienen bei S. Fischer sein großer Roman «Macht und Widerstand» und sein Sachbuch-Bestseller «Meine Olympiade: Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen».
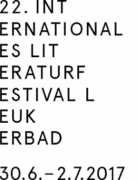 Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf!
Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf! spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren.
spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren.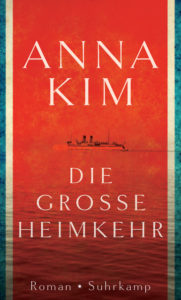 100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,
100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,  diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur.
diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur. Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu
Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu  verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss!
verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss! John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut
John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut  sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde.
sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde. faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!
faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!
 Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen.
Beim S. Fischer Verlag erschien 2017 nun das schmucke Büchlein «Ein Haus in Spanien» mit drei Geschichten, die zwischen 2000 und 2003 zum ersten Mal in den USA veröffentlicht wurden. So wie ich J. M. Coetzee für seine brillanten Romane schätze, für seine Meisterschaft, der Willkür und Gier auf den Nerv zu drücken, grosse Themen mitzunehmen, so liebe ich ihn für sein Feingefühl, Unscheinbares ernst zu nehmen und mehr als nur lesbar zu machen. J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.
J. M. Coetzee, der 1940 in Kapstadt geboren ist und von 1972 bis 2002 als Literaturprofessor in seiner Heimatstadt lehrte, gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart. Er wurde für seine Romane und sein umfangreiches essayistisches Werk mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, u. a. zweimal mit dem Booker Prize, 1983 für ›Leben und Zeit des Michael K.‹ und 1999 für ›Schande‹. 2003 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Coetzee lebt seit 2002 in Adelaide, Australien.
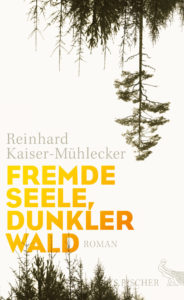 Da ist ein Hof, auf dem drei Generationen leben und leiden. Allen drei Generationen ist es nicht möglich, sich selbst zu retten; nicht dem Jüngsten Jakob, der den Hof sterben sieht, nicht dem Vater, der mit allen unmöglichsten Geschäftsideen Geld machen will und nicht der Grossvater, der wohl einiges aus seiner Zeit vor Ende des Weltkrieges hinüberretten konnte. Die Familie als Urbühne aller Konflikte?
Da ist ein Hof, auf dem drei Generationen leben und leiden. Allen drei Generationen ist es nicht möglich, sich selbst zu retten; nicht dem Jüngsten Jakob, der den Hof sterben sieht, nicht dem Vater, der mit allen unmöglichsten Geschäftsideen Geld machen will und nicht der Grossvater, der wohl einiges aus seiner Zeit vor Ende des Weltkrieges hinüberretten konnte. Die Familie als Urbühne aller Konflikte? Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?
Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben? Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde 1982 in Kirchdorf an der Krems geboren und wuchs in Eberstalzell, Oberösterreich, auf. Er studierte Landwirtschaft, Geschichte und Internationale Entwicklung in Wien.
Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde 1982 in Kirchdorf an der Krems geboren und wuchs in Eberstalzell, Oberösterreich, auf. Er studierte Landwirtschaft, Geschichte und Internationale Entwicklung in Wien.
 kümmert sich nicht um das Urteil anderer und ist nicht an Konventionen interessiert. Was Kirio jedoch am meisten auszeichnet, ist seine Fähigkeit «Wunder» auszulösen, ohne dass er es selbst bemerken würde. Er verhindert schon als kleines Kind einen Mord durch einen Schrei. Grosse und kleine Wirkungen, ohne dass Kirio sich dessen bewusst wäre. Und wenn er dann später in der Schule als Störefried gilt, dann nicht beabsichtigt oder aus Böswilligkeit, sondern nur schon deshalb, weil er sich im Handstand oder das Rad schlagend fortbewegt, selbst im Klassenzimmer. Sein wirkliches Gesicht aber zeigt Kirio, wenn man ihm begegnet, wenn Menschen nach einer Begegnung merken, wie ihnen unwillkürlich das Herz aufging. Kirio hört zu, allem und jedem, auch einem Tier oder einem Stein, ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Absicht.
kümmert sich nicht um das Urteil anderer und ist nicht an Konventionen interessiert. Was Kirio jedoch am meisten auszeichnet, ist seine Fähigkeit «Wunder» auszulösen, ohne dass er es selbst bemerken würde. Er verhindert schon als kleines Kind einen Mord durch einen Schrei. Grosse und kleine Wirkungen, ohne dass Kirio sich dessen bewusst wäre. Und wenn er dann später in der Schule als Störefried gilt, dann nicht beabsichtigt oder aus Böswilligkeit, sondern nur schon deshalb, weil er sich im Handstand oder das Rad schlagend fortbewegt, selbst im Klassenzimmer. Sein wirkliches Gesicht aber zeigt Kirio, wenn man ihm begegnet, wenn Menschen nach einer Begegnung merken, wie ihnen unwillkürlich das Herz aufging. Kirio hört zu, allem und jedem, auch einem Tier oder einem Stein, ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Absicht. Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, lebt als Autorin und Übersetzerin in Paris. Zuletzt erschienen bei S. Fischer «Kirio», «Ahnen», «Tal der Herrlichkeiten», «August» und «Luft und Liebe». Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Heimito-von-Doderer-Preis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet. Ihre Bücher schreibt Anne Weber auf Deutsch und Französisch.
Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, lebt als Autorin und Übersetzerin in Paris. Zuletzt erschienen bei S. Fischer «Kirio», «Ahnen», «Tal der Herrlichkeiten», «August» und «Luft und Liebe». Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Heimito-von-Doderer-Preis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet. Ihre Bücher schreibt Anne Weber auf Deutsch und Französisch.
 schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste.
schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste. Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.
Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.