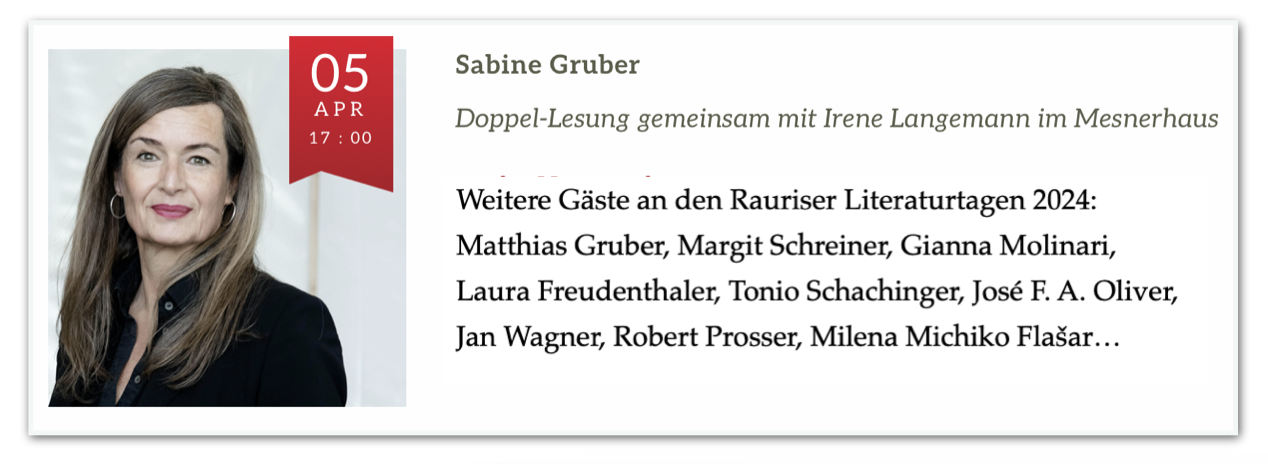Dass sich mit der Zeit Schicht um Schicht über die Vergangenheit legt, mag tröstlich erscheinen, vor allem dann, wenn sich in den verborgenen Schichten Geheimnisse verbergen, die Wunden aufreissen würden. Und doch macht das Vergessen Verborgenes nicht ungeschehen, wirkt Eingeschlossenes auch dann, wenn sich Schweigen ausgebreitet hat. Özlem Çimen hat Mut.
 Letzthin sah ich einen Ausschnitt eines Interviews mit einer jungen Person, die sich vehement dagegen wehrte, sich mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, mit den Gräueln des 2. Weltkriegs, des systematischen Tötens Andersgläubiger, den fatalen Auswirkungen eines Führerkults, der sich jeder Eigenverantwortung entzog. Und weil es die selbsternannte Spitze der Evolution nicht schafft, ein Miteinander wenigstens so zu organisieren, dass nicht immer und immer wieder Massen von Menschen Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt sind, ist es wichtig, diese Schichten aufzureissen, um sich nicht in einer falschen Sicherheit zu suhlen, man hätte mit all dem Schrecken aus der Vergangenheit nichts zu tun.
Letzthin sah ich einen Ausschnitt eines Interviews mit einer jungen Person, die sich vehement dagegen wehrte, sich mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, mit den Gräueln des 2. Weltkriegs, des systematischen Tötens Andersgläubiger, den fatalen Auswirkungen eines Führerkults, der sich jeder Eigenverantwortung entzog. Und weil es die selbsternannte Spitze der Evolution nicht schafft, ein Miteinander wenigstens so zu organisieren, dass nicht immer und immer wieder Massen von Menschen Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt sind, ist es wichtig, diese Schichten aufzureissen, um sich nicht in einer falschen Sicherheit zu suhlen, man hätte mit all dem Schrecken aus der Vergangenheit nichts zu tun.
Özlem Çimen erlebt das unmittelbar, nachdem sie zu fragen beginnt und jenes Gefühl und all die kleinen Beobachtungen wahrnimmt, die ihr zeigen, dass da etwas in ihrer Familie wirkt, was sich nicht nur in ihrer Familie auswirkt. Özlem Çimens Roman „Babas Schweigen“ ist eine ganz direkte Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, der Türkei. Eine unrühmliche Geschichte, die bis in die Gegenwart wirkt, Menschen ihre Kultur raubte, ihre Sprache, ihre Geschichte, ihren Boden. Özlem Çimens Roman ist minimal fiktionalisiert und beschreibt das Bemühen einer jungen Frau Verdrängtes, Verschwiegenes, Verleugnetes aufzubrechen.
In den Jahren 1937 und 1938 wurden in der türkischen Region Dersim mehr als 10 000 Kurden von türkischem Militär umbebracht, eine Aktion zur Türkisierung, ganz offensichtlich deshalb, weil der Staat Angst hatte, das verbliebene ehemalige Osmanische Reich würde durch verschiedene Volksgruppen und ihre Unabhängigkeitsbemühungen auseinanderbrechen. Damals fiel ein Zehntel der nicht muslimischen Dersim-Kurden dem Morden zum Opfer. Erst 2011 entschuldigte sich die türkische Regierung. Ein Akt, der den Armeniern gegenüber immer noch auf sich warten lässt. Viele Kurden damals mussten ihre angestammte Heimat verlassen, Kultur und Sprache verleugnen.

Özlem Çimen wuchs in der Schweiz auf. Jedes Jahr reiste man, schon als sie ein Kind war, immer wieder in die Türkei zu ihrer grossen Verwandtschaft, ihren Grosseltern. Sommer für Sommer war das Dorf dort der Inbegriff für Freiheit, Familie und Gemeinschaft. Özlem Çimen, die mittlerweile selber Mutter zweier Kinder ist, die sie immer und immer wieder auffordern, Geschichten aus ihrer Heimat zu erzählen, muss im Laufe der Zeit feststellen, dass die erzählte Idylle sich immer mehr mit dunklen Ahnungen mischt, die Özlem Çimen auffordern, ihre Fragen ganz direkt zu stellen. Fragen an Menschen, ihre Grosseltern, die es nicht gewohnt sind, das in Worte zu fassen, was sie schon ein ganzes Leben als Alp mit sich herumtragen.
Özlem Çimen erzählt ganz behutsam, auch mit der Absicht, mit dem Aufbrechen niemandem schaden zu wollen, am allerwenigsten ihrer Familie selbst. „Babas Schweigen“ ist eine Konfrontation gegen innen. Özlem Çimens Roman ist ein vorsichtiges Herantasten an Tatsachen und Wunden, die über Jahrzehnte verborgen und vergessen schienen, erzählt in einer schlichten Sprache, die den Schrecken von damals in vielem bloss andeutet. Ich hätte dem Buch etwas mehr historische Einbettung gewünscht, auch wenn damit eindeutige Positionierungen auf heikles Terrain führen.
„Babas Schweigen“ ist ein wichtiges Buch, weil das Schweigen nichts ungeschehen macht!
Interview
In Ihrem Roman treffen zwei Dringlichkeiten aufeinander; die Frage nach Herkunft und Wurzeln und das Bedürfnis, etwas offenzulegen, etwas ans Licht zu führen, das während Jahrzehnten unbelüftet zwischen Unter- und Unbewusstem schlummerte. Mir scheint, dass diese Fragen aus der Distanz, als in der Schweiz Geborene und Aufgewachsene noch viel dringlicher werden.
Die räumliche Distanz ist eine von vielen Komponenten, die sicherlich dazu beigetragen hat, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Ich habe das grosse Glück, all dieses Leid nicht am eigenen Leib erfahren zu haben. Meine Grosseltern konnten nicht darüber sprechen. Einerseits aus Selbstschutz und andererseits, weil sie nicht wussten, wie. Meine Eltern waren auch nicht in der Lage dazu. Sie mussten dafür sorgen, ein möglichst unauffälliges Leben für sich und ihre Nachkommen aufzubauen.
Insofern glaube ich, dass ich es einfacher habe, darüber zu sprechen, da ich das Ganze aus der nötigen zeitlichen Distanz sehen kann. Nun versuche ich der nächsten Generation unsere Geschichte weiterzugeben und komme dabei selbst an meine Grenzen. Wie spricht man darüber? Wie erzählt man eine solch grausame Geschichte weiter? Es ist nicht einfach, die passenden Worte dafür zu finden. Es sind nun mehrere Generationen her, aber es fühlt sich beim Berichten letztlich so an, wie wenn man selbst dieses Schicksal erlitten hätte.
Wie weit hat die Aufarbeitung dieser Themen mit der Tatsache zu tun, dass Sie selber Mutter sind? Oder anders gefragt; Hätten diese Themen mit gleicher Dringlichkeit angeklopft, hätten Sie keine eigenen Kinder?
Bevor ich mich entschied, diese Geschichten niederzuschreiben, lag ich wegen Corona im Bett. Mir ging es richtig mies. Da wurde mir bewusst, falls ich morgen sterben würde, würden meine Kinder die Wahrheit über ihre Wurzeln nie erfahren. Irgendwie war ich ihnen eine Erklärung oder Antwort schuldig. Hinzu kommt, dass ich aus diesem Schweigen, das mich starr machte, endlich ausbrechen wollte. Das konnte ich nur tun, indem ich die Geschichte der nächsten Generation weitererzählte. Im Endeffekt kann ich aber nicht abschliessend sagen, ob ich dieses Buch auch ohne Kinder fertiggebracht hätte. Jedenfalls hätte ich auch ohne eigene Kinder in der Vergangenheit recherchiert und nachgebohrt.
Die Türkei nennt sich zwar Republik, aber zumindest aus meiner Warte gleicht Recep Tayyip Erdoğans Politik viel mehr einer autokratischen Regierungsform, die wenig Widerspruch oder Oposition erlaubt. Minderheiten scheinen es sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart schwer zu haben. In ihrem Roman schildern sie die Angst ihrer Familie, dass mit dem Buch unschöne Dinge an die Oberfläche gelangen. Müssen Sie nicht viel mehr befürchten, dass ihre zukünftigen Besuche in der Türkei schwieriger werden?
Warum sollte ich? Ich stelle niemanden an den Pranger.
Eine Freundin von mir ist Mutter geworden. Sie ist Einzelkind und ihre Eltern wohnen weit weg. Die Eltern ihres Mannes sind im Altersheim. Auch er hat keine Geschwister. Eine kleine Familie. Von Sippe keine Spur. Die Familie meiner Frau ist ein dicker Teppich aus Beziehungen. So sehr Sippen, grosse Verwandtschaften Sicherheiten bieten, ein Eingebettetsein, Heimat, so sehr kann eine Sippe einengen, eine Rolle aufzwingen.
Möglicherweise verstehe ich Ihre Frage nicht. Aber ja, ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen und innerhalb dieses Kreises genoss und geniesse ich nach wie vor viele Freiheiten. Ich erlebe die Beziehung in meiner Familie als sehr respektvoll. Selbst, wenn wir anderer Meinung sind, sind wir füreinander bedingungslos da. Ich bin nach dem Motto aufgewachsen: Mensch ist Mensch, er ist mit all seinen Ecken und Kanten okay, so wie er ist. Aber das ist in meiner Familie so. Ich kann nicht stellvertretend für alle grossen Familien oder im Namen der Zaza sprechen.
Unabhängig von der Grösse der Familie und der herrschenden Kultur, gilt in allen Familien das Anna-Karenina-Prinzip oder was meinen Sie?
Ihr Buch ist auch ein Buch über das Schicksal einer Minderheit in der Türkei. Ein Kapitel, das auch mit der Entschuldigung der türkischen Regierung 2011 kein Ende gefunden hat, denke man nur an das Schicksal anderer Kurden oder das der Armenier. Warum blüht der Nationalismus in einer Zeit, in der man doch eigentlich merken sollte, dass Grenzen und Abgrenzungen willkürlich und nie aus einer echten Not entstehen?
Alle unterdrückten Minderheiten haben eine Entschuldigung und eine Aufarbeitung der Vergangenheit verdient. Ich bin mit meiner Geschichte über die Zaza nicht einzigartig. Sie ist leider eine von vielen. Gerade jüngst wurde darüber berichtet, dass eine deutliche Mehrheit der Australier in einer Volksbefragung gegen die Stärkung der Rechte der Aborigines stimmte. Dies in einem fortschrittlichen Land wie Australien.
Das Buch steht für alle Minderheiten, die von einer Mehrheit unterdrückt, missachtet und überstimmt werden. Ich bin bereit mein Gesicht und meinen Namen dafür herzugeben. Ich habe weder ein politisches Motiv noch führe ich Krieg gegen eine Mehrheit.
Özlem Çimen, geboren 1981 und aufgewachsen in Luzern, lebt mit ihrer vierköpfigen Familie in Zug. 2012 schloss sie den Master in Education in Special Needs an der Pädagogischen Hochschule Luzern ab und ist als Heilpädagogin im Kanton Luzern tätig.
Beitragsbild © Ayse Yavas



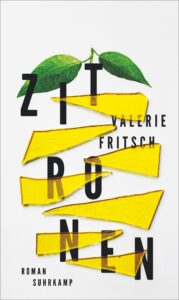










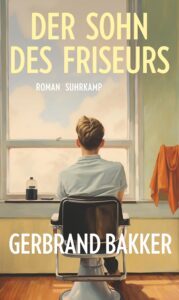


 Du hattest nie die Intention, eine Biographie zu schreiben. Und trotzdem hat die Buchtaufe unweit des Geburtsorts der Protagonistin bewiesen, wie sehr Du den Nerv dieser Existenz, dieser Zeit getroffen hast. Du hast ein Stück Stellvertretergeschichte geschrieben. Du hast genau soviel Fiktion miteingeschrieben, in das sonst nur undeutliche Bild einer starken Frau hineingestickt, dass sämtliche BesucherInnen dieser Veranstaltung das Gefühl hatten, Du hättest ein Denkmal gesetzt. Auch ein Denkmal für all die Frauen, die in der Fremde vergessen gingen.
Du hattest nie die Intention, eine Biographie zu schreiben. Und trotzdem hat die Buchtaufe unweit des Geburtsorts der Protagonistin bewiesen, wie sehr Du den Nerv dieser Existenz, dieser Zeit getroffen hast. Du hast ein Stück Stellvertretergeschichte geschrieben. Du hast genau soviel Fiktion miteingeschrieben, in das sonst nur undeutliche Bild einer starken Frau hineingestickt, dass sämtliche BesucherInnen dieser Veranstaltung das Gefühl hatten, Du hättest ein Denkmal gesetzt. Auch ein Denkmal für all die Frauen, die in der Fremde vergessen gingen.