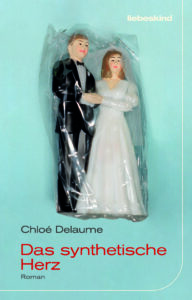Ein Ehepaar fliegt nach Sizilien. Es sollen nicht nur ein paar Tage Ferien werden. Die Tage sollen die Ehe, oder was davon übrig geblieben ist, retten oder wenigstens kitten. Aber schon auf dem Weg zum Hotel werden die Tage zu einer Katastrophe, die das Paar in ihren Grundfesten erschüttert.
Der Roman „Taormina“ zählt etwas mehr als hundert Seiten. Auch wenn Yves Ravey die Dimensionen dieser Katastrophe nicht episch ausrollt, sticht das Geschriebene mitten ins Herz. Nicht nur wegen der Intensität und der maximalen Verknappung, sondern weil es Yves Ravey schafft, auf diesen wenigen Seiten gleich mehrere gesellschaftliche Themen zur Kernschmelze zu bringen.
Luisa und Melvil haben Ferien dringend nötig. Ziel ist die antike Hügelstadt Taormina an der Ostküste Siziliens. Eine Woche in einem feinen Hotel mit Ausflügen im Mietauto nach Catania und Syrakus. Die Zeit vor dem Kurzurlaub war nicht nur beruflich belastend. In der Ehe der beiden schwelt der Konflikt. Man ist dünnhäutig geworden. So wie auf der Insel ein Vulkan noch dosiert ausbricht, so speit jeder in dieser Ehe gerade so viel Gift und Galle, dass es nicht zum grossen Ausbruch kommt. Die Woche auf Sizilien soll eine Atempause sein, eine Möglichkeit, mit der Versöhnung wenigsten zu beginnen, Ruhe zwischen sie zu bringen.
Nachdem sie am Flughafen das Mietauto in Empfang genommen hatten, fahren sie Richtung Taormina. Es ist schon spät, die Nächte im Hotel bezahlt. Man erwartet sie. Aber weil Melvil genau spürt, dass er sich in diesen Tagen an den Wünschen seiner Frau orientieren muss, fährt er von der Autobahn ab, weil Luisa, das Meer nicht nur sehen, sondern spüren will. Aber der Schotterweg Richtung Meer entpuppt sich als Weg ins Nirgendwo, vorbei an Bauschutt, durch schlammige Pfützen. Melvil nippt an einer provisorischen Bar, die an Werktagen wahrscheinlich Bauleute bewirtet, einen Espresso, während Luisa in der anbrechenden Dämmerung einen Weg zum Wasser sucht.
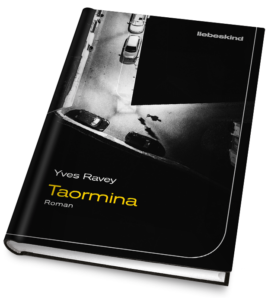
Holger Fock und Sabine Müller, 112 Seiten, CHF ca. 28.90, ISBN 978-95438-168-5
Und dann, beide schon leicht genervt, wieder im Auto auf dem Weg zurück auf die Strasse nach Taormina, rumpelt es mit einem Mal. Melvil am Steuer für einen kurzen Moment unkonzentriert, Luisa durchgefroren, weil sie Regen und Wind zurück ins Auto trieb. Beide spüren den Ruck, wissen im Moment des Aufpralls, dass sie hätten stehen bleiben sollen. Aber so wie es in ihrer Ehe schon lange kein Innehalten mehr gab, weil man sich nicht aufhalten lassen wollte, weil man dachte, das eigene Leben nie aus der Selbstbestimmung geben zu wollen, fahren sie weiter, das Schlimmste ahnend, sich gegenseitig beschwichtigend.
Am nächsten Morgen, nach einer kühlen Nacht im Mietauto, kommen sie im Hotel an. Mittlerweile haben sie aus der Presse erfahren, dass an der Küste ein Flüchtlingskind zu Tode gefahren wurde. Zwischen den beiden breitet sich eine klebrige Suppe aus gegenseitigen Vorhaltungen und Beschuldigungen aus. Man beschwichtigt und tröstet sich mit fadenscheinigen Argumenten, es müsse doch gar nicht ihr eigenes Unglück gewesen sein. Aber weil Melvil alles daran setzt, in einer Autowerkstatt den Schaden ungeschehen machen zu lassen und der Garagist sehr wohl merkt, dass der Fremde mit seinem Ansinnen finanziell leicht zu schröpfen ist, als die Polizei in ihr Hotelzimmer eindringt, das Geld langsam knapp und die Gereiztheit zwischen den Eheleuten unerträglich wird, zieht sich die Schlinge immer enger zu.
Ein Flüchlingskind wir durch Touristen zu Tode gefahren. Korrupte Polizisten, gierige Handwerker, falsche Freunde. Wann wird aus dem Unglück Katastrophe? Warum schafft man es nicht, im richtigen Moment vom falschen Zug abzuspringen, einer unweigerlich desaströsen Dynamik zu entfliehen? Warum wollen wir uns mit Beschwichtigungen trösten? Warum ist es so schwierig, Fehler einzugestehen?
Luisa und Melvil rasen auf einen Abrund zu. Und selbst in jenen Momenten, in denen sie wissen müssten, dass der Pfeil längst abgefeuert ist, halten sie sich an einer Hoffnung fest, die den Zustand unserer Gesellschaft widerspiegelt. „Taormina“ von Yves Ravey tut weh, muss wehtun.
Yves Ravey, 1953 in Besançon geboren, arbeitete lange Jahre als Lehrer an einer Mittelschule. Er ist Autor von siebzehn Romanen, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Seine Theaterstücke kamen in Frankreich an vielen renommierten Bühnen zur Aufführung, u.a. an der Pariser Comédie-Française und am Théâtre national de Marseille. Auf Deutsch erschienen bislang die Romane «Bruderliebe» (2012) und «Ein Freund des Hauses» (2014).
Sabine Müller studierte Ethnologie, Malaiologie und Soziologie an der Universität zu Köln, sowie Indonesisch an der Gadjah Mada Universität in Yogyakarta. Sie ist sowohl als Übersetzerin für Englisch und Indonesisch als auch als Redakteurin in Köln tätig.
Holger Fock, geboren 1958 in Ludwigsburg, studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie und übersetzt seit 1983 französische Literatur, zuletzt zusammen mit seiner Frau Sabine Müller «Kompass» von Mathias Énard, was ihm die Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 einbrachte. 2011 erhielt er den Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis.
Beitragsbild © Mathieu Zazzo