Während ein Grossteil der Verwandtschaft von Cécile Wajsbrot als Juden in den Jahren des Weltkriegs in den Vernichtungslagern ums Leben kam, gelang ihrem Vater zuerst, später auch ihrer Mutter, die Flucht nach Frankreich. Obwohl Cécile Wajsbrot in Paris aufwuchs und zur Schule ging, ihr Leben sich dort abzuspielen schien, zeugt ihr ganzes literarisches Werk vom Trauma einer gestohlenen Geschichte, einer nicht zu tilgenden kollektiven Vernichtungstat.
Cécile Wajsbrot will mit ihren Büchern nicht unterhalten. Somit ist auch die Lektüre ihres 2008 erstmals erschienenen Romans „Mémorial“ keine Unterhaltung, sondern Auseinandersetzung. Als ich ihren Roman damals las, schien er bei weitem nicht jene Resonanz zu erzeugen, wie er es fünfzehn Jahre später tut. Das mag mit mir selbst zu tun haben, mit meinem Alter, dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, zu wissen, woher der Fluss kommt, in dem man schwimmt, dem Fliessen, das irgendwann in ein unendlich grosses Meer münden wird. Vielleicht aber auch mit den Geschehnissen in all den Kriegen, dem Wissen, das dort überall Menschen in Todesangst fliehen, um an einem anderen Ort etwas Neues zu beginnen. Auch wenn es abgebrochen sein wird. Auch wenn die Herkunft genommen wurde. Auch wenn mit allen Mitteln versucht wird zu vergessen, die Schrecken hinter sich zu lassen.
– Wir haben mehrere Leben gehabt.
– Sind mehrmals weggegangen.
– Aber nie angekommen.
Cécile Wajsbrot reist mit dem Zug dorthin, von wo ihre Eltern damals flohen. Die Stadt Kielce im Südosten Polens. Eine Stadt, in der der Jüdische Fiedhof lange ein Fussballplatz war und kaum etwas an die Gräuel des Krieges und darüber hinaus erinnerte. „Mémorial“ ist ein Mahnmal gegen das Vergessen. „Mémorial“ ist die Auseinandersetzung der Generation danach, die den unausgesprochenen Schrecken in der Familie eingepflanzt bekam, die sich selbst mit der Auseinandersetzung nicht befreien kann von dem, was die direkt betroffene Generation einfach nur vergessen, begraben und ruhen lassen wollte. „Mémorial“ ist ein langer Dialog mit den verschiedenen Stimmen der Erinnerungen, Stimmen des Unterbewusstseins und all jener, die man als Erinnerungen mit sich herumträgt; den Vater und seine Schwester, die beide später an Alzheimer erkrankten und in ein schwarzes Loch des Vergessens fielen, an ihre Mutter, die den Tod zweier Geschwister wie einen Mühlstein mit sich herumtrug. Und „Mémorial“ ist der Versuch zu verstehen.
Ich hatte immer den Eindruck gehabt, irrtümlicherweise da zu sein, und dieses Gefühl nahm ich überallhin mit, wohin ich ging.

Schon auf dem Bahnhof holen sie Stimmen ein, packt sie der Zweifel und die Mahnung, sie, die alleine reist, von Paris über Warschau nach Kielce. Fast 2000 Kilometer zurück in die Zeit in die Stadt am Fluss, in permanentem Dialog mit Stimmen, die auftauchen und verschwinden, manchmal, als wäre da jemand, der sie begleitet. Wie die Frau aus Oświęcim, dem Ort, der als Auschwitz wie Hiroshima Synonym für sie Schrecken des 20. Jahrhunderts ist und bleiben wird. Mahnungen, die nicht verhindern konnten, dass im 21. Jahrhundert weiter Kriege Mensch und Landschaften auf Generationen hinaus verwüsten. Die Stadt, in der sie ein Hotelzimmer bezieht, ist längst nicht mehr jene, aus der ihre Eltern damals flohen und fast alles zurückliessen. Unter den Menschen könnten die sein, die damals zu den Täter gehörten, bei der Deportation Tausender Juden, beim Friedhofsmassaker von Kielce, bei dem die letzten 45 Kinder von den Besatzern auf dem Friedhof erschossen wurden oder von jene, die nach dem Krieg 1946 im Progrom von Kielce, als man über 40 überlebende Juden ermoderte, nachdem ein Vater das Gerücht in Umlauf gesetzt hatte, sein Junge sei Opfer einer Entführung geworden.
Euer Schweigen wog ebenso schwer wie Worte und vielleicht noch schwerer, denn man konnte sich alles vorstellen.
Reisen ist eine einfache Sache, aber nicht an den Ort des Grauens zurück. Die Autorin weiss, dass es kein Zurückkehren gibt, weil es in der Zeit kein Zurück gibt. Erinnern ist der Versuch des Reisens in die Vergangenheit. Eine notwendige Reise, um den Lauf der Zeit verstehen zu können. Cécile Wajsbrots Reise ist eine mehrfache Reise. Die Reise an den Ort, von dem ihre Eltern einst flohen, eine Reise in die Vergangenheit, eine Reise zu den Fragen, die nicht verstummen, eine Reise an den Fluss, im Wissen darum, dass selbst der Tod den Schrecken nicht löscht.
„Mémorial“ ist Erinnern. Einmalig gut.
Cécile Wajsbrot, geb. 1954, lebt als Romanautorin, Essayistin und Übersetzerin aus dem Englischen und Deutschen in Paris und Berlin. Sie schreibt auch Hörspiele, die in Frankreich sowie in Deutschland gesendet werden. 2007 war sie Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie der Akademie der Künste in Berlin. 2014 erhielt sie den Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis, 2016 den Prix de l`Académie de Berlin.
Sabine Müller, geb. 1959 in Lauffen am Neckar, übersetzt seit 25 Jahre aus dem Englischen und mit Holger Fock aus dem Französischen u.a. Werke von Patrick Deville, Mathias Enard, Philippe Grimbert, Pierre Loti, Alain Mabanckou, Andreï Makine, Erik Orsenna, Pascal Quignard, Jean Rolin, Olivier Rolin und Cécile Wajsbrot.
Holger Fock, geboren 1958 in Ludwigsburg, studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Er übersetzt seit 1983 französische Belletristik und wissenschaftliche Literatur, u. a. Gegenwartsautoren wie Andreï Makine, Cécile Wajsbrot (beide zusammen mit Sabine Müller), Pierre Michon und Antoine Volodine. 2011 wurde er zusammen mit Sabine Müller mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet. Er lebt bei Heidelberg.
Sabine Müller und Holger Fock wurden 2011 für ihr gemeinsames Werk mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis ausgezeichnet.
Rezension von «Zerstörung» auf literaturblatt.ch
Beitragsbild © privat



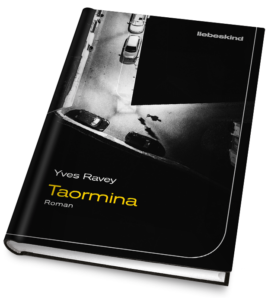

 “Er dachte immer, es genüge, recht zu haben, und genau damit lag er falsch. Er glaubte, es genüge, mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Taten, körperlichem Mut, Rechtschaffenheit, Vernunft. Er ist ein antiker Held, ein Mann Plutarchs“
“Er dachte immer, es genüge, recht zu haben, und genau damit lag er falsch. Er glaubte, es genüge, mit gutem Beispiel voranzugehen, mit Taten, körperlichem Mut, Rechtschaffenheit, Vernunft. Er ist ein antiker Held, ein Mann Plutarchs“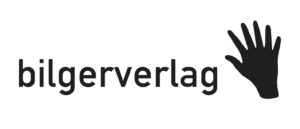 Bilgerverlag? Der Verlag mit dem Finger mehr? 2001 wurde der Verlag von Ricco Bilger und Kurt Heimann gegründet. Urs Augsburger und Urs Mannhart wurden in dem kleinen Verlag gross. Ein erstaunliches Unternehmen, das Bücher in einem unverwechselbaren Kleid entstehen lässt. Buchkunst, die viel Leidenschaft, eben einen Finger mehr als alle andern zeigt! Ein Verlag mit ungebrochenem Mut und eigenständigem Gesicht!
Bilgerverlag? Der Verlag mit dem Finger mehr? 2001 wurde der Verlag von Ricco Bilger und Kurt Heimann gegründet. Urs Augsburger und Urs Mannhart wurden in dem kleinen Verlag gross. Ein erstaunliches Unternehmen, das Bücher in einem unverwechselbaren Kleid entstehen lässt. Buchkunst, die viel Leidenschaft, eben einen Finger mehr als alle andern zeigt! Ein Verlag mit ungebrochenem Mut und eigenständigem Gesicht! Patrick Deville, geboren 1957, ist ein französischer Schriftsteller. Nach Studien und der vergleichenden Literatur und der Philosphie in Nantes hat Deville im Nahmen Osten, Algerien und in Nigeria gelebt. In den neunziger Jahren hielt er sich in Kuba und anderen lateinamerikanischen Ländern auf. Er publiziert seit den achtziger Jahren. Seine Romane «Pura Vida» und «Äquatoria» wurde ins Deutsche übersetzt. Sein Roman «Kampuchéa» wird im Jahr 2011 von der Zeitschrift Lire zum besten französischen Roman des Jahres ernennt. Sein vorletzter Roman «Peste et Choléra» aus dem Jahr 2012 handelt von dem Bakteriologen Alexandre Yersin.
Patrick Deville, geboren 1957, ist ein französischer Schriftsteller. Nach Studien und der vergleichenden Literatur und der Philosphie in Nantes hat Deville im Nahmen Osten, Algerien und in Nigeria gelebt. In den neunziger Jahren hielt er sich in Kuba und anderen lateinamerikanischen Ländern auf. Er publiziert seit den achtziger Jahren. Seine Romane «Pura Vida» und «Äquatoria» wurde ins Deutsche übersetzt. Sein Roman «Kampuchéa» wird im Jahr 2011 von der Zeitschrift Lire zum besten französischen Roman des Jahres ernennt. Sein vorletzter Roman «Peste et Choléra» aus dem Jahr 2012 handelt von dem Bakteriologen Alexandre Yersin.