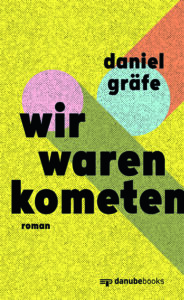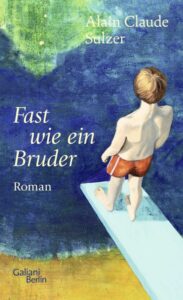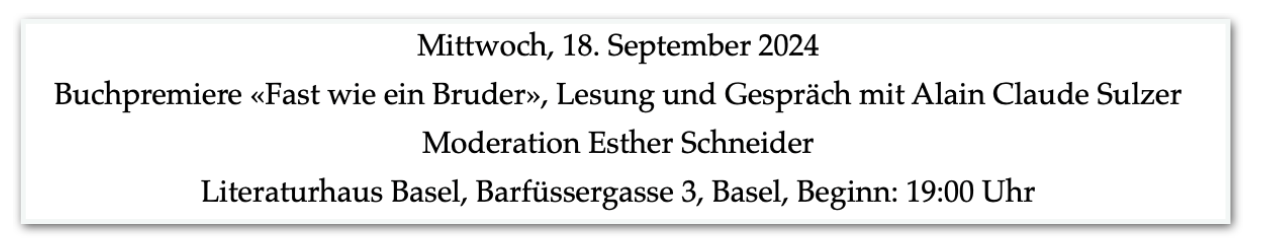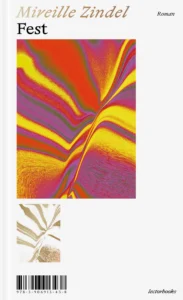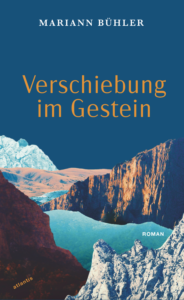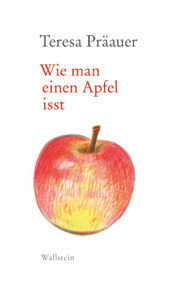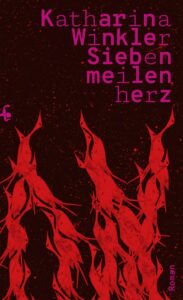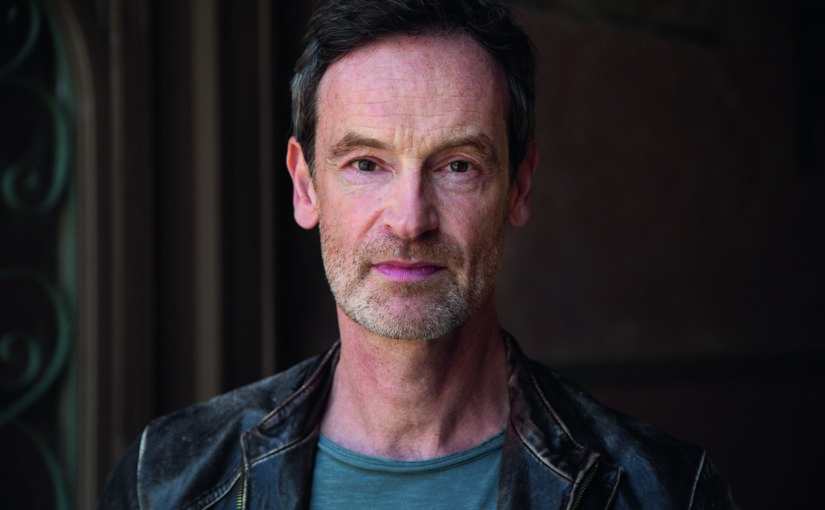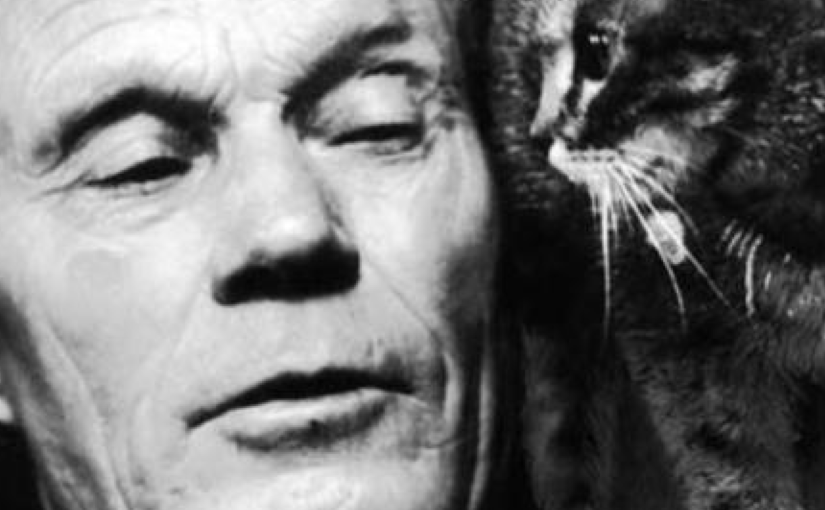Bei vielen Leserinnen und Lesern scheint die Frage, ob ein Buch ein Stück abgebildeter Realität sei, eine wahre Geschichte, oder reine Fiktion, ein Spiel mit Realem, so zentral wie nie zuvor. Evelina Jecker Lambreva treibt eben diese Spiegelungen zwischen Realem und Fiktionalem bis auf die Spitze – erfrischend und mit tiefgründigem Scharfsinn.
Fabiana Bianchi ist eine angesagte Krimiautorin. Ihre Bücher scheinen ein nach Crime hungerndes Publikum längst von selbst zu finden. Wo sie auftritt, füllt sie Säle, ihre Bücher verkaufen sich sensationell. Sie geniesst ihren Erfolg, ist sich ihrer Wirkung auch auf der Bühne sicher, geniesst die Zuwendungen ihrer Fans. Aber bei der Präsentation ihres neusten Romans meldet sich während der Lesung ein Mann in der ersten Reihe und behauptet, sie habe die Geschichte im Buch gestohlen, das sei seine Geschichte und er sei nie gefragt worden, ob sie so einfach Gegenstand eines Buches werden dürfe; die Geschichte einer zerrütteten Familie, eines Verbrechens. Und als er ihr beim Signieren mit einem Prozess droht und sie auch auf den darauf folgenden Lesungen in den Metropolen Europas verfolgt, wird aus dem Vorwurf, den Drohungen ein Alp, der Fabiana Bianchi bis ins Mark erschüttert. Fabiana weiss nicht, wie ihr geschieht.
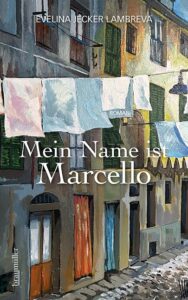
Eine sehr plausible Situation, gibt es doch im Literaturbetrieb immer wieder solch wirre und unkontrollierbare Situationen, die nicht nur ein Buch verhindern, sondern Schreibenden ihre Existenz rauben können. Aber während der Lektüre wird sehr schnell klar, dass es Evelina Jecker Lambreva nicht in erster Linie darum geht, wie Literatur mit Realem umzugehen hat. Sie erzählt auch die Geschichte von Paolo Privoli, eines erfolgreichen Kunsthändlers, der es mit Geschick und Glück von ganz unten bis nach ganz oben geschafft hatte. Er, der sich auch für Literatur interessiert, ein leidenschaftlicher Leser der Kriminalromane von Fabiana Bianchi ist, sitzt in seiner Stadt in der ersten Reihe und muss feststellen, dass die Frau, die er nur aus Büchern kennt, seine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, von der niemand, höchstens seine engsten Vertrauten wissen sollten. Die Geschichte eines Mannes, der als Kind seinen kleineren Bruder durch seine unstillbare Lust nach Macht ins Unglück treibt. Von einer Mutter, die nicht zu lieben vermag, einem Vater, der sich in seiner Verzweiflung umbringt und einem Grossvater, der zum Tyrannen wird. Eine Vergangenheit, eine Geschichte, die er nicht nur durch fünf Jahre Gefängnis hinter sich lassen wollte.
Fabiana Bianchi kann sich die Vorwürfe des Mannes nicht erklären und sämtliche Versicherungen, die Geschichte sei ganz und gar ihrer Fantasie entsprungen, perlen an dem aufgeschreckten Mann ab. Im Laufe des Romans entwickelt sich eine Art Duell. Dort die Frau, die sich an den Alp in ihrer Kindheit zurückgedrängt fühlt, dort der Mann, der glaubte, sein Leben in absolute Kontrolle getaucht zu haben und feststellen muss, dass ein Buch sein ganz eigenes Trauma offenbart.
Aber dabei bleibt es nicht. Evelina Jecker Lambrevas Roman zwischen Krimi und Verwirrspiel, zwischen Familiengeschichte und Vergangenheitsbewältigung stellt zwei Menschen einander gegenüber, die sich beide auf ihre Weise mit ihrer Kindheit, den dunklen Flecken in ihrer Vergangenheit konfrontiert sehen. Bin ich der, den ich mit Akribie selbst inszeniere oder doch nicht durch die Poren meiner Fassade das, was ich nie zu verdauen in der Lage war? Evelina Jecker Lambrevas Wissen um die Vielschichtigkeit menschlichen Seins macht das Spiegellabyrinth, durch das ich mich als Leser winde, verständlich. Unser Innenleben ist verschachtelt, voller dunkler Sackgassen und tückischer Geheimnisse.
„Mein Name ist Marcello“ ist voller Überraschungen, liest sich wie ein Thriller, der sich immer und immer wieder meinen Interpretationen verweigert. So wie die menschliche Seele ein Labyrith ist, so gibt sich die Lektüre dieses Romans.
Interview
„In each of us there is another whom we do not know…“, ein Zitat von C. G. Jung, ist Deinem Roman vorangestellt. Wären wir uns dessen mehr bewusst, wäre das Verständnis für die Schattenseiten anderer wohl viel grösser. Du bist Psychiaterin, Psychotherapeutin und Schriftstellerin und damit prädestiniert, den Spalt hinter Fassaden zu finden. Ist das Schreiben auch ein Ventil?
Ein Ventil? Mein Beruf hat mich zwar schon immer zum Schreiben inspiriert, mit den Themen, die sich aus den Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten ergeben, aber das Schreiben als Ventil habe ich noch nie gebraucht. Ich wüsste auch nicht, wozu ich ein Ventil bräuchte. Viel mehr dient mir das Schreiben für die persönliche Auseinandersetzung mit mir selbst, indem ich versuche, eben diese „andere“, die in mir verborgen ist, kennenzulernen. Für mich habe ich sogar die Worte von C.G. Jung so perephrasiert: „In jedem von uns lebt noch einer/eine, den/die wir nicht sein wollen.“ Genau diese möchte ich durch das Schreiben besser kennenlernen: die ich nicht sein möchte, die aber trotzdem irgendwo (auch) mein Inneres bewohnt.
Fabiana Bianchi ist eine überaus erfolgreiche Krimiautorin. Derer gibt es viele, man denke an Donna Leon oder Charlotte Link. Autorinnen, die Buch an Buch veröffentlichen, Bestseller an Bestseller reihen und mehr als gut von ihrem Schreiben leben können. Doch eigentlich die Ausnahme, denn die meisten AutorInnen leben mehr schlecht als recht von ihrer Schriftstellerei. Aber wie jede Person, die sich im Focus einer breiten Aufmerksamkeit bewegt, hat diese Popularität auch seinen Preis. Verkauft eine erfolgreiche Künstlerin, ein erfolgreicher Künstler mit seinem Ruhm nicht auch ein Stück seines Lebens?
Natürlich tut er/sie das. Vermarktung der Intimität ist heutzutage hoch im Trend. Für mich ist es jedoch unklar, wie bewusst ein Künstler/eine Künstlerin so was macht. Ich glaube kaum, dass es viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt, die ganz gezielt ihr Leben für Geld an das Lesepublikum verkaufen. Vielleicht ist es bei einigen eher ein Bedürfnis, das eigene Leben in die Welt hinauszuschreien, hinauszuweinen, auszukotzen, mitzuteilen? Man kann dieses Bedürfnis aber auch diskret verschlüsselt und eingepackt in Figuren, Metaphern oder Allegorien ausleben, derart, dass nur der Künstler/die Künstlerin weiss, dass es sich um sein/ihr Leben handelt. Somit wird auch der finanzielle Profit eines Verkaufs fern vom Bewusstsein gehalten.

In den unendlichen Möglichkeiten menschlichen Lebens ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seinem Schreiben die Wirklichkeit eines fremden Menschen trifft, nicht so verschwindend wie man glaubt. Du als Schriftstellerin hoffst doch auch, dass Leserinnen und Leser sich in Deinen Geschichten gespiegelt sehen oder sogar wiedererkennen. Ist das nicht genau die Resonanz, die man als Schreibende erhofft?
Schriftsteller/Schriftstellerin sein, ist ein einsames Schicksal, so denke ich. Wenn ich schreibe, denke ich nie an die potentiellen Leserinnen und Leser, nicht an Rezensentinnen und Rezensenten, nicht an die Medien. Ich bin allein in der Auseinandesetzung mit meinen Gedanken, Stimmungen, Atmosphären, Heldinnen und Helden. Die Lesenden müssen sich nicht unbedingt in meinen Geschichten wiedererkennen oder sich darin gespiegelt sehen. Von mir aus können meine Figuren auch befremdend, schrecklich, sogar abstossend auf das Lesepublikum wirken. Das würde mich gar nicht stören, wenn es so wäre. Viel wichtiger ist es mir, dass ich durch meine Figuren die Leserschaft zu neuen Gedankenanstössen anregen kann. So hoffe ich auf eine Resonanz zu den Lebensthemen, die ich in meinen Werken durch meine Heldinnen und Helden behandle. Dies aber erst, wenn das Buch veröffentlicht ist, nicht während des Schreibens.
Beide Protagonisten kommen aus Familien, die ihnen nicht geben konnten, was man jedem Kind wünscht. Beide tragen einen Alp mit sich herum. Ich bin Sohn und Vater und weiss sehr genau, wie tief die Schluchten sein können, an denen man sich als Mutter oder Vater vorbeihangelt. Mittlerweile lebt eine ganze Industrie von den Auswirkungen dieser Untiefen. Und auf der anderen Seite die Literatur; Bücher, die sich in den Untiefen tummeln, Bücher, die bewusst machen. Du schreibst Deine Bücher ja auch nicht zur blossen Unterhaltung und Zerstreuung. Wo liegt das Urmotiv dieses Romans? Wie kamst Du zu dieser Idee?
Beziehungen zwischen Eltern und Kinder haben einen zentralen Platz in all meinen Werken. Vielleicht hängt das mit meinem Beruf als psychoanalytisch orientierte Psychotherapeutin zusammen, denn bei mir gehen Medizin und Literatur Hand in Hand. Das Urmotiv meines Romans kam von einem Mord, den ich als Falldarstellung an einem Studentenunterricht präsentiert habe. Während ich den Studentinnen und Studenten den Fall schilderte, lief plötzlich im Hintergrund der ganze Romanplot in meinem Kopf ab, wie in einem Film. Mehr dazu möchte ich nicht sagen, da ich nicht in eine Situation der Arztgeheimnisverletzung geraten möchte.

In Deinem Roman geht es viel um Macht. Paolo Privoli kompensiert die Machtlosigkeit, die ihn als Kind ins Abseits drängte mit der Sehnsucht, Macht auszuüben. Macht ist ein grosser Antrieb, der in Politik und Wirtschaft aber allzuoft, hauptsächlich von Männern, zu Katastrophen führt. Geniessen die Schriftstellerin die „Macht“ über ihre Leserschaft?
Ich habe nicht das Bewusstsein, Macht in irgendeiner Form auf die Leserschaft auszuüben. Wenn ich über Macht schreibe, dann ist das, weil mich Macht interessiert, insofern sie fast immer als unbewusster Kompensationsversuch von in der Kindheit erlebter Ohnmacht auftritt. Die Ohnmacht eines Kindes bewegt mich zutiefst, und was später im Verlauf des Lebens aus dieser Ohnmacht entstehen kann – diese Frage entzündet meine künstlerische Fantasie enorm. Wie sich aus einem ohnmächtigen, systematischer Gewalt ausgelieferten Kind später eine Ärztin, eine Schriftstellerin, eine Mörderin oder eine Rechtsextremistin entwickelt, das ist die Frage, die mich in meinen Texten beschäftigt. Denn das ist und bleibt für mich eines der grossen Geheimnisse des Lebens: Wieso machen psychische Traumata von in der Kindheit erlebter physischer und/oder psychischer Gewalt manche Menschen krank und (selbst)zerstörerisch, andere zu autoritären Herrschern oder gar zu monströsen Diktatoren, und andere wiederum zu hochbegabten Künstlerinnen und Künstlern, sowie zu hervorragenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Dieses Geheimnis, so denke ich, wird wohl nie von der Wissenschaft gelüftet werden.
Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und als Klinische Dozentin an der Universität Zürich. Ihr literarisches Schaffen in deutscher Sprache begründete sie mit dem Gedichtband «Niemandes Spiegel» sowie den Erzählbänden «Unerwartet» und «Bulgarischer Reigen». Bei Braumüller erschienen: «Vaters Land» (2014) «Nicht mehr» (2016) «Entscheidung» (2019) und «Im Namen des Kindes» (2022)
Beitragsbild © Alexander Jecker