Sarah Elena Müller zu Gast im Literaturhaus Thurgau
Sarah Elena Müllers Debütroman „Bild ohne Mädchen“ scheint LeserInnen genauso zu verunsichern wie die Literaturkritik, in der über das Unausgesprochene im Roman eifrigst geschrieben wird, über Pädophilie, Kindsmissbrauch. Nicht dass das Thema nicht wichtig wäre. Aber der Roman der jungen Autorin ist weit mehr als die Auseinandersetzung mit einem Tabuthema, das sonst eigentlich eher sprach- und fassungslos macht.
Sarah Elena Müllers Roman ist schwere Kost. Zum einen, weil er von mir einiges abverlangt, weil die Autorin der Kontur ihrer Figuren, dem Geschehen ganz langsam von einem traumhaft nebulösen Aussen gegen ein traumatisches Innen folgt, zum andern, weil es der Autorin nicht darum geht, dort den Täter als lüsternes Monster und hier das Mädchen als hilfloses Opfer zu zeichnen. Sarah Elena Müller geht es um die Zwischenräume. Zum einen um die fluide Welt eines Mädchens, das sich selbst überlassen ist, zum andern um die kaputte Welt eines Mannes, der die Bodenhaftung gänzlich verloren hat im Gravitationsfeld abgefahrener Gedankenwelten und den Untiefen seiner verlorenen Seele. Die Autorin schafft es, das Unsägliche zu beschreiben, die Verlorenheit einer Gesellschaft, die sich aus wahrhaften Beziehungen verabschiedet hat, in der die Zentrifugalkraft der Individualisierung aus dem Einzelnen einen einsamen Komet macht. Sie beschreibt Bilder aus den Grenzregionen zwischen Realität und Traum, zwischen den Feinheiten von Empfindungen und düsterem Alp.

Ein Bergdorf irgendwo. Der Grossvater des Mädchens ist gestorben, die Grossmutter die einzige, die dem Mädchen ein Gesicht zeigt. Die Mutter, eine verstiegene Bildhauerin, der Vater Biologe und Umweltaktivist, beide auf ihre Art nie da, selbst dann, wenn sie das Wort an das Mädchen richten. Das Mädchen bleibt mit sich allein. Allein mit einem Engel, allein mit ihrem Nachbarn, einem schrulligen Medienmann, einem ehemaligen Professor aus Berlin, mit Bildschirmen, Computern und allem möglichen Filmequiment, bei dem sie tun darf, was ihr zuhause verwehrt bleibt, zum Beispiel Bildschirmkonsum. Ege gibt ihr die Aufmerksamkeit, die ihr zuhause fehlt. Dort spielt sich Welt ab, hat selbst der Engel, den das Kind begleitet, eine Stimme. Das Mädchen hat keinen Namen, ganz im Gegenteil zu Ege und seiner Partnerin Gisela, die eigentlich genau spürt, was in den Kellerzimmern ihres Hauses geschieht, aber die Bilder von sich wegwischt.
Selbst das Bettnässen des Kindes, die schulischen Schwierigkeiten, das Fehlen von Freunden, das Schwänzen – nichts alarmiert die so sehr mit sich selbst beschäftigten Eltern, dass irgendetwas sie zum Handeln zwingen würde. Das Mädchen, mit seinem einzigen ernsthaften Gegenüber, dem Engel, mit dem sie Zwiegespräche führt, ist sich selbst überlassen. Was zu Beginn des Romans wie eine Welt in leicht zunehmender Schieflage erscheint, wird mit der Dauer des Romans immer mehr zu einer dunklen Fahrt in die Untiefen menschlichen Verlorenseins. Die Kapitel, überschrieben mit „das Kind – das Mädchen – die Tochter – die junge Frau“ begleiten ein Leben, in dem ein Trauma zum Koloss wird. Eine Erfahrung, die die Autorin in umfangereichen Recherchen mit dem Schreiben dieses Romans nachempfinden wollte. Es geht der Autorin weder um Schuldzuweisung noch um Verurteilung. Wir leben in einer Welt, in der man die Nähe zueinander verloren hat, in der Wegschauen zur Überlebensstrategie wurde. Alle in Sarah Elena Müllers Roman sind Verlorene – und vielleicht ist das das letztlich Schwere an diesem Roman; dass mich Sarah Elena Müller nicht in eine wiedergefundene Ordnung entlässt – ganz im Gegenteil.
Der eigentliche Protagonist dieses Buches ist der Sound, die Sprache. „Bild ohne Mädchen“ ist ein tiefer schwarzer Brunnenschacht, an dessen Rand man in die Tiefe lauscht und weiss, dass da unten seltsam dunkle Gesänge tönen.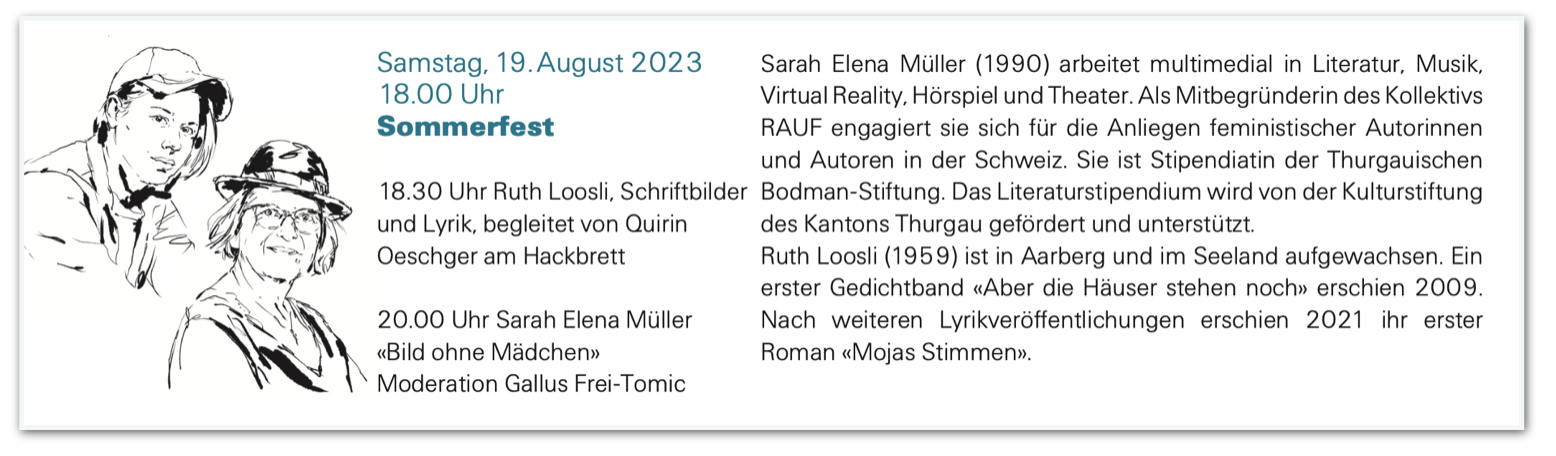
Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz. Sarah Elena Müller war 2023 Stipendiatin im Literaturhaus Thurgau.
Illustration © leale.ch / Literaturhaus Thurgau







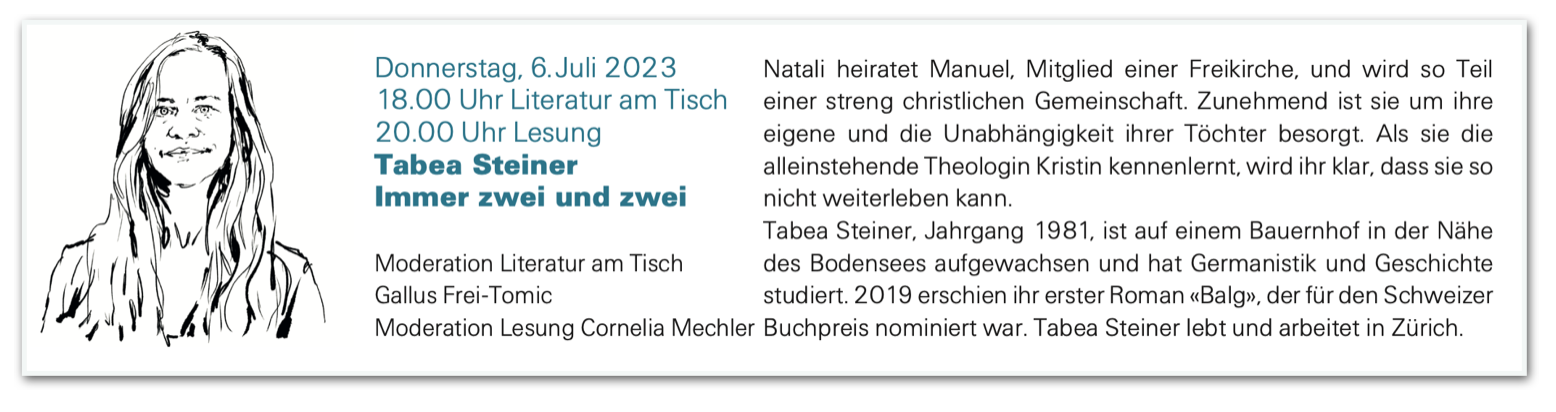
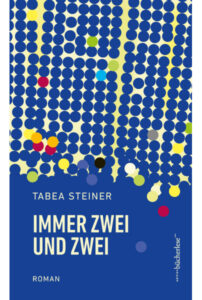







 Dagny Gioulami (*1970 in Bern, lebt in Zürich) studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich und war auf vielen Bühnen engagiert. Seit 2000 schreibt sie Libretti und Theaterstücke, u.a. für das Opernhaus Zürich. Von 2010 bis 2013 studierte sie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Ihr erster Roman „Alle Geschichten, die ich kenne“ erschien 2015 und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Literaturpreis des Kantons Bern und stand auf der Shortlist des Rauriser Literaturpreises.
Dagny Gioulami (*1970 in Bern, lebt in Zürich) studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich und war auf vielen Bühnen engagiert. Seit 2000 schreibt sie Libretti und Theaterstücke, u.a. für das Opernhaus Zürich. Von 2010 bis 2013 studierte sie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Ihr erster Roman „Alle Geschichten, die ich kenne“ erschien 2015 und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Literaturpreis des Kantons Bern und stand auf der Shortlist des Rauriser Literaturpreises. Klaus Henner Russius (*1937 in Danzig, lebt in Zürich) absolvierte eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin. In der Folgezeit hatte er Engagements in Göttingen, Düsseldorf, St. Gallen und Mannheim. Seit 1985 ist er als freischaffender Schauspieler unterwegs, unter anderem in Heidelberg, Frankfurt, Düsseldorf, Bonn und Zürich. In dieser Zeit zeigte er vielbeachtete Einmannproduktionen, hatte Sprechrollen an zahlreichen Opernhäusern und verschiedene Filmrollen. In den letzten Jahren arbeitete er als Regisseur und wurde bekannt für seine grossen Lesereihen, unter anderem von Gottfried Kellers Zürcher Novellen, Homers Odyssee und Texten von Anton Tschechow und Imre Kertész.
Klaus Henner Russius (*1937 in Danzig, lebt in Zürich) absolvierte eine Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin. In der Folgezeit hatte er Engagements in Göttingen, Düsseldorf, St. Gallen und Mannheim. Seit 1985 ist er als freischaffender Schauspieler unterwegs, unter anderem in Heidelberg, Frankfurt, Düsseldorf, Bonn und Zürich. In dieser Zeit zeigte er vielbeachtete Einmannproduktionen, hatte Sprechrollen an zahlreichen Opernhäusern und verschiedene Filmrollen. In den letzten Jahren arbeitete er als Regisseur und wurde bekannt für seine grossen Lesereihen, unter anderem von Gottfried Kellers Zürcher Novellen, Homers Odyssee und Texten von Anton Tschechow und Imre Kertész.








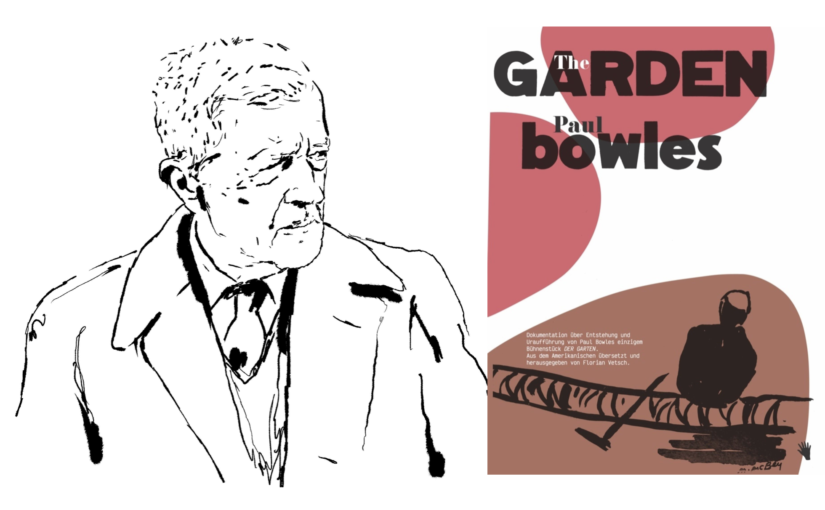
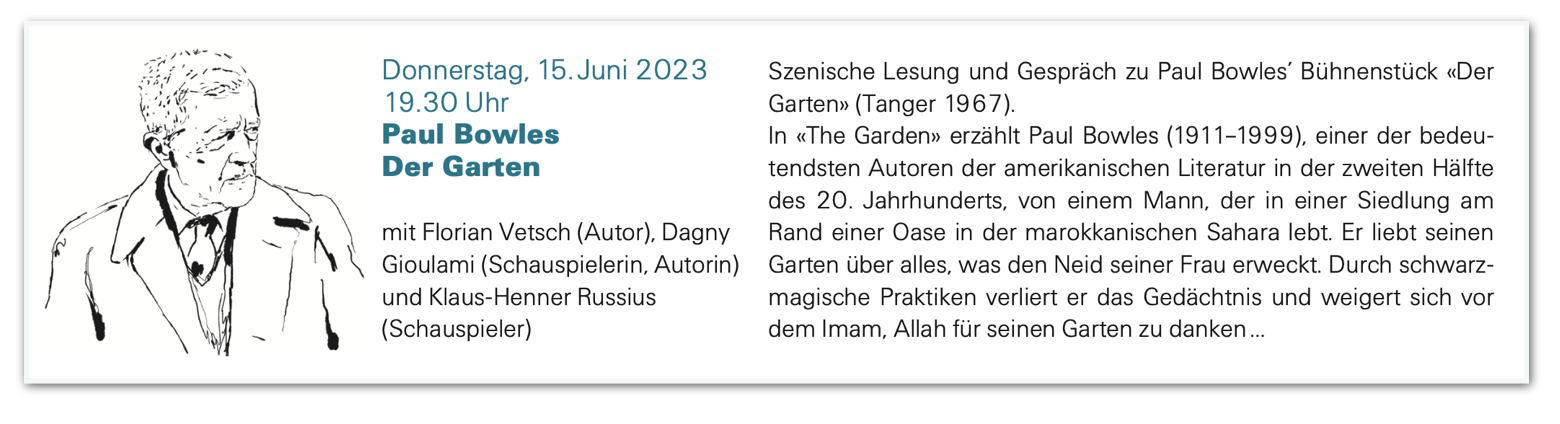
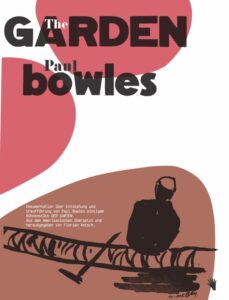




 In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.
In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt. 

