Ursula Krechel, der am 16. Internationalen Lyrikfestival in Basel der eigentliche Eröffnungsabend zur Bühne wurde, zeigte, was sie ist; eine souveräne, stilvolle Grande Dame der Literatur, eine Dichterin, die sich nur schwer einordnen lässt, nicht einmal durch Deutungen eines Literaturprofessors. Eine Ikone, eine Lichtgestalt und doch stets nah an den «Dingen» und Menschen geblieben.
Bis zu ihrem Roman «Shanghai fern von wo», der aus einem Hörspiel entstand und sich zum ersten, grossen Verkaufserfolg der Autorin entwickelte, war Ursula Krechel einem eingeweihten Kreis bekannt als Lyrikerin, Theaterautorin und Essayisten. Der Roman von 2008 über Exilanten des NS-Regimes, die nach China flüchteten und im Shanghaier Ghetto überlebten, machte sie mit einem Mal einem viel breiteren Publikum zugänglich. So wie mir, der ich nun auch die Lyrik der Autorin zu lesen begann.
2012 folgte «Landgericht», ein Roman, eine Familiengeschichte um den jüdischen Richter Dr. Richard Kornitzer, der 1947 nach jahrelangem Exil in Havanna nach Deutschland zurückkehrt und in der Konfrontation mit Schrecken und Verlust im Nachkriegsdeutschland zerbricht. Im gleichen Jahr erhielt Ursula Krechel für diesen Roman den Deutschen Buchpreis 2012, ein Preis, der für einmal mehr als verdient war.
 Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»
Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»
Über die Perspektive
«Die Welt ist voller Unruhe, alles
drunter und drüber, und noch
weiss man nichts Gewisses!»
Öden von Horváth
Einige mächtige Männer
stehen am Horizont
verdecken die Sonne
und fragen:
Wo bleibt
eure Perspektive?
Wir sagen:
Je nachdem
wo man steht
sieht man
auf den Champs Elysées
einen Dame mit Hündchen
einen rotledernen Stiefel
den Absatz eines Stiefels
oder den Dreck daran.
Je nachdem wie man blickt
sieht man auch
Bäume von weitem.
Betrachtet
die mächtigen Äste.
Der Ast einer Kastanie
erschlug hier einen Dichter.
Geht uns aus der Sonne
dann reden wir weiter
über unsere Perspektiven.
(aus «Nach Mainz!» Gedichte. Darmstadt 1977. Ebenso in «Die da» Ausgewählte Gedichte, Jung und Jung, 2013)
Seither sind ein gutes Dutzend weitere Gedichtbände erschienen, reihte sich Preis an Preis. Dichtung um die Frage: Was ist Nähe? Was ist Distanz? Wo liegt der Zugang zur Welt? Unerträglich sei ihr die Distanzlosigkeit. Um zu erkennen, brauche es Distanz. Daher wohl auch ihr Bedürfnis, in Essays über das Schreiben und Dichten, die Begegnung mit Welt nachzudenken. Ursula Krechels Gedichte sind ein Nachspüren eingefangener Gedanken, Sätze, die sie nie loslassen, Einsichten aus dem eigenen Lesen. Lesen als Welterfahrung, ein Heranarbeiten an Innenwelten, aus dem wiederum Lyrik, Text entsteht.
«Stimmen aus dem harten Kern» (2005) ist ein Gedichtband, der sich mit expressiver Männlichkeit beschäftigt; mit Kriegern, Soldaten, einem kollektiven «Wir», das damals, als der Band erschien, mit dem Krieg im Irak verzahnt war. Bilder in Sprache. Bilder, die Fotographien niemals zu erzählen vermögen. Dabei mehr als deutlich die Kritik, was koloniale Macht angerichtet hat und noch immer anrichtet. Ursula Krechel nimmt kein Blatt vor den Mund. «Ich habe Angst, ich verstehe nicht wirklich.»
Sie verführt, analysiert, sie beschreibt und singt. Sie spielt, mal mit Anspielungen, mal mit Verspieltheit.
Wie sehr Ursula Krechel dabei die Form wichtig ist, lässt sich in «Stimmen aus dem harten Kern» errechnen: Alles dreht sich um die Zahl 12: 12 mal 12 mal 12 Verse.
Simulation Heimkehrumkehr
1
Wo früher die kugelsichere Weste ummantelte, klebt nun
Die Creditcard in der Brusttasche des verschwitzten Hemdes
Dazwischen ein Langstreckenflug und eine sanfte Landung
Wir sind Heldendarsteller, verabschiedet, schlüpfen in Anzüge
Von Bankangestellten. Summen, die früher die Toten zählten
Sind an Zinssätze gekoppelt, Kids lümmeln mit Plastikpistolen
Stellungskrieg des Normalen; Hausbaukredite im freien Fall
Rasende Kopfschmerzen nachts, wir träumen von Rinderherden
Mit Stricken aneinandergefesselte Tiere, die wir für Feinde hielten
Niedergemetzelt im Irrtum, sie griffen uns an, wie wir ihnen contra
Wenn Aias schrie am Morgen ai, ai, als wäre sein Name ein Schmerz
Sind wir Aias, Mörder: schuldig und ruhiggestellt durch Tranquilizer.
(aus «Stimmen aus dem harten Kern» Jung und Jung, 2005)
Die Lücke, die Notwendigkeit auszusparen, so wie der Dialog in den Romanen der Autorin fast durchwegs ausgespart wird, braucht die Lyrikerin Ursula Krechel Sparsamkeit, die Lücke, die Auslassung das Weglassen. Ursula Krechel ist Dichterin, Verdichtern im eigentlichen Sinne. Aus dem All(es) der Sprache, dem Empfinden von Unendlichkeit bis zur Konzentration in einem Vers ist ihr Schreiben ein permanentes Suchen auf vielen Ebenen. Ursula Krechel filtert aus der Unendlichkeit sprachliche (Bau-)Prinzipien. Ihre Gedichte brechen auf.
Eintauchen!
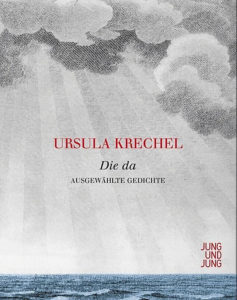 Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.
Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.
Ich danke dem Verlag Jung und Jung für die Erlaubnis, zwei Gedichte der Autorin in den Text einzufügen.
Beitragsbild © Gunter Glücklich







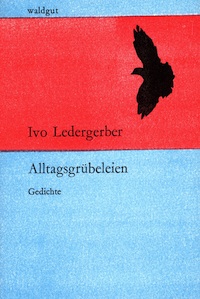 dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug.
dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug. Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.
Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.
 Ideales Beispiel dafür, wofür das Wortlaut steht, für die Verbindung von «klassischer» Literatur, Comic, Kabarett, Spoken Word und Illustration war der diesjährige Starter Andri Beyeler am 11. Literaturfestival. Ein Text wie ein Trommelfeuer, vorgetragen von einer Schauspielerin, illustriert vom Autor selbst, geschrieben wie ein Theater, Kleinstadtmythen, die sich in einem Gasthaus in existenzielle Intensitäten hinaufschaukeln. Andri Beyeler, der bisher vor allem für die Bühne schrieb und dessen Text sich auch als Buch erst dann entfaltet, wenn er laut und mit viel Dynamik gelesen wird, schuf mit «Mondscheiner» ein aussergewöhnliches Sprachkunstwerk.
Ideales Beispiel dafür, wofür das Wortlaut steht, für die Verbindung von «klassischer» Literatur, Comic, Kabarett, Spoken Word und Illustration war der diesjährige Starter Andri Beyeler am 11. Literaturfestival. Ein Text wie ein Trommelfeuer, vorgetragen von einer Schauspielerin, illustriert vom Autor selbst, geschrieben wie ein Theater, Kleinstadtmythen, die sich in einem Gasthaus in existenzielle Intensitäten hinaufschaukeln. Andri Beyeler, der bisher vor allem für die Bühne schrieb und dessen Text sich auch als Buch erst dann entfaltet, wenn er laut und mit viel Dynamik gelesen wird, schuf mit «Mondscheiner» ein aussergewöhnliches Sprachkunstwerk.




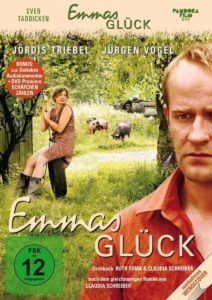 Schreiber und ihrem eben erschienenen Roman „Emmas Glück“ ein Volltreffer gelang, lud er sie mit ihrem neusten Roman „Goldregenrausch“ wieder ans „Wortmenue“ nach Überlingen. Damals begann die Erfolgsgeschichte von Claudia Schreibers Roman „Emmas Glück“, der wenige Jahre später mit der ebenso erfolgreichen Verfilmung mit den Schauspielern Jürgen Vogel und Jördis Triebel 2016 ihren Höhepunkt feierte. Eine Produktion, bei der Claudia Schreiber auch beim Drehbuch mitwirkte und die bei Presse und Publikum viel Beachtung und grossen Erfolg erntete.
Schreiber und ihrem eben erschienenen Roman „Emmas Glück“ ein Volltreffer gelang, lud er sie mit ihrem neusten Roman „Goldregenrausch“ wieder ans „Wortmenue“ nach Überlingen. Damals begann die Erfolgsgeschichte von Claudia Schreibers Roman „Emmas Glück“, der wenige Jahre später mit der ebenso erfolgreichen Verfilmung mit den Schauspielern Jürgen Vogel und Jördis Triebel 2016 ihren Höhepunkt feierte. Eine Produktion, bei der Claudia Schreiber auch beim Drehbuch mitwirkte und die bei Presse und Publikum viel Beachtung und grossen Erfolg erntete.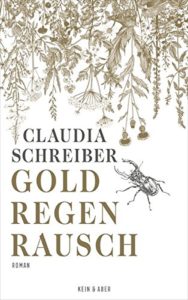



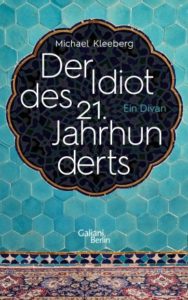





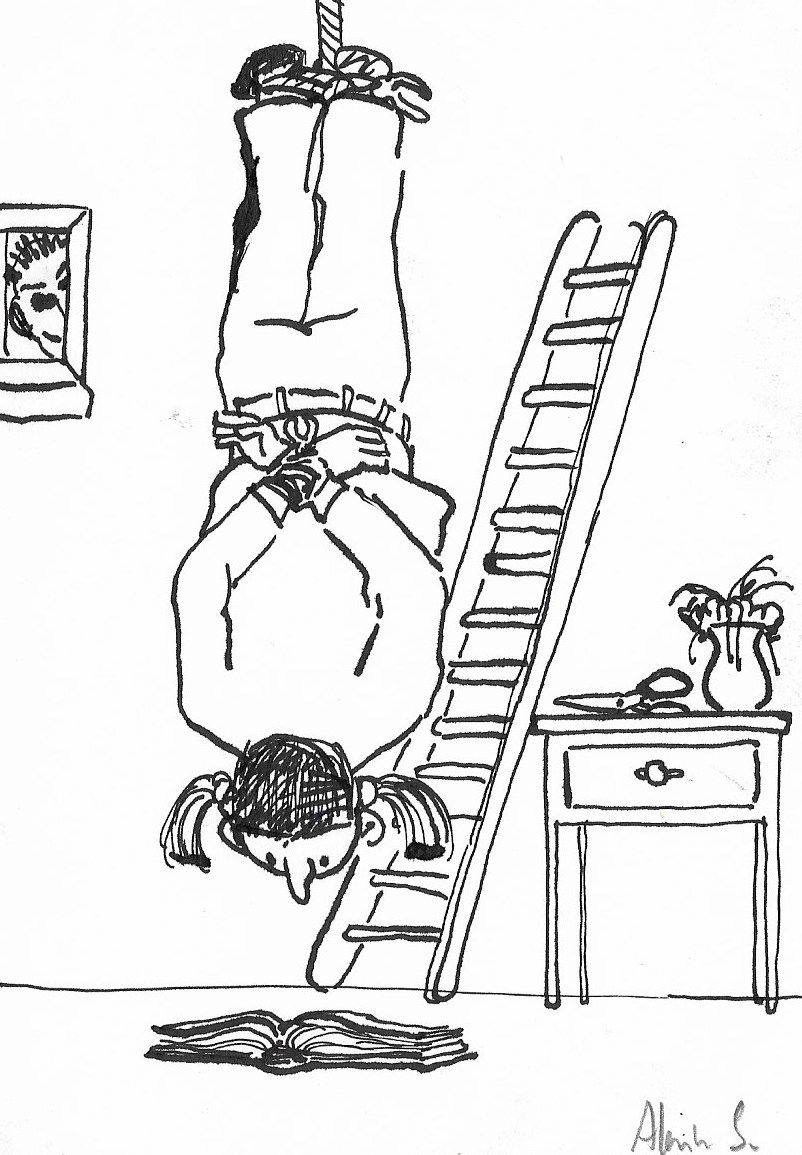

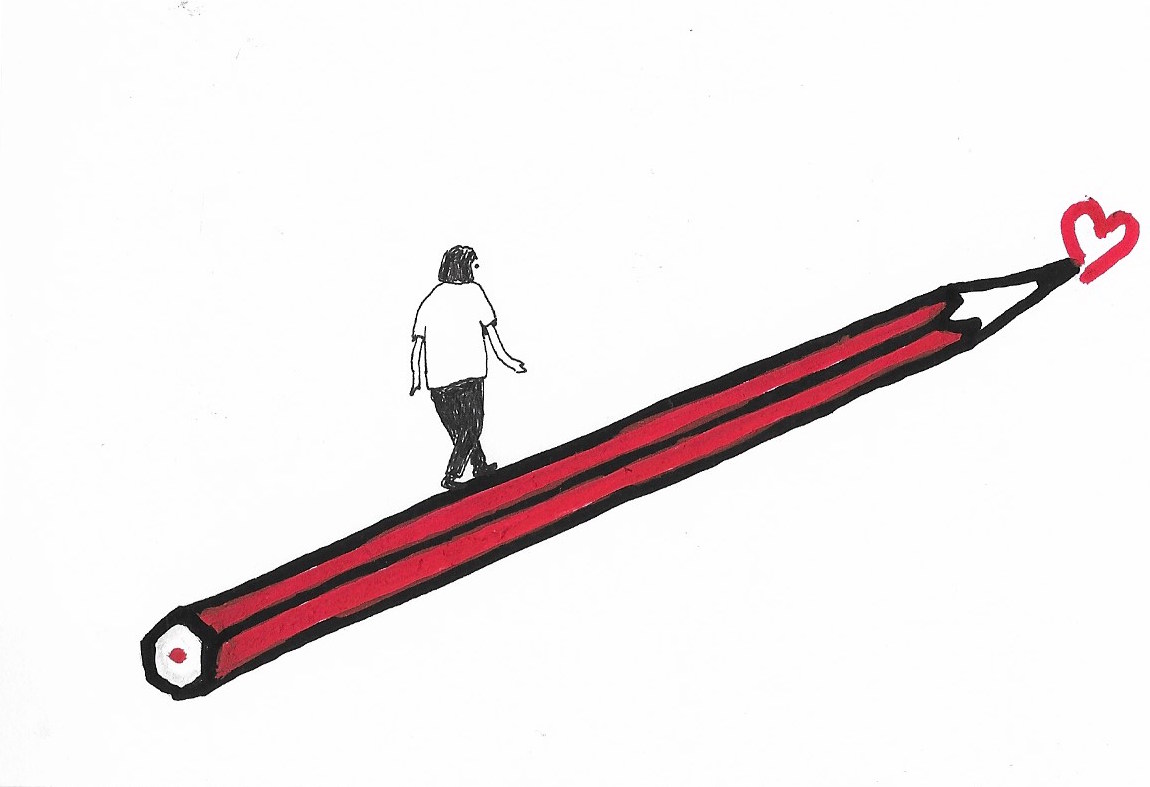


 Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»
Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»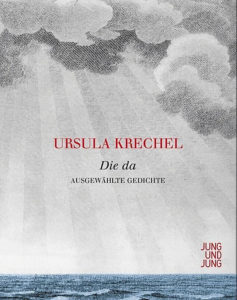 Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.
Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.


 Tabea Steiner ist angekommen, die die schon lange schreibt, sechs lange Jahre an diesem, ihrem ersten Roman. Angekommen auf jener Seite, der sie meist als Moderatorin und Gesprächspartnerin gegenübersitzt. Noch vor ein paar Tagen sass sie bie dem von ihr gegründeten Literaturfestival „Literaare“ in Thun dem grossen Michael Köhlmeier gegenüber, einem ganz Grossen der Gegenwartsliteratur, einem Mann mit umfangreichen Werk, bei dem sich das Regalbrett langsam leicht nach unten wölbt. Nun sitzt sie auf der Seite der Grossen, mit Tischen, Mikrophon und Wasserglas, auch wenn es bei ihr noch ihr Erstling „Balg“ ist.
Tabea Steiner ist angekommen, die die schon lange schreibt, sechs lange Jahre an diesem, ihrem ersten Roman. Angekommen auf jener Seite, der sie meist als Moderatorin und Gesprächspartnerin gegenübersitzt. Noch vor ein paar Tagen sass sie bie dem von ihr gegründeten Literaturfestival „Literaare“ in Thun dem grossen Michael Köhlmeier gegenüber, einem ganz Grossen der Gegenwartsliteratur, einem Mann mit umfangreichen Werk, bei dem sich das Regalbrett langsam leicht nach unten wölbt. Nun sitzt sie auf der Seite der Grossen, mit Tischen, Mikrophon und Wasserglas, auch wenn es bei ihr noch ihr Erstling „Balg“ ist.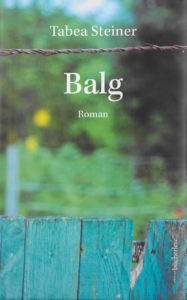 Tabea Steiner schreibt in „Balg“ von einem Dorf, einem wie sie in der Ostschweiz aufgewachsen ist, das sie kennt und eine Kindheit lang ihr ganzes Leben bedeutete. Ein paar Häuser, ein Schulhaus, eine kleine Bibliothek darin. Bewohnt von Menschen, die alle Rollen haben, so wie das Personal in ihrem Roman. Die überforderte, alleinerziehende Mutter, der ungeratene Sohn, der Briefträger, der einmal Dorfschullehrer war, bis ihn ein Beben aus seiner Bahn katapultierte, Nachbarn, Kaninchen und eine Kulisse, die immer gleich erscheint.
Tabea Steiner schreibt in „Balg“ von einem Dorf, einem wie sie in der Ostschweiz aufgewachsen ist, das sie kennt und eine Kindheit lang ihr ganzes Leben bedeutete. Ein paar Häuser, ein Schulhaus, eine kleine Bibliothek darin. Bewohnt von Menschen, die alle Rollen haben, so wie das Personal in ihrem Roman. Die überforderte, alleinerziehende Mutter, der ungeratene Sohn, der Briefträger, der einmal Dorfschullehrer war, bis ihn ein Beben aus seiner Bahn katapultierte, Nachbarn, Kaninchen und eine Kulisse, die immer gleich erscheint.

 Nach seinem vielbeachteten Roman «Am Rand» erschien 2018 sein neuster: «Drei Sekunden Jetzt». Ein Roman über ein Findelkind auf der Suche nach seiner Herkunft, seiner Identität. Hans Platzgumer, der auch Musiker und Theaterkomponist ist, erzählte, dass er bei der Lektüre von Tschechows Theaterstück «Der Kirschgarten» zweimal fast auf die gleiche Textstelle stiess, die Ursprung seines Romans wurde: «Ich weiss nicht, wie alt ich bin, und ich habe immer das Gefühl, ich bin jung. Woher ich komme, wer ich bin, wer meine Eltern waren… Ich weiss nichts. (Charlotta Iwanowa in «Der Kirschgarten von Anton Tschechowa, 1903). Es sei die Mischung aus der Melancholie des Nichtwissens und der unendlichen Chance, aller offen stehenden Möglichkeiten, die ihn beim Schreiben angetrieben hätten. Hans Platzgumer wollte einen Roman schreiben über jemanden, dessen Ankerseil gekappt ist.
Nach seinem vielbeachteten Roman «Am Rand» erschien 2018 sein neuster: «Drei Sekunden Jetzt». Ein Roman über ein Findelkind auf der Suche nach seiner Herkunft, seiner Identität. Hans Platzgumer, der auch Musiker und Theaterkomponist ist, erzählte, dass er bei der Lektüre von Tschechows Theaterstück «Der Kirschgarten» zweimal fast auf die gleiche Textstelle stiess, die Ursprung seines Romans wurde: «Ich weiss nicht, wie alt ich bin, und ich habe immer das Gefühl, ich bin jung. Woher ich komme, wer ich bin, wer meine Eltern waren… Ich weiss nichts. (Charlotta Iwanowa in «Der Kirschgarten von Anton Tschechowa, 1903). Es sei die Mischung aus der Melancholie des Nichtwissens und der unendlichen Chance, aller offen stehenden Möglichkeiten, die ihn beim Schreiben angetrieben hätten. Hans Platzgumer wollte einen Roman schreiben über jemanden, dessen Ankerseil gekappt ist. Aber François genügt die neue Familie, in die er aufgenommen wird, nicht. Da bleibt dieser Schmerz, das Offene, diese Wunde, das Nicht-wissen. Kaum erwachsen haut François ab, landet in einem seltsamen Hotel am Löwengolf, westlich der Stadt Marseille. In einem heruntergekommenen, undurchsichtigen Hotel mit Namen «Le Richard», wo er ein Zimmer, eine Arbeit, einen Hafen am Meer der Möglichkeiten bekommt.
Aber François genügt die neue Familie, in die er aufgenommen wird, nicht. Da bleibt dieser Schmerz, das Offene, diese Wunde, das Nicht-wissen. Kaum erwachsen haut François ab, landet in einem seltsamen Hotel am Löwengolf, westlich der Stadt Marseille. In einem heruntergekommenen, undurchsichtigen Hotel mit Namen «Le Richard», wo er ein Zimmer, eine Arbeit, einen Hafen am Meer der Möglichkeiten bekommt. Hans Platzgumer, geboren 1969 in Innsbruck, lebt in Bregenz. Er studierte an der Musikhochschule in Wien, absolvierte ein Filmmusik-Studium in Los Angeles und veröffentlichte in unterschiedlichen Formationen elektronische Musik. Er schreibt Romane, Hörspiele, Opern, Theatermusik und Essays. Sein Roman «Am Rand» stand 2016 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis.
Hans Platzgumer, geboren 1969 in Innsbruck, lebt in Bregenz. Er studierte an der Musikhochschule in Wien, absolvierte ein Filmmusik-Studium in Los Angeles und veröffentlichte in unterschiedlichen Formationen elektronische Musik. Er schreibt Romane, Hörspiele, Opern, Theatermusik und Essays. Sein Roman «Am Rand» stand 2016 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis.