 Über die Jahre ist Peter Stamm ganz leise ins literarische Bewusstsein der Schweiz gerutscht, mit jedem Buch ein bisschen tiefer. Schon im ersten Buchpreisjahr 2008 war Peter Stamm mit «Wir fliegen» Nominierter, 2011 mit «Seerücken». 2013 war der Thurgauer gar nominiert für den Man Booker International Prize. Und im vergangenen Jahr war es endlich soweit, eine fast schon logische Konsequenz: Peter Stamm erhält für «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» den Schweizer Buchpreis 2018.
Über die Jahre ist Peter Stamm ganz leise ins literarische Bewusstsein der Schweiz gerutscht, mit jedem Buch ein bisschen tiefer. Schon im ersten Buchpreisjahr 2008 war Peter Stamm mit «Wir fliegen» Nominierter, 2011 mit «Seerücken». 2013 war der Thurgauer gar nominiert für den Man Booker International Prize. Und im vergangenen Jahr war es endlich soweit, eine fast schon logische Konsequenz: Peter Stamm erhält für «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» den Schweizer Buchpreis 2018.

Einmal traf ich Peter Stamm an der Fährenanlegestelle in Romanshorn. Damals begleitete er die Dichterin Daniela Danz auf einem Stück ihrer Reise von ihrem Wohnort im Bundesland Thüringen nach Bern zu einer Lesung. Peter Stamm, der Spaziergänger zusammen mit der sprachgewaltigen Dichterin. Wir sassen zu dritt in einem IC Richtung Zürich, sprachen über das Schreiben und Reisen, so wie Schreiben immer eine Reise ist. Als Begleiter des Schweizer Buchpreises 2019 stellte ich dem Preisträger des letzten Jahres ein paar Fragen.
„Mein Krönchen abgeben, keine Supermärkte mehr einweihen und bei keinem Schwingfesten mehr den Muni überreichen“, schriebst du mir, als ich dich um Antworten auf meine Fragen bat, ein Jahr nach der Preisübergabe.
Gibt einem ein solcher Preis eine neue Position? So etwas wie eine Instanz? Oder bleibt bloss eine hübsche Urkunde irgendwo zwischen Schreibtisch und Haustüre? Bleibt etwas?
Die Idee des Preises war ja von Anfang an, den Verkauf von Büchern zu fördern, nicht, die Autorinnen und Autoren unsterblich zu machen. Die Literatur ist viel schnellebiger als man denkt. Der Bestseller von heute kann in zwanzig Jahren völlig vergessen sein und in fünfzig ist er es mit grösster Wahrscheinlichkeit. Oder auch nicht. Aber wenn er nicht vergessen ist, dann wohl nicht wegen Preisen, die er oder sie gekriegt hat. Selbst die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger des Nobelpreises besteht zum grössten Teil aus vergessenen Namen. Und die meisten der nichtvergessenen Autorinnen und Autoren haben den Nobelpreis nie gekriegt. Was bleibt sind einige Bücher. Ich habe übrigens keine meiner Urkunden aufgehängt, das wäre mir zu peinlich.
 Die Verleihung des Schweizer Buchpreises soll ein Medienspektakel sein. Das Radio berichtet live und im Theater Basel stehen an diesem Sonntag morgen Fernsehkameras vom SRF. Aber ein richtiges Spektakel wird der Preis vor allem in seinem Nachgang; wenn Medien kommentieren, wenn in grossen Tageszeitungen seitenfüllende Vorhaltungen publiziert werden und man wie jedes Jahr bestätigt wird, dass es wie mit jedem Wettbewerb ist; Jemand gewinnt und viele verlieren. Dabei sollte der Literaturbetrieb gewinnen. Tut er es?
Die Verleihung des Schweizer Buchpreises soll ein Medienspektakel sein. Das Radio berichtet live und im Theater Basel stehen an diesem Sonntag morgen Fernsehkameras vom SRF. Aber ein richtiges Spektakel wird der Preis vor allem in seinem Nachgang; wenn Medien kommentieren, wenn in grossen Tageszeitungen seitenfüllende Vorhaltungen publiziert werden und man wie jedes Jahr bestätigt wird, dass es wie mit jedem Wettbewerb ist; Jemand gewinnt und viele verlieren. Dabei sollte der Literaturbetrieb gewinnen. Tut er es?
Er kriegt Aufmerksamkeit und darum geht es doch. Wir wollen auch mal ein bisschen Glamour. Schreiben und Lesen sind stille Geschäfte. Politiker gehen an Sportereignisse, allenfalls noch an die Art Basel oder ein Filmfestival, ganz bestimmt nicht zu Lesungen. Ich habe in meiner ganzen Karriere erst einmal einem Bundesrat die Hand geschüttelt und das war, als er ein Buch schrieb und ich ihn moderiert habe.
Und doch sind sie wichtig, diese Preise. Nebst Publicity fliesst Geld, das AutorInnen mehr oder weniger unabhängig macht, zumindest eine gewisse Zeit, Dinge ermöglicht, die sonst nicht umsetzbar sind.
Das stimmt schon, so ein Preis kann eine Entlastung sein. Man darf nie vergessen, dass die meisten Autorinnen und Autoren grosse Mühe haben, von ihrem Schreiben zu Leben. Die Leistung, die die Literatur für das Land erbringt, wird nicht abgegolten. Die Schweiz brüstet sich gerne mit ihren grossen Autorinnen und Autoren, aber sie tut praktisch nichts für sie. Im Gegenteil: siebzig Jahre nach unserem Tod werden wir quasi enteignet, indem man unser Erbe, also unsere Urheberrechte als Allgemeingut erklärt. Und Mäzene gibt es meines Wissens auch keine mehr. Ein Literaturpreis ist eine gute Sache, aber er ändert nichts am grundsätzlichen Problem, dass man vom Schreiben kaum leben kann. Ich beklage mich nicht, ich lebe gut vom Schreiben, aber ich sehe einfach, wie viele das nicht können und sich noch nicht einmal beklagen.
Der Fernsehliteraturkritiker Denis Scheck nannte dich vor nicht langer Zeit einen „Ausnahmeautor“, einer der für seine Kunst des Weglassens ebenso gelobt werde, wie dafür, was am Schluss auf dem Papier steht. Was ich an deinen Büchern so schätze, ist aber auch das, womit sie mich nach der Lektüre zurücklassen; vielen offenen Fragen, eine Spur Ratlosigkeit und die Gewissheit, dass man Leben nicht „aufschreiben“ kann. Wird das auch in den Reaktionen deiner Leserinnen und Leser gespiegelt?

Ja, schon. Aber wenn ich dann mit den Leuten rede und ihnen erkläre, weshalb es keine „Lösungen“ geben darf in meinen Texten, verstehen sie das eigentlich immer. Natürlich gibt es auch Leute, die mit meinen Büchern nichts anfangen können, auch damit habe ich kein Problem. Ich kann ja auch mit ganz vielen Büchern nichts anfangen und das heisst nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind einfach nicht für mich geschrieben.
Du bist ein Spaziergänger. Ein Spaziergänger, der der Enge der Schreibklause entflieht, dem Lärm seiner Umgebung? Ein Spaziergänger, der sich so in die Gänge bringt? Ein Spaziergänger in der Tradition Robert Walsers?
Ich würde mich nie mit Rober Walser vergleichen wollen. Spaziergänger gibt es viele, aber Robert Walser gab es nur einen. Beim Spazieren kann ich einfach besser denken als beim sitzen. Das ist natürlich auch ein bisschen mühsam, vor allem, wenn es regnet. Ich bin einfach gerne an der frischen Luft, ich hätte wohl auch Briefträger oder Gärtner werden können. Nur schreiben kann ich dummerweise fast nur in geschlossenen Räumen. Also ist es ein ewiges Hin und Her. Rausgehen um nachzudenken, reingehen um es aufzuschreiben.
In Weinfelden aufgewachsen begann deine berufliche Karriere als kaufmännischer Angestellter und Buchhalter. Was ist davon geblieben?
Ich mache heute noch meine Buchhaltung selbst. Nur bei der Steuererklärung habe ich Hilfe. Ich bin mich gewöhnt, genau zu arbeiten. Ein Buchhalter kann nicht „fünfe grad sein lassen“. Ich weiss noch, wie mein Lehrmeister mir beibrachte, dass auch ein Fehler von nur fünf Rappen gefunden werden muss. Ich hätte liebend gerne die fünf Rappen bezahlt, aber ich musste den Fehler stundenlang suchen.
Mit Preisen wie dem Schweizer Buchpreis sollen Bücher und ihren Autorinnen und Autoren grösstmögliche Aufmerksamkeit im In- und Ausland erreichen. Hättest du die Möglichkeit, eine Autorin oder einen Autor für einmal ganz ins Rampenlicht zu stellen, um sie oder ihn auf ein wohl verdientes Podest zu heben, sie dem Vergessen oder Übersehen zu entreissen, wer wäre es?
Es gibt ganz viele, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten, aber wenn ich jetzt einen Namen nenne, dann unterstelle ich der Person Misserfolg und das wäre nicht sehr freundlich. Ganz generell bekommt aber die Lyrik viel zu wenig Aufmerksamkeit, ähnlich wie die zeitgenössische Musik, die fast eine Sekte ist und kaum gehört wird im Lärm der Greatest Hits der Klassik, die rauf und runter gespielt werden. Um aber doch noch einen Namen zu nennen: ich glaube, Hartmut Lange hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Er ist ein stiller Autor, aber er schreibt wunderbare Bücher.
Rezension «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» auf literaturblatt.ch
Beitragsillustration © Lea Frei



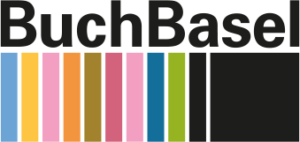 Ein bedeutsamer Aussenseiter im Rennen um den Schweizer Buchpreis 2018 ist der Bündner Vincenzo Todisco mit seinem Roman «Das Echsenkind». (
Ein bedeutsamer Aussenseiter im Rennen um den Schweizer Buchpreis 2018 ist der Bündner Vincenzo Todisco mit seinem Roman «Das Echsenkind». ( 1961. In einer abgeschlossenen Wohnung im «Gastland» misst ein kleiner Junge in der Dunkelheit die Schritte durch die abgedunkelte Wohnung, während Mutter und Vater arbeiten. Bis 2002 galt in der Schweiz das «Saisonstatut», mit dem man ausländische Arbeitnehmer unter unwürdigen Umständen amtlich zur Unterschicht stempelte. Nicht zuletzt zwang man sie mit diesem Statut, ihre Kinder vor dem Auge der Öffentlichkeit und der Ämter zu verstecken. Die Geschichte der «versteckten Kinder» tauchte im Leben Vincenzo Todiscos immer wieder auf, bis er sich dazu entschloss, sich mit dem Abschluss einer eigentlichen Trilogie dem Thema literarisch auszusetzen.
1961. In einer abgeschlossenen Wohnung im «Gastland» misst ein kleiner Junge in der Dunkelheit die Schritte durch die abgedunkelte Wohnung, während Mutter und Vater arbeiten. Bis 2002 galt in der Schweiz das «Saisonstatut», mit dem man ausländische Arbeitnehmer unter unwürdigen Umständen amtlich zur Unterschicht stempelte. Nicht zuletzt zwang man sie mit diesem Statut, ihre Kinder vor dem Auge der Öffentlichkeit und der Ämter zu verstecken. Die Geschichte der «versteckten Kinder» tauchte im Leben Vincenzo Todiscos immer wieder auf, bis er sich dazu entschloss, sich mit dem Abschluss einer eigentlichen Trilogie dem Thema literarisch auszusetzen. Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. „Das Eidechsenkind“ ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.
Vincenzo Todisco, 1964 als Sohn italienischer Einwanderer in Stans geboren, studierte Romanistik in Zürich und lebt heute als Autor und Dozent in Rhäzüns. Für sein literarisches Schaffen wurde er 2005 mit dem Bündner Literaturpreis ausgezeichnet. Im Rotpunktverlag liegen seine Romane in deutscher Übersetzung vor. „Das Eidechsenkind“ ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.