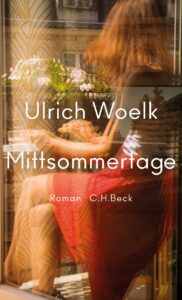Deutschand kurz vor dem Mauerfall. Paul studiert Philosophie in Berlin, spürt dass sich etwas zusammenbraut und hat das unbedingte Bedürfnis, ein Teil dieses Etwas zu sein. „Liebe und Revolution“ beschreibt eine, aus der Gegenwart betrachtet, fast unwirklich erscheinende Zeit des Aufbruchs.
Die Gegenwart ist unbarmherzig, das Gefühl einer kollektiven Machtlosigkeit scheint sich wie ein lähmender Virus auszubreiten. Mit den Protestbewegungen in Ostberlin vor dem Mauerfall, dem Mauerfall selbst, den Befreiungskämpfen in Nicaragua und El Salvador damals, glaubte man noch an die Macht der Revolution, die Macht der Liebe für eine Sache. Auch Paul nimmt diese Kraft mit und entschliesst sich im Sog von konspirativen Lesekreisen und aktivistischen Zirkeln nach Nicaragua zu reisen, um bei Aufbauprojekten mitzuarbeiten. Es ist der unbedingte Wunsch, Teil einer Bewegung zu werden, dazuzugehören, nicht bloss Zuschauer zu sein. Obwohl er mit Beate in Berlin zum ersten Mal das Gefühl hatte, etwas vom Gefühl der grossen Liebe gelebt zu haben, fliegt er ins Land der sandinistischen Revolution, nicht mit der Absicht, eine Waffe in die Hand zu nehmen, sondern bei Bau- und Aufbauprojekten mitzuhelfen.
«Er lebte mit der schmerzlichen Gewissheit, mit allem zu spät zu kommen, vor allem aber mit dem Begreifen.»
Nach einem halben Jahr kommt er zurück, ein Stück weit desillusioniert und von vielen seiner Hoffnungen verloren. Nicht nur, dass die Revolution in jenem fernen Land längst sandinistischen Sand im Getriebe hatte, man sich in Positionen eingegraben hatte, Parolen zu leeren Floskeln wurden. Jene Frau, die er dort kennen und lieben lernt, die im Gegensatz zu ihm zu allem entschlossen ist, die er im Bus wenigstens ein Stück weit näher an die Front begleitet, wird umgebracht und Paul, nur durch Zufall der Katastrophe entronnen, nimmt das Trauma dieser Bluttat mit zurück nach Deutschland.
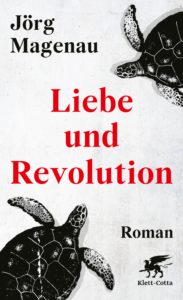
Aus Nicaragua zurück trifft er Beate wieder. Mittlerweile arbeitet sie bei der FAZ und versucht möglichst nahe an jenem Geschehen zu sein, dass Berlin kurz vor dem Mauerfall in ein brodelndes Epizentrum verwandelt. Aber so sehr Paul von den Geschehnissen in der Hauptstadt mitgerissen wurde, konfrontiert ihn Beate mit dem, was er mit seiner Reise nach Mittelamerika zurückgelassen hatte. Er, der aufbrechen, er, der sich einbringen wollte, verliess unwissend eine schwangere Frau. Beate, entschlossen, sich nicht zu einer Zurückgelassenen machen zu lassen, liess das Kind in ihrem Bauch wegmachen, eine Nachricht, die Paul erschüttert. Einmal mehr fühlt er sich nicht dort, wo man ihn gebraucht hätte, nicht bei Beate damals, nicht bei jenem Kind, aber auch nicht dort, am Nerv des Lebens.
«Dies war eine Zäsur, ein Schnitt durch die Zeit, durch den Raum. Die Mauer war ein Raumteiler aus Beton, aber auch ein Damm gegen das Verstreichen der Zeit, ein erzwungener Stillstand…»
„Liebe und Revolution“ ist eine Liebesgeschichte, eine Liebesgeschichte, die fast alle Ernüchterungen mit einschliesst. Eine sehnsüchtige Liebesgeschichte eines Mannes auf der Suche nach dem unmittelbaren Leben, nach einem Mittelpunkt, einem Platz im Leben. Paul ist auf der Suche nach dieser Liebe. „Liebe und Revolution“, auch wenn es noch nicht einmal ein halbes Jahrhundert her ist seit den Geschehnissen, in die der Roman eingebette ist, ist ein historischer Roman. So wie der Aufbruch damals in Mittelamerika längst geglättet ist, so ist vom Aufbruch mit der Wende nur noch wenig zu spüren. Was damals wabberte, ist institutionel verschraubt. So wie der Aufbruch in einer Liebe schnell von Gewohnheiten in Form gebracht werden will. Jörg Magenaus Roman verschränkt nicht nur im Titel zu seinem neuen Roman Liebe und Revolution, Revolution und Liebe.
Bestechend an Magenaus Roman ist auch die Nähe, die er erzeugt. Magenau spinnt ein feines, mehrschichtiges Erzählnetz, setzt sein Geschehen sowohl in grosse, äussere Zusammenhänge, wie in jene einer ganz engmaschigen, labilen menschlichen Psyche. Man erkennt im Roman die Betroffenheit des Autors deutlich. Magenau erzählt nicht aus distanzierter Abgeklärtheit. Es ist, als ob der Roman ein 300 Seiten langer Erklärungsversuch ist; Was passierte damals? Was ist geblieben? Wenn es Wenderomane gibt, dann ist Jörg Magenau mit „Liebe und Revolution“ ein ganz besonderer gelungen!
Interview
Ich bin von ihrem Roman schwer beeindruckt. Klar, es ist ein Roman über Auf- und Umbrüche, ein Liebesroman, ein grossfomatiges Zeitbild. Aber sie tauchen in einer Art und Weise mitten ins Geschehen, die mich selbst taumeln lässt. Die mich auch ziemlich heftig reflektieren lässt, wie sehr ich im Laufe meines Lebens an meine „kleinen“ Probleme gebunden war und gar nicht erfasste, was um mich herum geschah und geschieht. Ist der Roman auch ein ganz persönlicher Versuch des Ordnens und Einordnens?
Jedes Erzählen ist ein Versuch, nachträglich zu ordnen, zu sortieren, zu konstruieren. Es kann gar nicht anders sein, weil jede Erzählung einen Anfang und ein Ende in der Zeit setzt und dazwischen nur das zur Sprache bringt, was irgendwie zur Sache gehört. Alles andere, also fast alles, wird ausgeblendet. Da das Erzählen immer erst im Nachhinein einsetzt, ist zumindest die zeitliche Distanz zum Geschehen vorausgesetzt, also eine Art Draufsicht. Das gilt auch dann, wenn die Erzählinstanz das verhindern möchte und, wie in meinem Roman, so dicht bei der Hauptfigur bleibt, dass sie nur ganz selten über deren unmittelbares Erleben hinaussieht. Eines der Themen, um die es mir geht, hat damit zu tun: Paul ist einer, der in der Zeitgeschichte drinsteckt, der dabei sein will, der aber immer im jetzt gerade gegenwärtigen Moment gefangen bleibt, ohne zu verstehen, was geschieht. Weder in der Nacht des Mauerfalls am 9. November 1989 in Berlin, noch im Jahr 1987 in Nicaragua begreift er, was um ihn herum vor sich geht und wohin das alles führen wird. Aber genau darin, in diesem Nicht-Erkennen, besteht zu weiten Teilen das menschliche Dasein, auch wenn wir uns gerne vormachen, den Überblick zu bewahren und wenigstens aufs eigene Leben bezogen Superchecker zu sein. Dabei verschlägt es einen im Leben immer wieder ganz woanders hin, als man gedacht hätte, und meistens kapiert man die politischen Zusammenhänge, in denen man existiert, erst zehn Jahre später und hat nochmal zehn Jahre später wieder eine ganz andere Einschätzung. Trotzdem leben wir unsere Leben unausweichlich in der nichtdurchschauten Gegenwart. In revolutionären Situationen wie in meinem Roman, in denen die Verhältnisse in Bewegung geraten, ist das besonders deutlich spürbar. 
Paul hadert mit dem Gefühl, nicht dazuzugehören, irgendwie ausgeschlossen, aussen vor zu sein. Ist das nicht ein Problem ausschliesslich der Menschen des sogenannten Informationszeitalters? Mit der Individualisierung scheint der Mensch immer mehr an seiner Bedeutungslosigkeit zu leiden. Weshalb sind wir sonst gezwungen, dauernd Selfies von uns zu machen und uns auf allen (un)möglichen Kanälen einzumischen.
Das stimmt. Mit den Möglichkeiten des Informationszeitalters wachsen auch die Illusionen der Zugehörigkeit und die Freude an narzisstischer Selbstinszenierung. All die „Freunde“ oder „Follower“, die man auf den Social Media-Kanälen gewinnt, erzeugen eine virtuelle Gemeinschaft, die nicht völlig irreal ist und die ein enormes Suchtpotential besitzt, weil sie Aufmerksamkeit verschenkt. Da zerfliessen die Grenzen zwischen sehr persönlichen und öffentlichen Angelegenheiten, und es entsteht etwas Neues, das sich in seinen Folgen auch noch nicht wirklich begreifen lässt. Vielleicht in zehn Jahren. Wie verändert sich das Denken einer Menschheit, die lieber twittert als komplexe Bücher zu lesen? Sich lieber mit Einzelerregungen befasst als mit grösseren Sinnzusammenhängen? Das Gefühl der Unzugehörigkeit aber war in den 80er Jahren bestimmt nicht kleiner als heute. Für Paul, der als Student nach Westberlin kommt, ist die Unzugehörigkeit in der Stadt ebenso wie in der riesigen Freien Universität aber selbst gewählt. Diese Unzugehörigkeit ist der Ausgangspunkt für all das, was damals „Engagement“ hiess. Unzugehörigkeit bedeutet ja auch Ungebundenheit, Freiheit. Und aus dieser Freiheit heraus wächst sein Bedürfnis, an etwas Teil zu haben und die Welt zu verändern. Das gelingt ihm nicht zu Hause in Berlin, sondern in der Ferne, in Lateinamerika. Dort kann er Revolution als Teilhabe erleben, egal wie sinnvoll oder sinnlos das ist, was er tut. Das Ende des Sozialismus, das vielleicht weniger Revolution als Konkurs eines Staatsunternehmens war, kommt ihm dagegen als etwas Fremdes entgegen, das er wie ein Jahrmarktspektakel betrachtet.
Liebe ist genauso wenig Zustand wie Revolution. Das wurde mir mit der Lektüre ihres Romans mehr als bewusst. Beide brauchen Feuer, die brennen und Hitze erzeugen. Aber kein Feuer brennt ewig. Wie viel Ernüchterung schwingt in ihrem Roman mit?
Gar keine. Ich finde, es ist ein optimistischer Roman. Dass etwas schiefgeht, in der Liebe genauso wie in der Politik, ist ja kein Argument dagegen, es zu probieren. Was Paul ausmacht, ist – bei aller Zögerlichkeit und Ahnungslosigkeit, die ihn charakterisieren – seine Bereitschaft, sich einer Situation auszusetzen, etwas zu erleben, zu lernen. Diese Offenheit zeichnet ihn aus. In Nicaragua lernt er, dass die Sache mit der Weltveränderung nicht so einfach ist, dass er aber, indem er dort ist und mitwirkt, sich selbst verändert, und dass die Selbstveränderung ja auch eine Form der Weltveränderung ist – vielleicht sogar die einzige, auf die es wirklich ankommt. So erlebt er auch die Liebe, weil zu lieben nichts anderes bedeutet als die Bereitschaft, sich verändern wollend verändern zu lassen. 
Angesichts der globalen Probleme ist die fehlende Bereitschaft, wirkliche Veränderungen herbeizuführen, erstaunlich. Sei es bei gesellschaftlichen, politischen oder ökologischen Herausforderungen. Paul erscheint mir dabei exemplarisch. Paul reist nach Nicaragua, will Teil einer Bewegung werden. Wann wird aus Entschlossenheit Selbstzweck?
Paul ist gar nicht entschlossen. Das schützt ihn vermutlich. Er ist im Unfertigen, im Provisorischen, im Werden beheimatet. Aber er bewundert Entschlossenheit bei anderen in seiner Nähe, wahrscheinlich deshalb, weil sie ihm fehlt. Beate und Sigrid, die beiden Frauen, die ihn faszinieren, sind sehr viel konsequenter als er. Hartmut, der Chef der Brigade, auch. Der ist nun wahrlich ein Mann der Tat. Die Gefahr bei allen Veränderungsbemühungen, in der Liebe ebenso wie in der Revolution, besteht in der Erstarrung, im Beharren auf festen Positionen, in der Ritualisierung der eigenen Handlungen. Das erleben wir derzeit zum Beispiel bei den Klima-Aktivisten, die sich auf Strassenkreuzungen festkleben. Wenn das Ziel die Mittel rechtfertigt, ohne sie in Frage zu stellen, dann schlägt das Engagement in Selbstzweck um. Oder noch schlimmer: in Selbstbefriedigung. Dann macht man weiter, auch wenn man ahnt, dass sich das eher kontraproduktiv auswirken wird. Weil es sich besser anfühlt, etwas zu tun, als nichts zu tun. Und vielleicht stimmt das ja sogar. 
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Roman in ihrem Umfeld ziemlich Wellen geschlagen hat. Die Generation, die beim Mauerfall zwischen zwanzig und dreissig war, ist heute im Pensionsalter. Wellen der Erinnerung, Wellen der Rechtfertigung. Warum wurde nicht, wofür man damals kämpfte!
Dafür muss man sich nicht rechtfertigen. In der Menschheitsgeschichte ist es noch nicht vorgekommen, dass das Resultat einer Bewegung den zugrundeliegenden Absichten entsprochen hätte. Das ist eben der Lauf der Geschichte, dass die Einzelnen Dinge in Gang setzen, jeder etwas anderes will, das Ergebnis aber nie dem Einzelwillen und auch nicht der schlichten Summe aller Willensanstrengungen entspricht. Was Nicaragua betrifft, so ist aus der sandinistischen Revolution die Herrschaft eines korrupten Familienclans geworden, das Land befindet sich heute in einer fürchterlichen Lage und gehört nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt. Das spricht aber keineswegs gegen die internationale Solidarität und die Unterstützung der Linken in den 80er Jahren. Nur lag deren Bedeutung auf einem anderen Feld, weniger im politischen als im sozialen. Dass Solidarität dort spürbar wurde, dass Freundschaften entstanden und teilweise bis heute hielten, dass Gemeinschaft erlebbar wurde, das ist für alle Beteiligten eine wichtige Erfahrung gewesen. Paul erlebt das als Liebe zu Land und Leuten. Das ist nicht wenig, auch wenn das politische Experiment grandios gescheitert ist. Das gilt übrigens genauso für die Bürgerbewegung in der DDR und der Nachwendezeit. Auf solchen Erfahrungen lässt sich dann in anderem Kontext wieder aufbauen. In meinem Roman kommt immer wieder die „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss vor als zentrale Lektüre in jenen Jahren. Weiss beschreibt gut marxistische Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen und als endlose Kette von Niederlagen der Unterdrückten. Und er fragt danach, warum trotzdem aus allen Niederlagen so etwas wie Hoffnung resultiert. Das hat, meine ich, etwas mit der Erfahrung der Gemeinschaftlichkeit zu tun, mit Zusammengehörigkeit, mit Solidarität. Oder, individuell betrachtet, eben mit Liebe. Deshalb heisst das Buch auch so, „Liebe und Revolution“. Die Liebe steht dabei ausdrücklich an erster Stelle.
Jörg Magenau, geboren 1961 in Ludwigsburg, studierte Philosophie und Germanistik in Berlin. Er ist einer der bekanntesten deutschen Feuilleton-Journalisten und schrieb u. a. Biographien über Christa Wolf, Martin Walser und die Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger. Bei Klett-Cotta erschien die literarische Reportage «Princeton 66» und zuletzt sein erster Roman «Die kanadische Nacht» (2021).
Beitragsbild © Olaf Kuehl

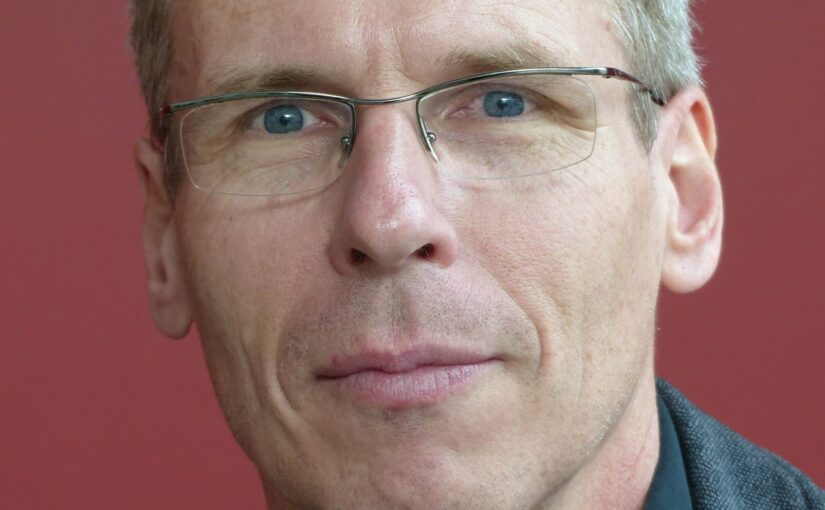

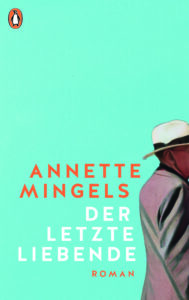



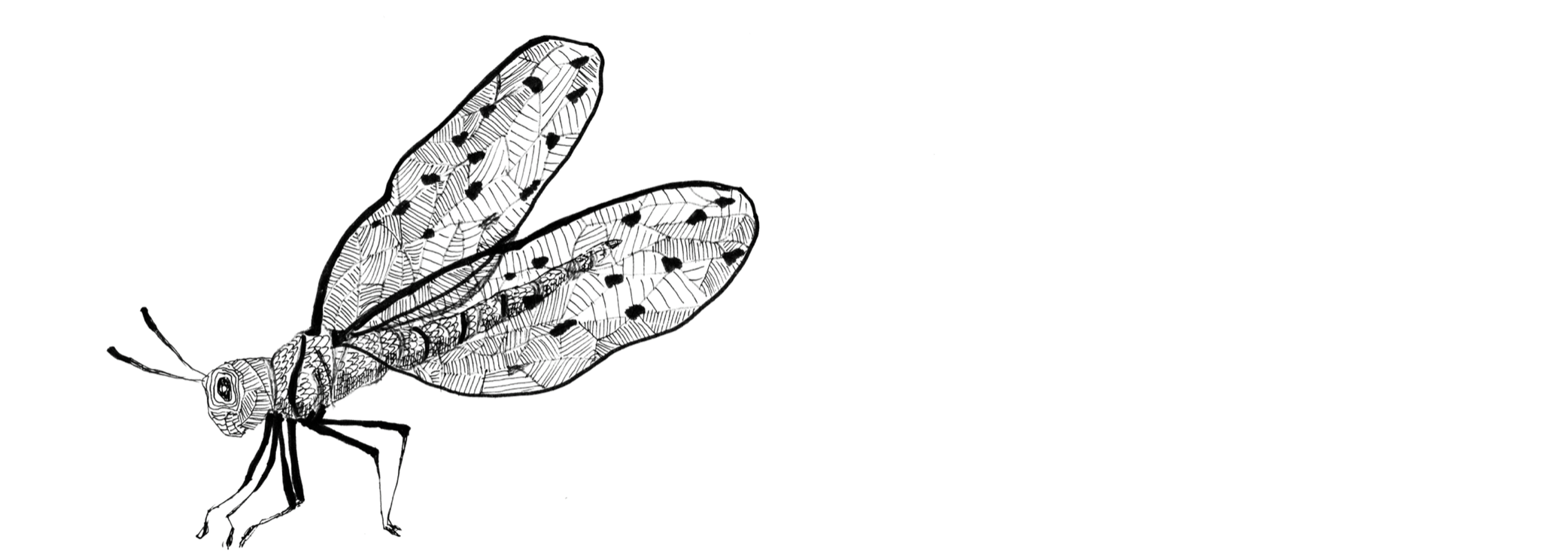
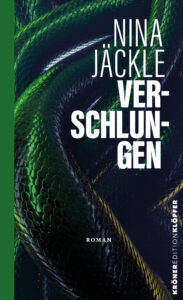
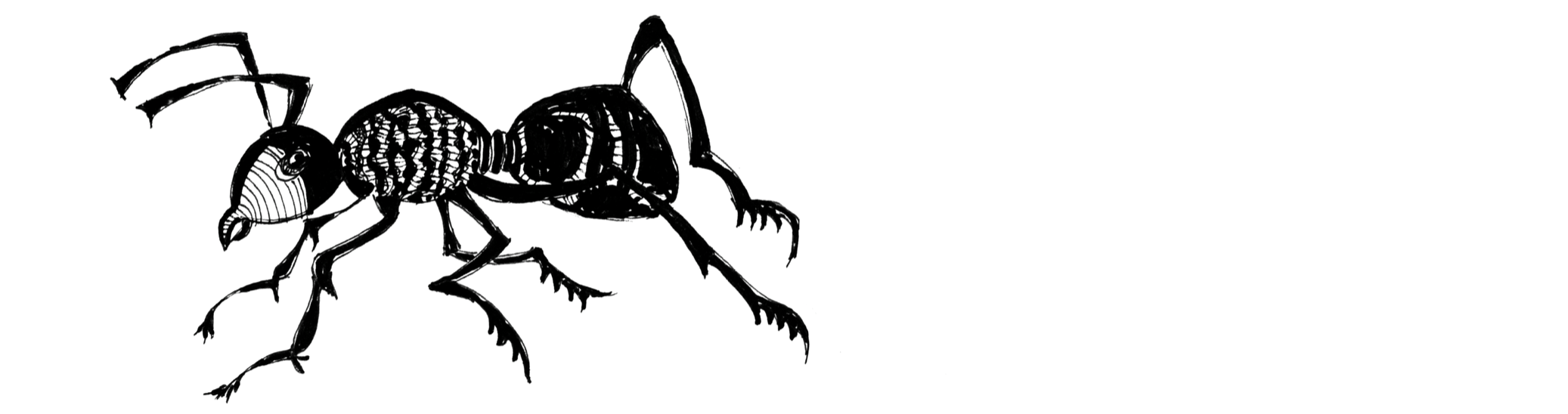
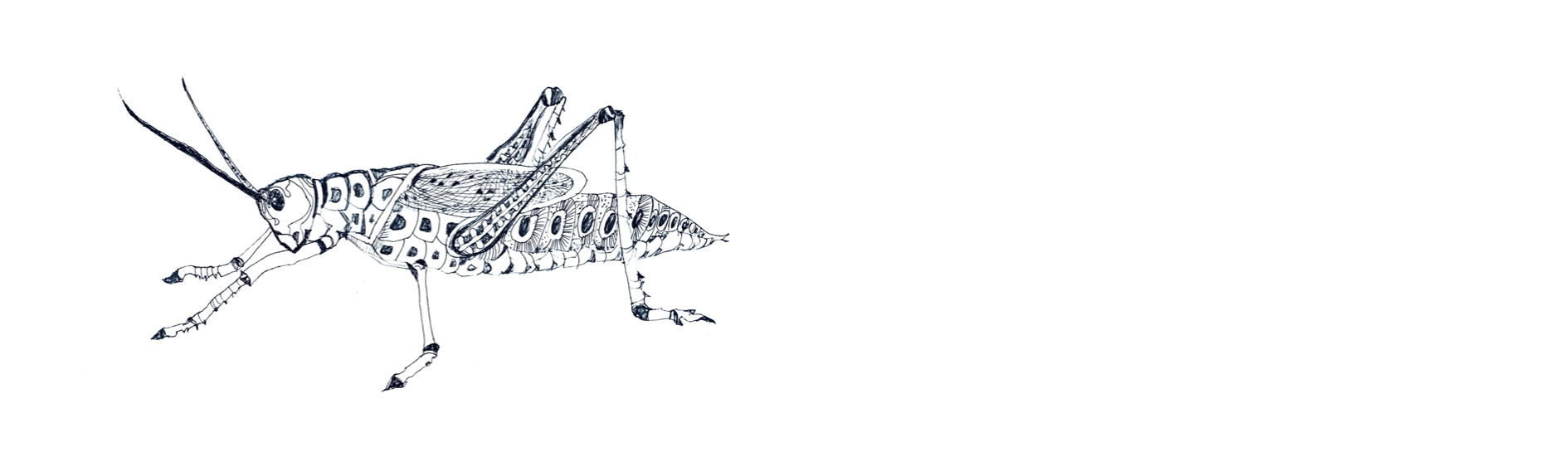
 Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «
Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «
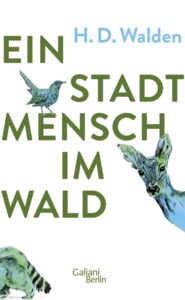
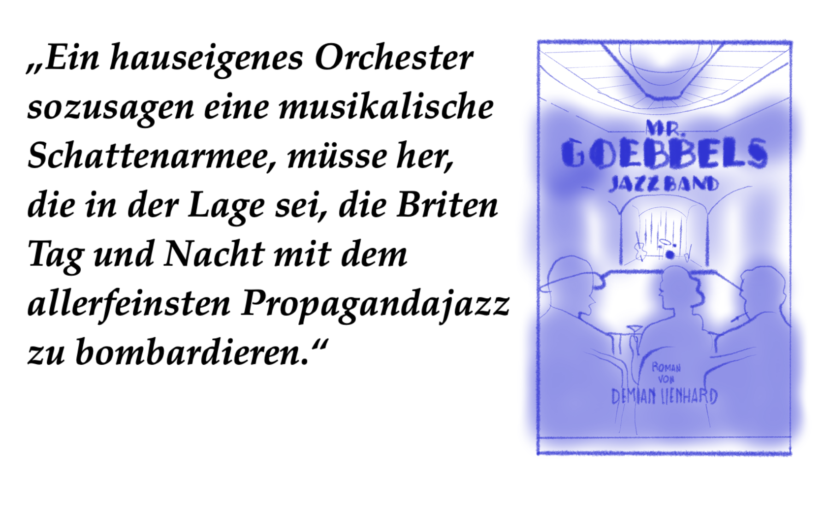

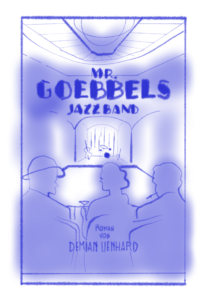
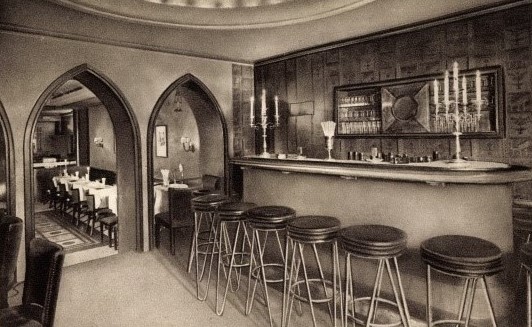
 Demian Lienhard, geboren 1987 in Bern. Studium der Klassischen Archäologie, der Latinistik und der Hispanistik in Zürich, Köln und Rom.
Demian Lienhard, geboren 1987 in Bern. Studium der Klassischen Archäologie, der Latinistik und der Hispanistik in Zürich, Köln und Rom. 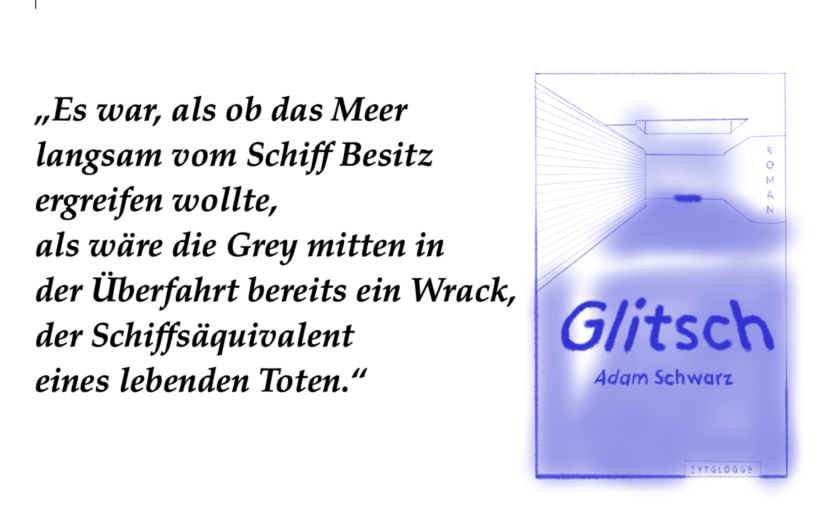
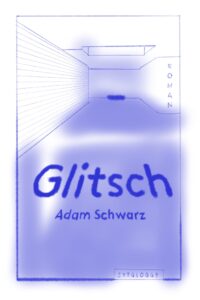
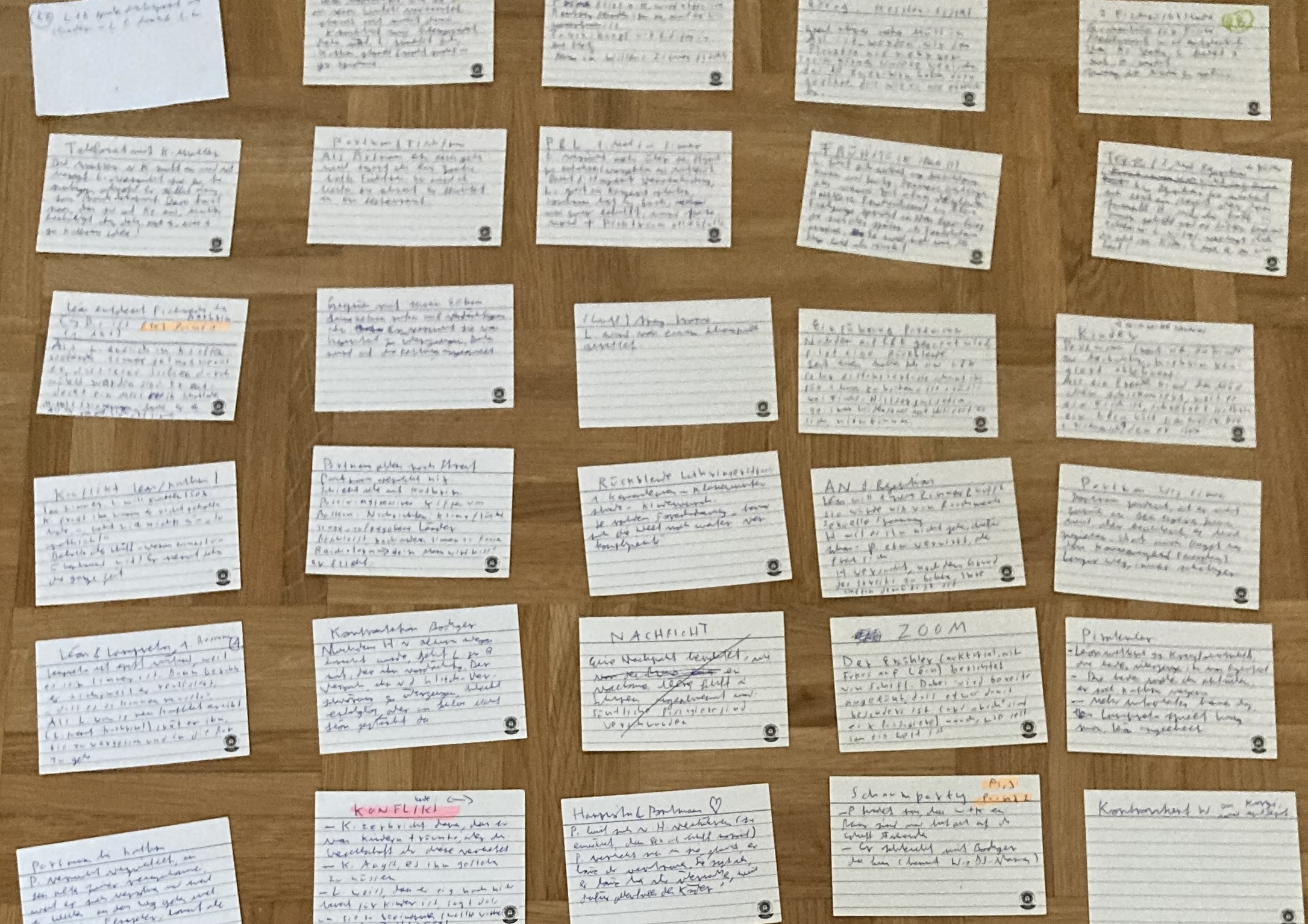
 Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.
Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. 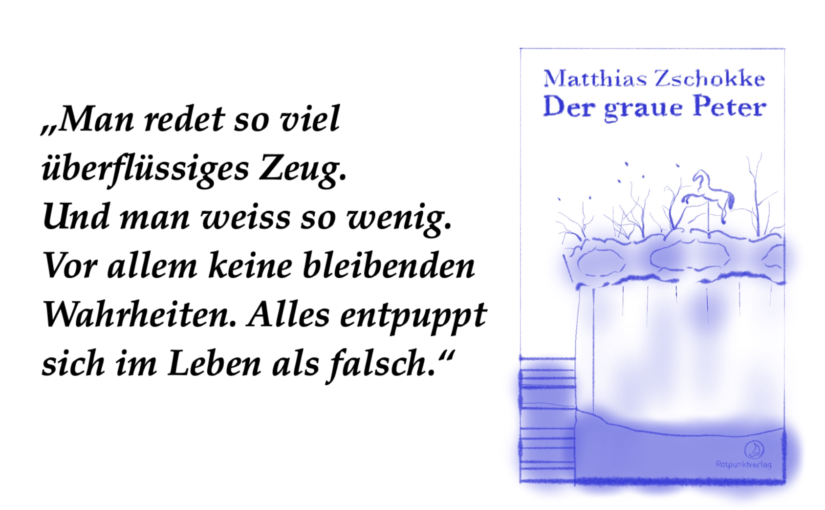
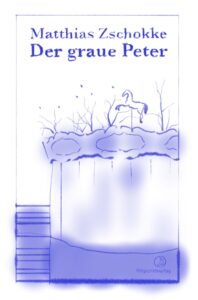
 Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen?
Auf aktuellen Fotos sieht man Sie mit dunklem Nadelstreifenanzug und Uhrenkette. Nicht nur ihres Aussehen wegen, denke ich oft an Robert Walser. Auch er war ein Unikat, ein Monolith. Ihre Romane scheren sich nicht um Stringenz, Plott und Spannung. Es ist das Bild des Ganzen, der Pinselstrich. Es ist die Sprache. Es sind die Fragen, die ich mir während des Lesens stelle, Fragen, die sich manchmal weit weg vom Geschehen in ihrem Roman aufzwängen. Wieviel Walserisches steckt in Ihnen? Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher;
Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn». Aktuell läuft Matthias Zschokkes neustes Werk als Filmemacher; 

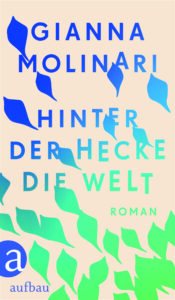
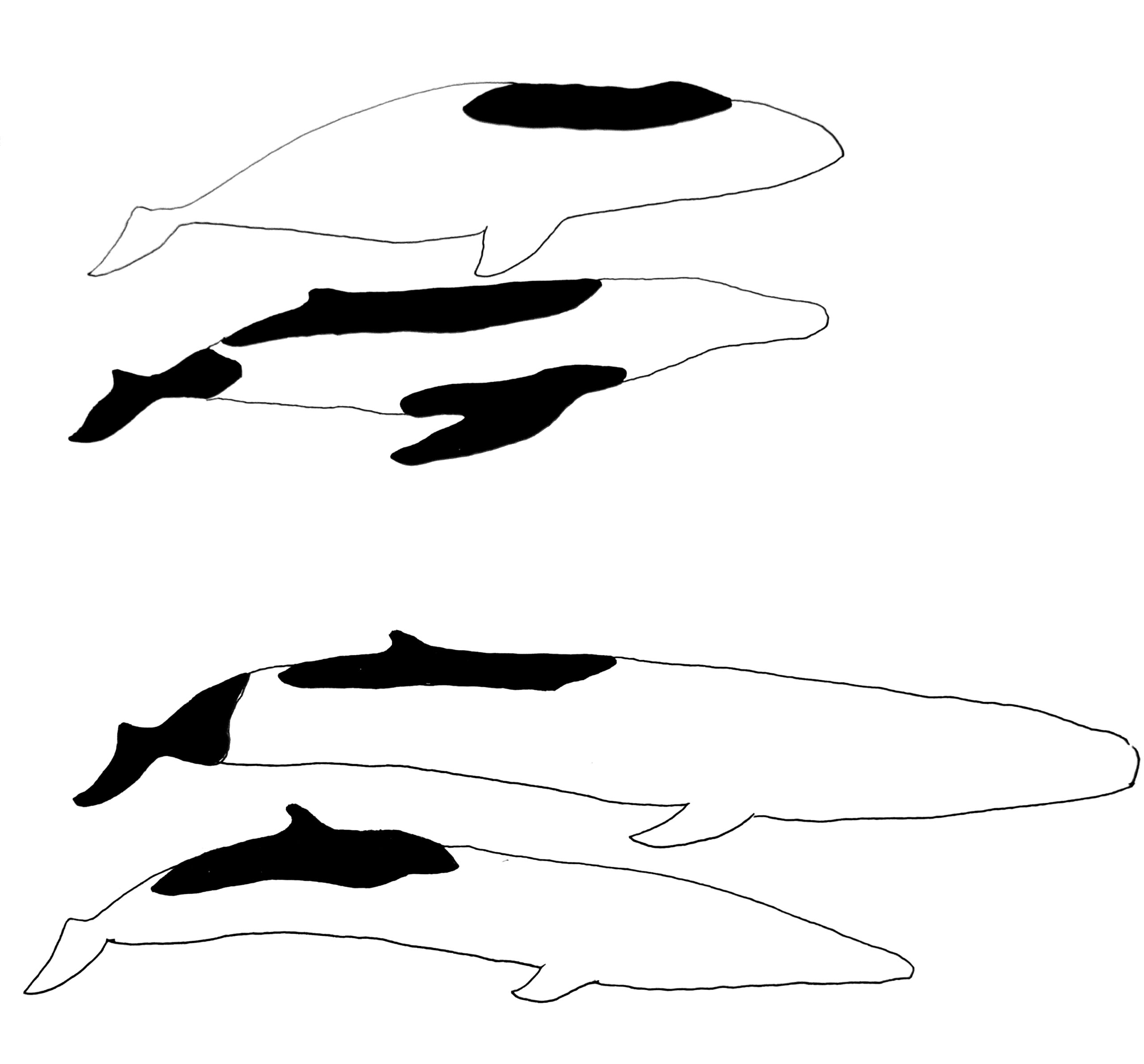

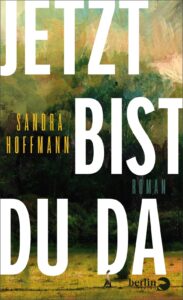

 Der Wald – männlich, der einzige von dem Claire sich noch umarmen lässt. Claire hat sich in ihrer materialisierten Angst eingerichtet, hat Schutzmechanismen aufgebaut. Sie scheint clever, souverän. Janis ist genau von dem schwer beeindruckt. Aber Janis, der in vielem dem offensichtlich Männlichen nicht entspricht, der Claire mit Verschüttetem konfrontiert, viel mehr auslöst, als „nur“ erotisch aufgeladene Gefühle, wird zu einem Schlüssel. Irgendwie scheinen wir doch in unserer perfekt organisierten Welt das wahrhaft Sinnliche aus den Augen verloren zu haben.
Der Wald – männlich, der einzige von dem Claire sich noch umarmen lässt. Claire hat sich in ihrer materialisierten Angst eingerichtet, hat Schutzmechanismen aufgebaut. Sie scheint clever, souverän. Janis ist genau von dem schwer beeindruckt. Aber Janis, der in vielem dem offensichtlich Männlichen nicht entspricht, der Claire mit Verschüttetem konfrontiert, viel mehr auslöst, als „nur“ erotisch aufgeladene Gefühle, wird zu einem Schlüssel. Irgendwie scheinen wir doch in unserer perfekt organisierten Welt das wahrhaft Sinnliche aus den Augen verloren zu haben.