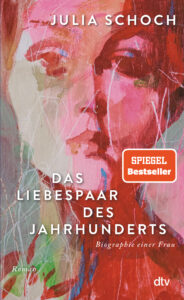Tabea Steiner zu Gast im Literaturhaus Thurgau
Warum lässt man sich derart in Zwänge, Muster, Pflichten und Bedingungen einbinden, dass das alles die Luft zum Atmen nimmt. Tabea Steiner hat mit ihrem zweiten Roman „Immer zwei und zwei“ ein beklemmendes Buch darüber geschrieben, wie schwer es werden kann, wenn man aussteigen, sich befreien will.
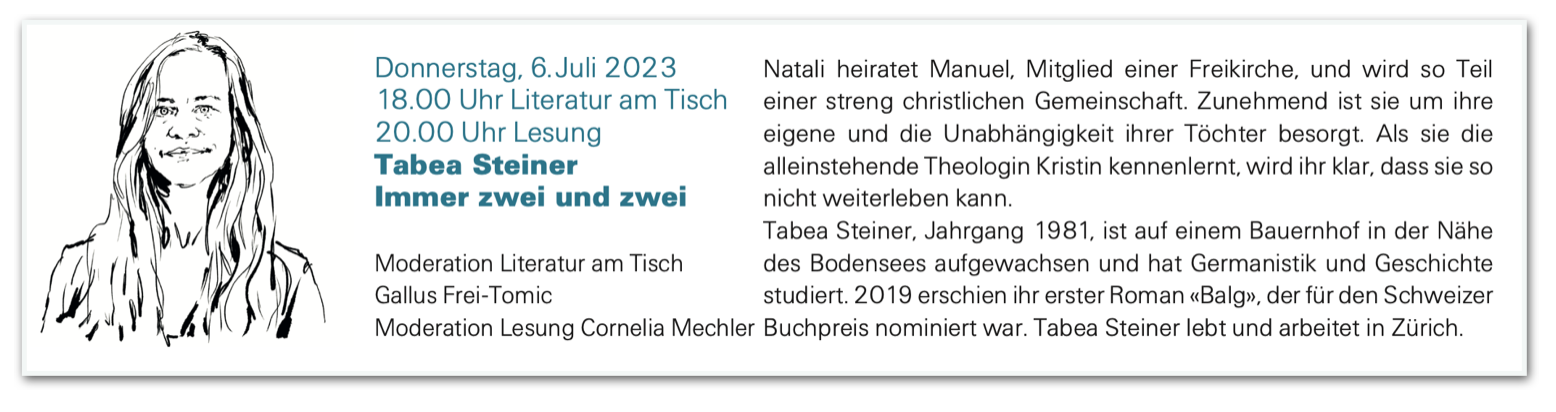
Erinnern sie sich an ihre Zeit im Kindergarten, als man vom Schulhaus zur Turnhalle paarweise, immer zwei und zwei, gehen musste? War es nicht Noah, der immer zwei jeder Sorte Tier auf seine Arche mitnahm und vor der Sintflut rettete? Scheinbar liegt in dieser Ordnung die Rettung vor drohender Gefahr. Scheinbar braucht es die klare Ordnung, um sich nicht im Chaos zu verlieren. Ob das Gesetze sind, die uns vor Anachie und Willkür schützen oder Gemeinschaften, die uns das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben. Ob es eine Bubble ist, die einem das Gefühl von Zusammengehörigkeit schenkt oder straffe Systeme wie Schule oder Militär. Immer zwei und zwei. Im Ausbruch, in der Freiheit liegt die Gefahr.
Natali ist ein junge Frau, verheiratet mit einem Mann, den sie liebt und Mutter zweier Kinder, berufstätig und mit einem Atelier, in dem sie in Stunden der Muse aus Stein und Ton Neues formt. Natali scheint alles zu haben, was eine glückliche Existenz braucht. Aber Natalis Glück ist brüchig geworden. So wie ihre Welt, in die sie sich eingebunden fühlt, ein Eingebundensein, das sich mehr und mehr wie Fesseln anfühlt. Ein Gefühl der Einsamkeit, das sie schon als Kind mit sich herumschleppte. Da wurde ihr klar, dass sie allein war, wirklich allein … auf der Welt, endgültig und nur sie. Ein panisches Gefühl, am falschen Ort, mit den falschen Menschen zu sein.
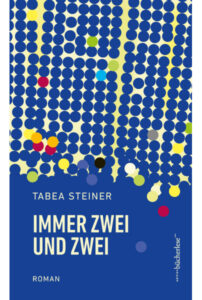
Natali gehört zu einer freikirchlichen Gemeinschaft, einer Gemeinschaft mit klaren Regeln, Strukturen und Wertvorstellungen. Solchen, die ihr mehr und mehr aufstossen und eine innere Rebellion provozieren. Ihre Freundin Rosalie, wie sie fest eingebunden in jene Gemeinschaft, ist verheiratet mit Tobias, der Natalis Kinder in der Sonntagsschule unterrichtet und dort Geschichten erzählt, die ihren Kindern den Schlaf rauben. Mit einem Magnet war er über Büroklammern aus Metall und Plastik gefahren und hatte erklärt, so werde es sein, wenn Jesus wiederkomme. Er nimmt nur diejenigen mit, die wirklich an ihn glauben. Die anderen bleiben auf der Erde zurück, wie die Plastikklammern.
Seien es gewünschte Schlagzeugstunden, die nicht erlaubt werden, weil man das Instrument im Gottesdienst nicht brauchen kann, sei es eine Reise nach Israel, zu der man sich verpflichtet fühlt und die völlig abgeschottet von der Aussenwelt durchexerziert wird, seien es Kleidervorschriften oder Kommentare ihrer eigenen Kinder – Natali schnappt nach Luft in der Umklammerung dieser scheinbaren Gemeinschaft. Und als sie sich bei einer Fortbildung in eine evangelische Pfarrerin verliebt und selbst ihre Familie ins Wanken gerät, mietet sich Natali eine eigene Wohnung. Ein Prozess der Distanzierung aus ihrer Welt, den ihr Mann und ihre Freundin Rosalie nicht nachvollziehen können. Natali begibt sich in ein Dazwischen, das sie einmal mehr mit ihrer Panik vor drohender Einsamkeit konfrontiert. Alles, was ihre Welt ausmacht, beginnt sich gegen sie zu wenden. Sie droht in einem Meer aus Schuldgefühlen zu versinken.
Tabea Steiners Roman erzählt behutsam und unspektakulär. Die Autorin hätte ihren Stoff, die Geschichte ganz leicht zur spektakulären Loslösungsgeschichte aufblasen können. Aber darum ging es der Autorin nicht. Tabea Steiner schildert einen Prozess, der alles andere als linear verläuft, ein permanentes Ringen mit Situationen, in denen sich die junge Frau nicht mehr zurechtfindet. „Immer zwei und zwei“ ist auch keine Anklage gegen freikirchliche Gemeinschaften, sondern die Geschichte einer jungen Frau, die ganz langsam ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und innerer Freiheit folgen kann. Gemeinschaften, die einengen und bestimmen, mögen für die einen Wegweiser oder Leitplanke sein. Aber sie missachten, dass die Freiheit eines Menschen eben jene Selbstbestimmung, jene Freiheit ausmacht, die das Lebewesen Mensch zum Menschen macht.
„Immer zwei und zwei“ ist ein wichtiger Roman – eindringlich geschrieben, ganz offensichtlich voll mit persönlicher Erfahrung.
Tabea Steiner liest nicht nur am 6. Juli im Literaturhaus Thurgau! Vor der Lesung können all jene zusammen mit der Autorin diskutieren, die das Buch bereits gelesen haben. Das Format «Literatur am Tisch» lädt bei Speis und Trank zu einer ganz speziellen Vertiefung ein, einem Gespräch weit über den Roman hinaus. Sie sind herzlich eingeladen! Eine verbindliche Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Tabea Steiner, Jahrgang 1981, ist auf einem Bauernhof in der Nähe des Bodensees aufgewachsen und hat Germanistik und Geschichte studiert. Sie hat das Thuner Literaturfestival Literaare initiiert, ist Mitorganisatorin des Berner Lesefestes Aprillen und war bis 2022 Mitglied der Jury der Schweizer Literaturpreise. 2011 hat sie an der Autorenwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin teilgenommen, 2019 war sie LCB-Stipendiatin. 2019 erschien ihr erster Roman «Balg«, der für den Schweizer Buchpreis nominiert war. Tabea Steiner lebt und arbeitet in Zürich.
Illustration © leale.ch / Literaturhaus Thurgau

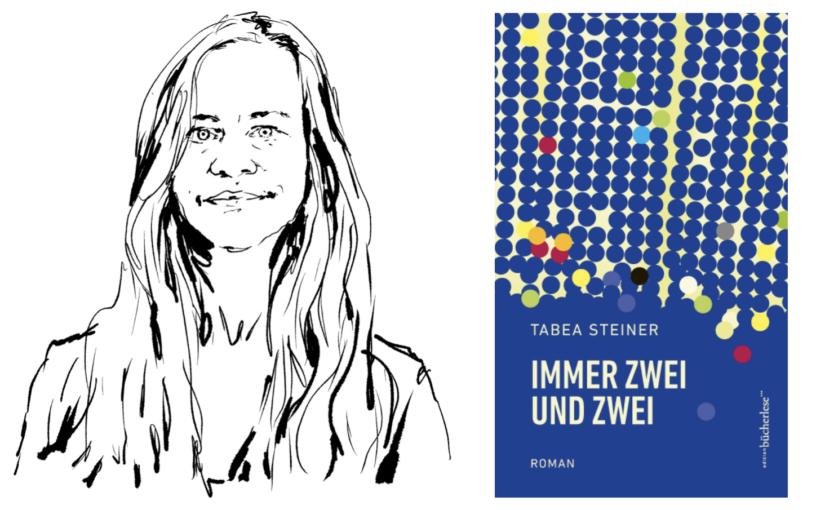
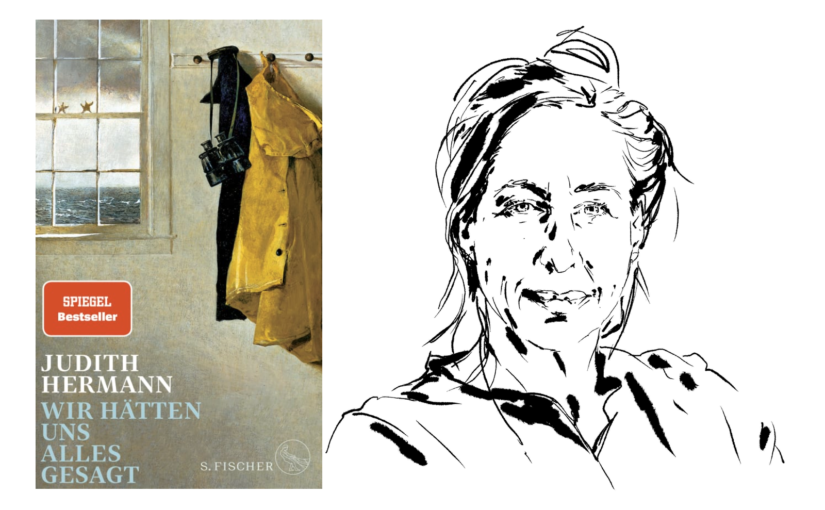
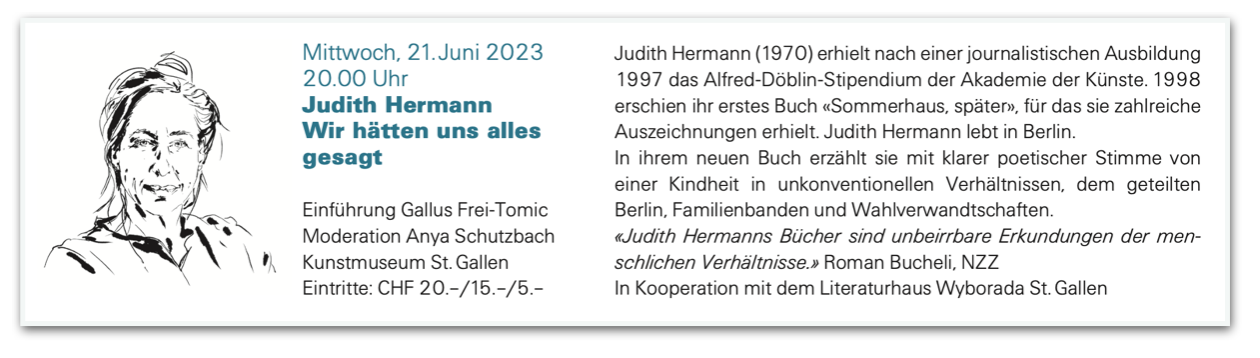
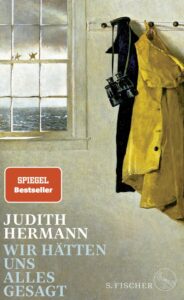

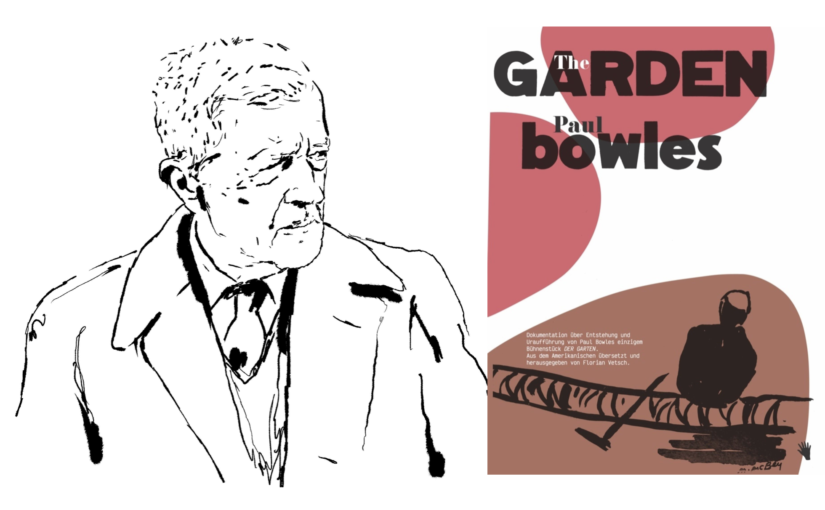
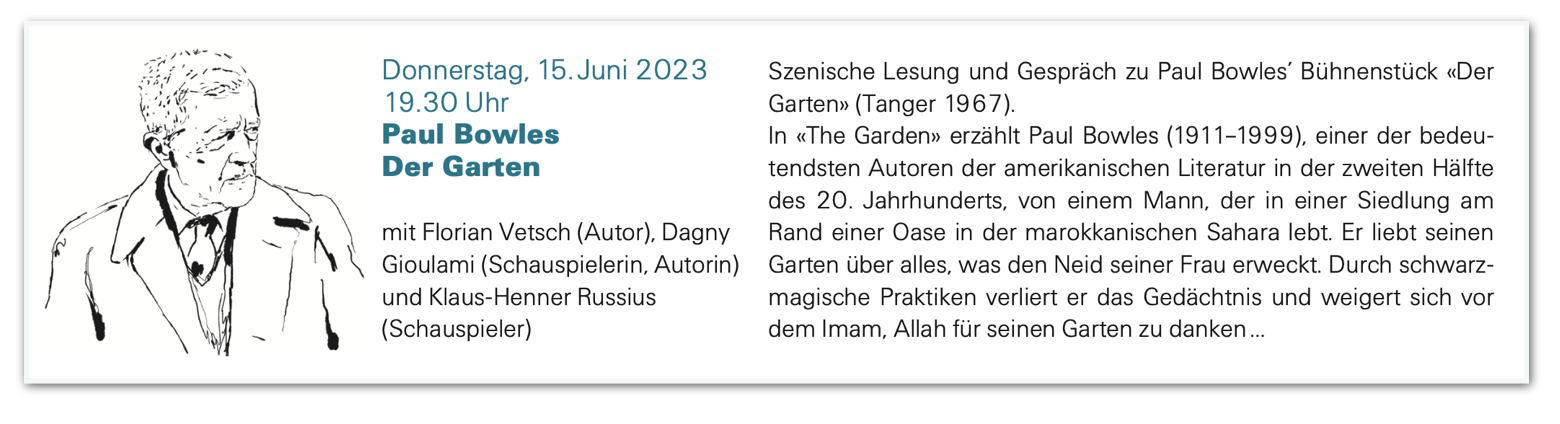
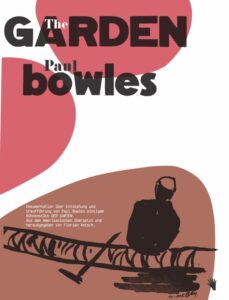




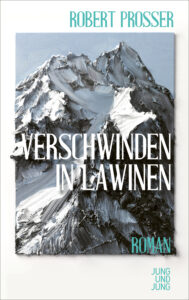


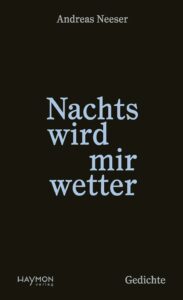



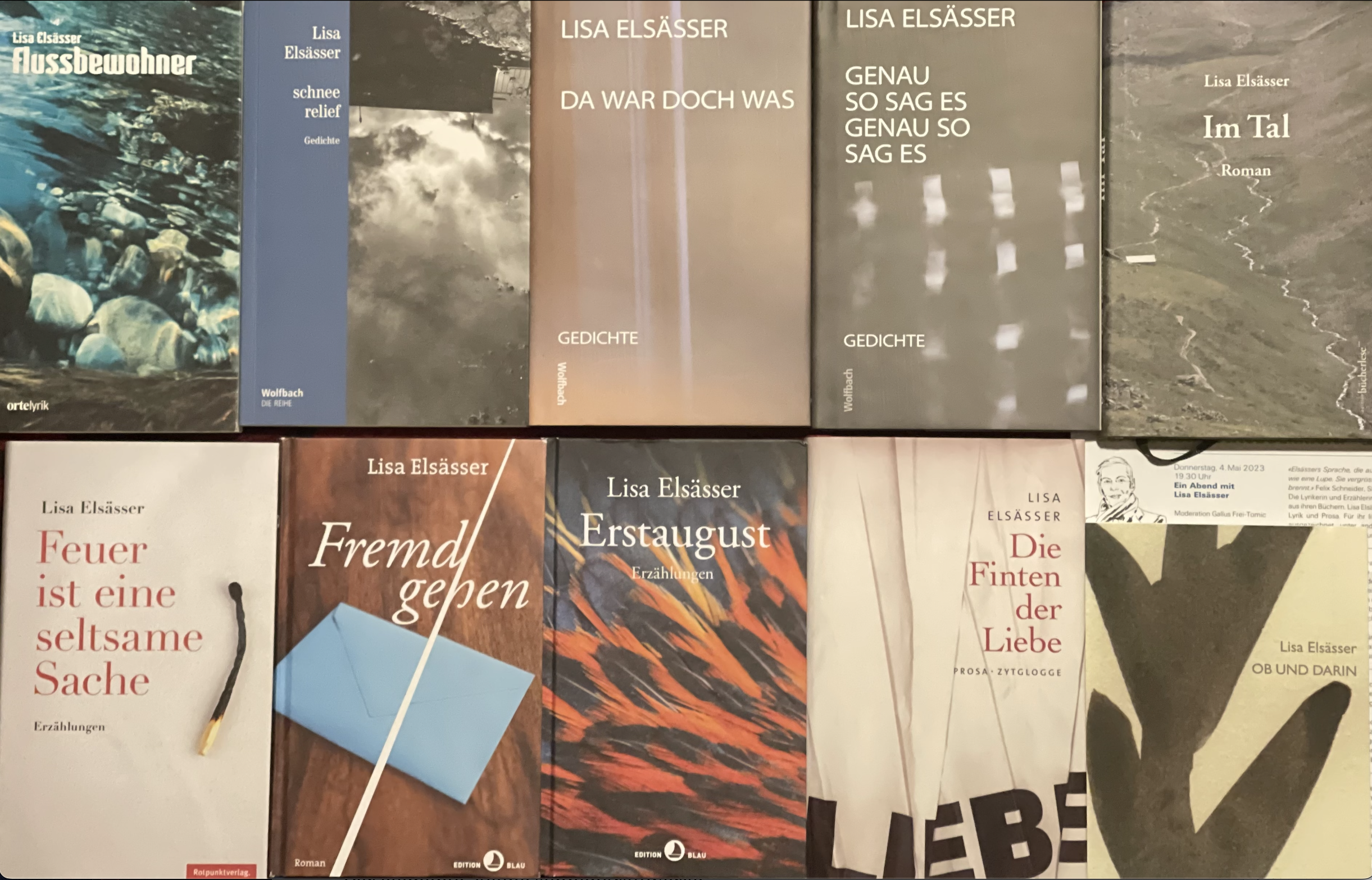


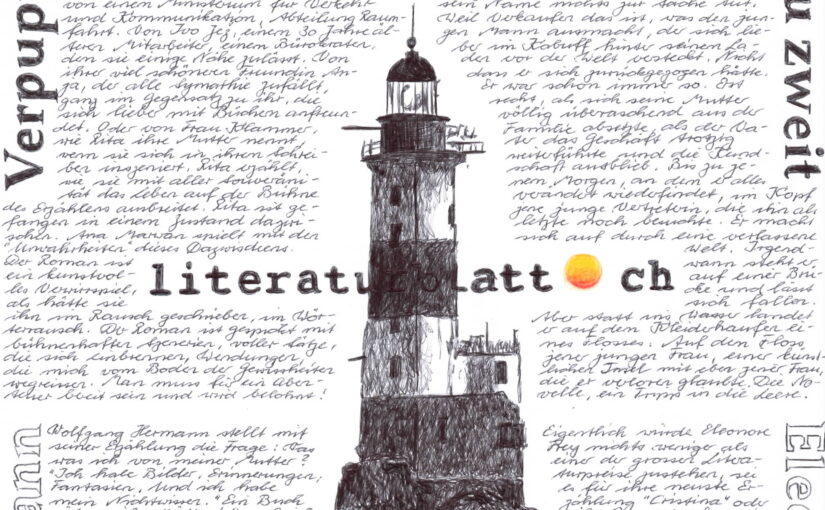
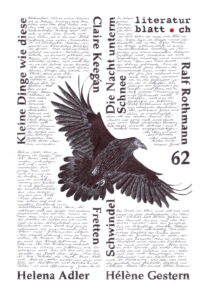 Kontoangaben:
Kontoangaben: