Rolf Lappert schrieb sich mit der ersten Szene seines Romans „Über den Winter“ tief in meine „literarische Erinnerung“. Lenard Salm, die Hauptperson, findet weit weg von seiner Heimat am Strand ein angeschwemmtes, totes Kind. Eine Szene, die er beschrieb, bevor das beinahe entsprechende Pressebild um die Welt ging. Rolf Lappert schreibt an einem neuen Roman, den ich mit viel Neugier erwarte.
Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben? Ganz ehrlich!
Ich erzähle tatsächlich gerne Geschichten, denke sie mir gerne aus, fasse sie gerne in Worte. Die Stoffe und Figuren trage ich oft jahrelang mit mir herum, und wenn sie nicht irgendwann weg sind, verschwunden, dann befasse ich mich ernsthaft mit ihnen, das heißt, ich überlege, wie ich aus all dem Angesammelten eine Geschichte, einen Roman machen kann. Schriftsteller erfinden Welten, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass diese Welten fremd sein müssen wie in einem Fantasy- oder Science Fiction-Buch. Dieses Erschaffen von Räumen, Atmosphären, Charakteren, Gefühlen etc. mithilfe von Wörtern ist ein anstrengender und anspruchsvolles Unterfangen, aber auch ein spannendes und – wenn es gelingt – ein erfüllendes.
Wo und wann liegen in ihrem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente vor denen sie sich fürchten?
Anzufangen ist immer schön, vor allem, wenn man die ersten Seiten schreibt und merkt, dass man den Ton gefunden hat, den man erzeugen will. Es gibt in jedem Buch Abschnitte, vor denen ich mich lieber drücken würde, die aber in die Geschichte müssen, weil sie etwas Wichtiges erzählen. Das kann eine einzelne Szene aber auch ein ganzes Kapitel sein. Ein schöner, vielleicht der schönste Moment im Arbeitsprozess ist natürlich der Schluss. Wenn man merkt: Jetzt müssen noch fünf Sätze geschrieben werden, dann ist das Werk abgeschlossen – ein erhebender Augenblick. (Kurz danach kann man in ein tiefes Loch fallen – aber das ist eine andere Geschichte…)
Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?
 Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist.
Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist.
Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Oder werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegenüber andern Künsten anders gemessen? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?
Hilft ein Buch, auf soziale Missstände aufmerksam zu machen – gut. Tut es das nicht – auch gut. Romane sind keine Transparente mit Parolen, die der Autor vor sich her trägt. Eine gute und gut geschriebene Geschichte hat die Berechtigung, genau das zu sein und nicht mehr und nicht weniger als das. Leistet die Geschichte mehr, ist das großartig, aber es soll nicht das Ziel – und schon gar nicht der Sinn – des Schreibens sein, Politik zu betreiben. Das tue ich im Privaten, indem ich mich engagiere, äußere, wähle. Warum sollte ich als Schriftsteller politischer sein als, sagen wir, ein Bäcker oder Versicherungsvertreter? Ist mir ein Anliegen wichtig und ich werde angefragt, dann tue ich mein Bestes, um der Sache zu dienen – eine Sonderstellung nehme ich dabei nicht ein.
Inwiefern schärft Ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung
Man lernt beim Schreiben, empathisch zu sein, sich in Menschen hineinzufühlen und -denken. Beim Lesen auch – wenn der Roman etwas taugt. Ein Roman ohne Empathie ist für mich wertlos.
Es gibt die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text. Muss man diese Einsamkeit als Schreibende(r) mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür/dagegen?
 Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein.
Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein.
Gibt es für Sie Grenzen des Schreibens? Grenzen in Inhalten, Sprache, Textformen, ohne damit von Selbstzensur sprechen zu wollen?
Es gibt Themen und Formen, die mich nicht interessieren. Ich befasse mich mit ihnen weder als Autor noch als Leser. Thriller, Fantasy, Science Fiction, Horror, Romantic Comedy, Historienschinken: Alles nicht meins.
Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?
Geheimtipp? Da muss ich passen. Obwohl ich kein Mainstream-Leser bin, kann ich mich auch nicht gerade als Entdecker bezeichnen… Joseph Conrads „Herz der Finsternis“, das ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen habe, kann ich ja wohl nicht unbedingt als meine literarische Entdeckung präsentieren, oder?
Zählen Sie 3 Bücher auf, die Sie prägten, die Sie vielleicht mehr als einmal gelesen haben und in Ihren Regalen einen besonderen Platz haben?
Philip Roth „Der menschliche Makel“. Michael Chabon „Wonder Boys“. David Mitchell „Der dreizehnte Monat“.
Frisch hätte wohl auch als Architekt sein Auskommen gefunden und Dürrenmatt kippte eine ganze Weile zwischen Malerei und dem Schreiben. Wären Sie nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller, hätten sich die Bücher trotz vieler Versuche nicht verlegen lassen, hätte es eine Alternative gegeben? Gab es diesen Moment, der darüber entschied, ob Sie weiter schreiben wollen?
Ich habe Grafiker gelernt und hätte als solcher arbeiten können, Mitte der Achtzigerjahre war die Werbebranche noch attraktiv für alle, die mit einem coolen Job sehr schnell sehr viel Geld verdienen wollten. Aber ich wollte schreiben, unbedingt. Hätte das nicht funktioniert, wären da durchaus Alternativen gewesen, Tierfilmer zum Beispiel, oder überhaupt Dokumentarfilmer, oder Tauchlehrer, oder Betreiber eines Öko-Hotels (doch woher das Geld nehmen?), oder Drehbuchautor – was ich ja sieben Jahre lang tatsächlich war. Und natürlich gibt es -zig andere Berufe, die ich hätte ausüben können, um Geld zu verdienen, Schreiner etwa oder Gärtner. Glücklicherweise hat es mit dem Schreiben geklappt.
Was tun Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die Ihnen nicht gefallen?
Wenn sie mir überhaupt nicht gefallen, lese ich sie nach den ersten Seiten auch nicht zu Ende und verschenke sie weiter oder bringe sie ins Brockenhaus. Bücher wegzuwerfen fällt mir schwer. Sehr selten zerfleddere ich ein besonders missratenes und schmeiße es voller Abscheu und Genugtuung in die Altpapiertonne.
Lieber Herr Lappert, vielen, vielen Dank!
 Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.
Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.





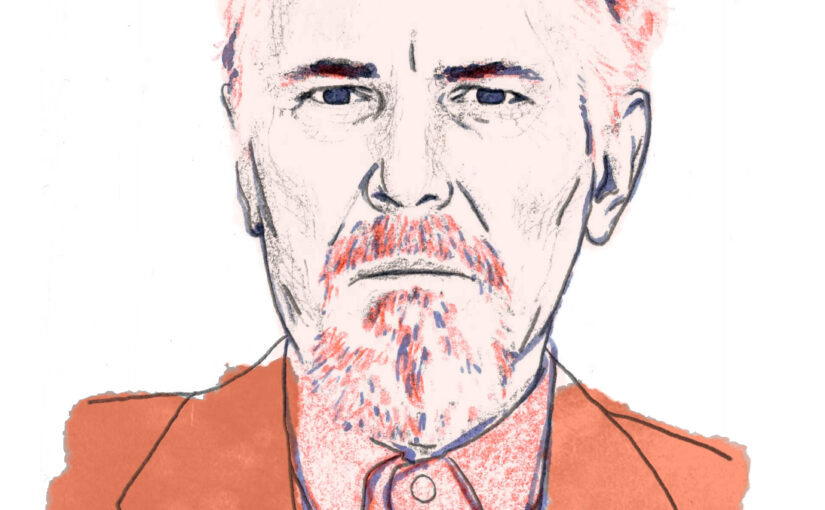



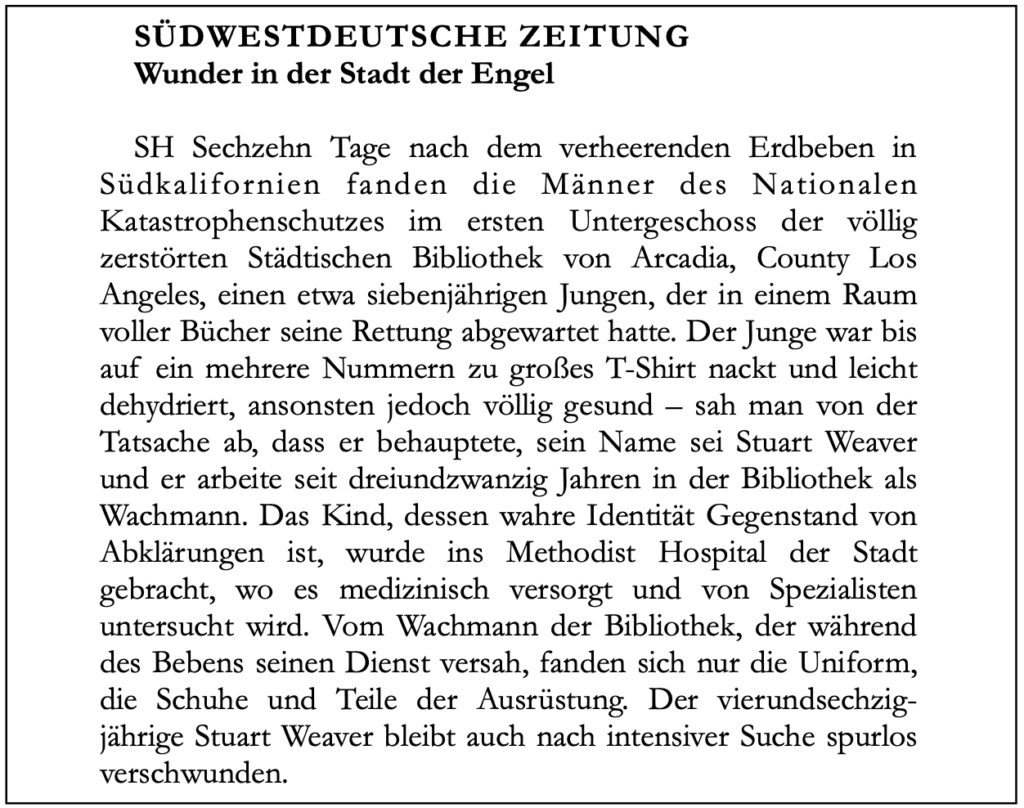


 Der erste Jahrgang bei den Nominierten zum Schweizer Buchpreis 2008 war ein aussergewöhnlich starker Jahrgang mit klingenden Namen, faszinierenden Büchern und einer frischen Stimme mit einem Erstling: Anja Jardine mit «Als der Mond vom Himmel fiel», Adolf Muschg «Kinderhochzeit», Peter Stamm «Wir fliegen», Lukas Bärfuss «Hundert Tage» und Rolf Lappert mit «Nach Hause schwimmen».
Der erste Jahrgang bei den Nominierten zum Schweizer Buchpreis 2008 war ein aussergewöhnlich starker Jahrgang mit klingenden Namen, faszinierenden Büchern und einer frischen Stimme mit einem Erstling: Anja Jardine mit «Als der Mond vom Himmel fiel», Adolf Muschg «Kinderhochzeit», Peter Stamm «Wir fliegen», Lukas Bärfuss «Hundert Tage» und Rolf Lappert mit «Nach Hause schwimmen».
 dann auch etwas ganz anderes, nämlich eine Art Mischung aus Familien- und Abenteuerroman mit Schauplätzen in Irland und auf den Philippinen. Dann kam das Jugendbuch »Pampa Blues« und 2015 der Roman »Über den Winter«, der erneut die Erwartungshaltungen der Leserschaft unterlief. Am ehesten in die sprachlich-stilistische Nähe von »Nach Hause schwimmen« kommt wahrscheinlich mein in Arbeit befindlicher Roman, in dem ich wieder mit vielen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen jongliere und eine fast schon epische Geschichte erzähle. Auf jeden Fall wird dieser Roman mein bisher umfangreichster.
dann auch etwas ganz anderes, nämlich eine Art Mischung aus Familien- und Abenteuerroman mit Schauplätzen in Irland und auf den Philippinen. Dann kam das Jugendbuch »Pampa Blues« und 2015 der Roman »Über den Winter«, der erneut die Erwartungshaltungen der Leserschaft unterlief. Am ehesten in die sprachlich-stilistische Nähe von »Nach Hause schwimmen« kommt wahrscheinlich mein in Arbeit befindlicher Roman, in dem ich wieder mit vielen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen jongliere und eine fast schon epische Geschichte erzähle. Auf jeden Fall wird dieser Roman mein bisher umfangreichster.
 Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist.
Ich brauche beim Schreiben Ruhe. Musikhören geht gar nicht. Jede Ablenkung und Störung bedeutet Ungemach. Je nach Stimmung lese ich abends oder nachts in einem Buch. Das kann auch ein Roman sein, denn ich bin immun gegen unbewusstes Übernehmen von Ideen, Formulierungen, Stilmitteln. Trifft ein Roman die Atmosphäre, die Melodie, den Rhythmus meines eigenen, in Arbeit befindlichen Buches, dann finde ich das schön. Ein Film kann den gleichen Effekt haben. Es kommt vor, dass ich, während ich an einem neuen Roman arbeite, vor dem Bücherregal stehe und Romane in die Hand nehme, nur um darin zu blättern, einzelne Sätze oder Abschnitte zu lesen und sie dann zurück in die Reihen zu stellen. Dabei handelt es sich vermutlich um ein Sichvergewissern, dass es noch viele andere vom Schreibzwang Befallene gibt, dass es tatsächlich Wortfolgen, schriftlich festgehaltene Szenen gibt, die in der Lage sind, einen zu bewegen, zu rühren, oder die so genial geschrieben sind, dass man sie voller Bewunderung (und ein wenig Neid) immer wieder lesen muss. Auch das Gewicht eines Buches in der Hand zu wiegen, hilft beim Schreiben, nachzusehen, wie der Roman aufgebaut, unterteilt ist. Gibt es Kapitelüberschriften? Wie lautet der erste Satz? Wie der letzte? Gibt es ein Motto, eine Widmung, eine Danksagung? Wahrscheinlich geht es bei diesem Stöbern schlicht und ergreifend darum, den Beweis dafür zu haben, dass man nicht alleine ist mit der Literatur, dass es Bücher und Autoren und Verlage und Leser gibt und die Welt noch nicht völlig den Bach runter ist. Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein.
Es gibt sie und es muss sie geben. Jede Minute Schreiben ist eine Minute Einsamkeit, zumindest vermittelt sich dieser Eindruck dem Außenstehenden. Denn man sitzt zwar alleine an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer, aber man ist in Begleitung seiner Figuren, die vom ersten Satz an ein Leben führen und bald zu Menschen werden, Weggefährten. Aber natürlich: Es ist ein einsamer Job, Familienmitglieder und Freunde werden oft vernachlässigt, soziale Kontakte abgebrochen oder zumindest für eine Weile auf Sparflamme gehalten. Würde ich lieber in einem Großraumbüro arbeiten? Nein. Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.
Rolf Lappert wurde 1958 in Zürich geboren und lebt in der Schweiz. Er absolvierte eine Ausbildung zum Grafiker, war später Mitbegründer eines Jazz-Clubs und arbeitete zwischen 1996 und 2004 als Drehbuchautor. Bei Hanser erschien 2008 der Roman «Nach Hause schwimmen», der im selben Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, 2010 «Auf den Inseln des letzten Lichts», 2012 «Pampa Blues» und und zuletzt «Über den Winter». Rolf Lappert war auch schon Gast hier in Amriswil an einer Hauslesung.







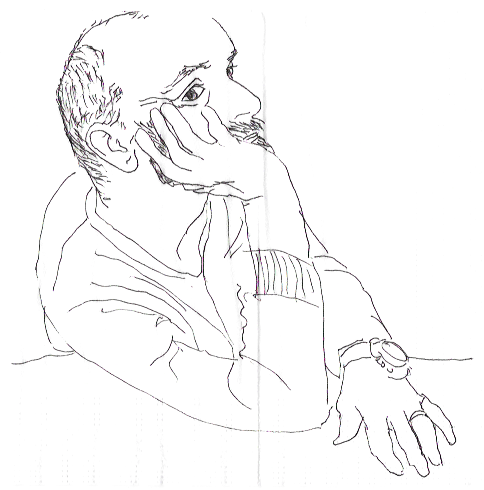
 Heinz Helle «Eigentlich müssten wir tanzen», Suhrkamp
Heinz Helle «Eigentlich müssten wir tanzen», Suhrkamp


 Rolf Lappert «Über den Winter», Hanser
Rolf Lappert «Über den Winter», Hanser