Das alljährlich stattfindende Literaturfestival „Erzählzeit ohne Grenzen“ ist einmalig. Zusammengerechnet ist die Besucherzahl imposant, die Liste der Autorinnen und Autoren mehr als beachtlich, die Veranstaltungsorte von abenteuerlich bis beeindruckend und meine Not als Besucher jedes Jahr die gleiche.
Man müsste in den Tagen vom 7. – 15. April mehrere Leben zur Verfügung haben, um all jenen Schreibenden zu lauschen, auf die man doch eigentlich schon lange wartet. Diesmal waren es drei Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller, deren Bücher ich ihnen ans Herz legen möchte.
„Keyserlings Geheimnis“ von Klaus Modick, Kiepenheuer und Witsch, 235 Seiten
Klaus Modick, Autor von mehr als 20 Romanen, interessierte sich mit der Lektüre der Werke Eduard von Keyserlings (1855 – 1918, Schriftsteller und Dramatiker des Impressionismus) immer mehr für dessen Biografie. Ein Leben allerdings, dass viele weisse Flecken oder 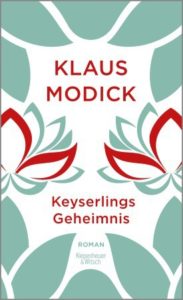 schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.
schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.
“Jahre danach“ von Angelika Klüssendorf, Kiepenheuer und Witsch, 156 Seiten
Nach „Mädchen“ und „April“ ist „Jahre danach“ der Schluss einer Trilogie. Die Geschichte von April, von der Kindheit bis hinein in ein Schriftstellerleben. „Jahre danach“ erzählt in sich abgeschlossen von Aprils Ehe zu Ludwig, den die zuerst als 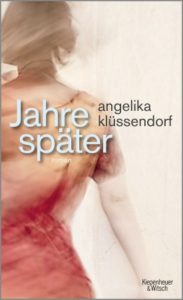 aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!
aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!
“Die Königin schweigt“ von Laura Freudenthaler, Droschl, 206 Seiten
Nicht von den Märchen aus der Vergangenheit möchte Fannys Enkelin hören, viel lieber von der wirklichen Vergangenheit. Fanny erinnert sich. Vom Vater mit der harten Brust, von der Wärme ihrer 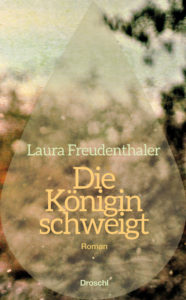 Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!
Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!
eine ausführlichere Rezension auf literaturblatt.ch
“Stillhalten“ von Nina Jäckle, Klöpfer & Meyer, 189 Seiten
Tamara sitzt in ihrem Zimmer. Ihr Leben ist abgeschlossen wie das Haus am künstlichen See, in dem sie wohnt. Sie schreibt in ihrem Zimmer in ihr Abrechnungsbuch. Tamara ist alt, war einst Tänzerin, 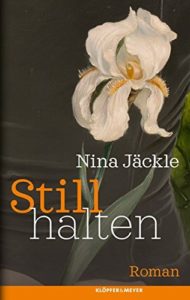 vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
Nina Jäckles Mann trägt vor der Lesung im Kunsthaus Singen eine grosse Tasche mit ins Obergeschoss, wo fast 100 Gäste auf die weitgereiste Autorin warten. Er packt ein Bild aus, das Bild, das „Original einer Fälschung“, lächelt dieser. Die Replik des Bildes, das meist in Stuttgart hängt, wenn es nicht irgendwoin den Zentren der Welt auf Reisen ist.
Erfrischend war, wie Nina Jäckle den Bilddeutungen des Kunsthistorikers widersprach und deutlich machte, dass die Wissenschaft mit ihrer Deutung auch „unrecht“ haben kann.
eine ausführlichere Rezension auf literaturblatt.ch
Ich liess mich von „Erzählzeit ohne Grenzen“ faszinieren. Ein literarisches Freudenfest, ein Grossanlass, der einmalig ist. Ein grosses Dankeschön an das Organisationsteam, allen voran Monika Bieg und Barbara Tribelhorn.


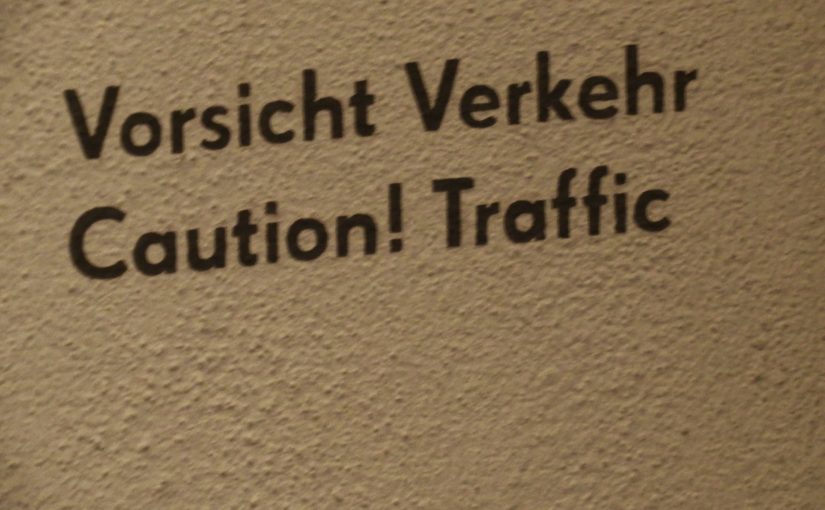
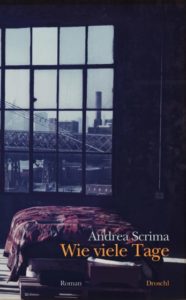 «Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung.
«Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung. Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.
Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.
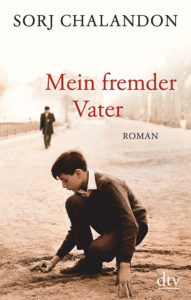 wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden.
wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden. Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.
Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.
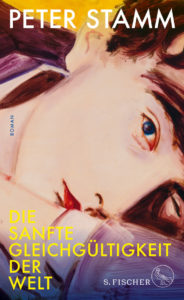 die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.
die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.

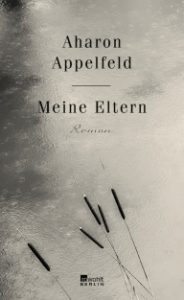 geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann.
geniesst, was einem nur noch die Natur geben kann; «Frieden». Umgeben von Menschen, die genau spüren, dass eine neue Zeitrechnung begonnen hat: Karl König, ein Schriftsteller, der an seinen Fähigkeiten zweifelt. Eine Wahrsagerin, die aus den Händen die Zukunft liest der Missachtung verzweifelt. Pepi, die einmal mit einem Christen liiert war und in diesem besonderen Sommer auf Männerschau ist. Der Einbeinige, der sein Bein im letzten Weltkrieg verlor oder Doktor Zajger, der sich nur hier am Fluss vor seiner Arbeit retten kann. Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»
Aharon Appelfeld, 1932 in Jadowa in der rumänischen Bukowina geboren und 2018 bei Tel Aviv gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Israels und zugleich «zu den großen Erzählern Osteuropas» (Imre Kertész). Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen wurden in fünfunddreissig Sprachen übersetzt, auf Deutsch erschienen zuletzt «Meine Eltern», «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Über Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, sagte Philip Roth: «So einzigartig wie das, worüber er schreibt, ist Appelfelds Sprache.»
 Aber Hana ist auch nach einem Jahrzehnt als Mark nicht vergessen. Eine Cousine, die wie viele andere mit ihrer Familie auswanderte und in den USA eine neue Existenz aufbaute, schreibt Hana Briefe. Und im Oktober 2001, fast 15 Jahre nach der ersten Metamorphose, beginnt der langsame Weg vom kettenrauchenden, trinkfesten Mark zurück zu Hana, der nur in grösstmöglicher Distanz von ihrer Heimat die zweite Metamorphose gelingen kann. Wieder eine Verwandlung, mit der sie alles verlieren kann und wieder aufnimmt, was sie einst für immer ablegte.
Aber Hana ist auch nach einem Jahrzehnt als Mark nicht vergessen. Eine Cousine, die wie viele andere mit ihrer Familie auswanderte und in den USA eine neue Existenz aufbaute, schreibt Hana Briefe. Und im Oktober 2001, fast 15 Jahre nach der ersten Metamorphose, beginnt der langsame Weg vom kettenrauchenden, trinkfesten Mark zurück zu Hana, der nur in grösstmöglicher Distanz von ihrer Heimat die zweite Metamorphose gelingen kann. Wieder eine Verwandlung, mit der sie alles verlieren kann und wieder aufnimmt, was sie einst für immer ablegte.

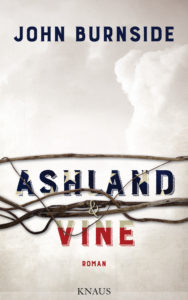 «Wenn Menschen Geschichten erzählen, lügen sie, was die Ereignisse betrifft, aber nicht über die anderen Dinge, da lügen sie nicht – zumindest nicht absichtlich.»
«Wenn Menschen Geschichten erzählen, lügen sie, was die Ereignisse betrifft, aber nicht über die anderen Dinge, da lügen sie nicht – zumindest nicht absichtlich.» John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis.
John Burnside, geboren 1955 in Schottland, ist einer der profiliertesten Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Der Lyriker und Romancier wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Corine-Belletristikpreis des ZEIT-Verlags, dem Petrarca-Preis und dem Spycher-Literaturpreis.
 der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen.
der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen. Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.
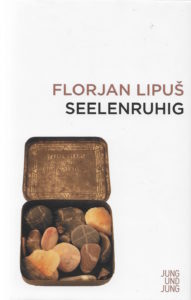 wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird.
wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird. Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.
Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.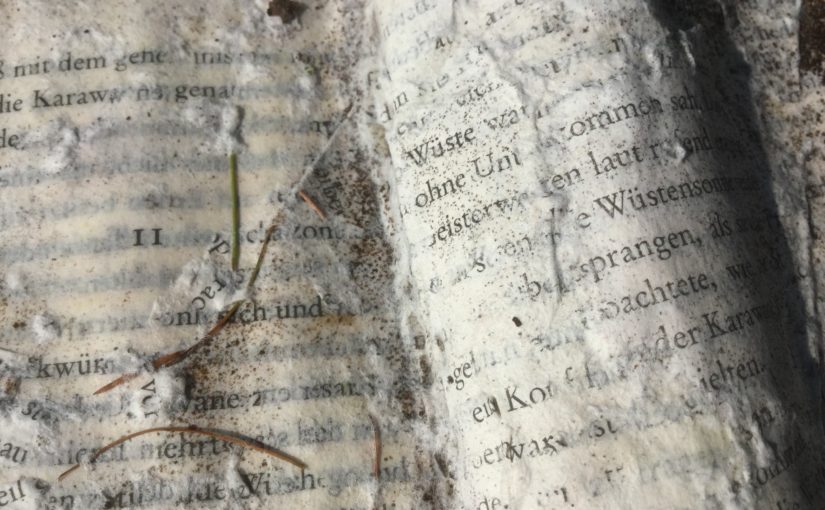
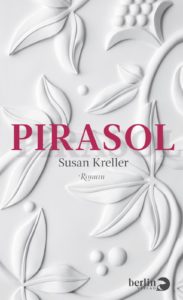 mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war.
mit Schlägen, Missachtung, allen Formen des Entzugs gestraft, von seiner Mutter schutzlos allein gelassen, weil er sie mit in den Abgrund gerissen hätte. Dorthin zurück, woher sie vor der Ehe mit Willem gekommen war: Traumatisiert vom Verschwinden ihrer Mutter während der Feuerstürme über Deutschland und ihres Vaters ins KZ Oranienburg bei Berlin. In den letzten Kriegstagen versteckte eine Nachbarin Gwendolin hinter einem Medizinschrank vor den einrückenden Russen. Danach irrte sie herum, bis ihr Vater auftaucht, ein Totgeglaubter, einst ein sprachgewaltiger Theaterkritiker. Ausgezehrt bis auf die Knochen vor ihrer Wohnungstür, nur noch ein Gespenst, ein stummes Überbleibsel dessen, was einst Familie war. Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.
Susan Kreller, geboren 1977 in Plauen, studierte Germanistik und Anglistik und promovierte über englischsprachige Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie 2012 mit dem Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Schneeriese«. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Bielefeld. »Pirasol« ist ihr Roman-Debüt im Berlin Verlag.