Menton, eine Stadt an der Côte d’Azur im Spätherbst. Moritz Wandeler, selbstständiger Anlageberater, alleinstehend, nimmt sich auf unbestimmte Zeit ein Zimmer in der heruntergekommenen Pension „Vue Sur la mer“. Ein kleines Zimmer mit Meerblick; ein Bett, ein Stuhl, ein Schrank. Er ist ausgestiegen. Ausgestiegen aus dem Zug, ausgestiegen aus seiner Welt, ausgestiegen aus seinem Trott.
Ein Mann standet. Er nimmt sich fast ohne Gepäck ein Zimmer, schaut aufs Meer und die Menschen in der Stadt, spaziert und lässt in seinem Bewusstsein Erinnerungen, Gedanken, Geschichten, Legenden branden. Gedanken eines Menschen, der sich nicht vom Fremden ablenken lässt. Das Smartphone ohne Akku, den Laptop im Zimmerschrank weggesperrt. Was ihn wegträgt, ist das Eigene, das was aufkommt, wenn man sich mit einem Mal Zeit und Raum gibt und lässt.
„Es war nicht zu bestreiten, Wandeler fühlt sich zunehmend wie an den Rand gespült.“
Und wer sich an den Rand gespült fühlt, von den stetigen Brandungswellen des Alltags, wenn ihn das Wasser nicht mehr erreicht und er auf der Mole, dem Fels liegenbleibt, dann sieht man das Branden mit einem Mal aus der Distanz, ist nicht mehr Teil davon.
Ruth Erat lässt offen, warum sich ihr Protagonist in jene Situation brachte. So wie es im Leben oft offen bleibt, warum ist, wie es ist. Ruth Erat will nicht erklären, nicht ergründen. Sie geht mit Moritz Wandeler mit.
Je mehr sich Wandeler seinen Gedanken, seinen Erinnerungen hingibt, desto mehr verliert er sich, setzt sich von seiner Umgebung ab, wird zum Sonderling.
Die einzige Person im Leben Wandelers, die er an den Stand, an den Ort am Meer mitnimmt, ist seine Mutter. Schon lange gestorben. Eine Malerin, von der er die Namen und Gerüche der Farben noch immer in Ohren und Nase hat, von der er gelernt hat, die Dinge auch anders zu sehen. Wie sie sang, französisch. Er kauft sich ein Heft und beginnt zu schreiben, im Zimmer oder auf der Bank mit Blick aufs Meer, manchmal Gedanken, manchmal auch nur die Farben, die Gerüche.
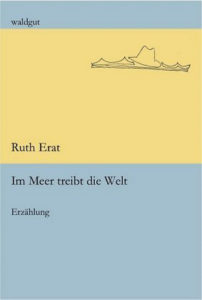 Und dazwischen immer wieder das Wort „Assez“, als wolle sich Wandeler vor der Auflösung schützen, dass ihn einer der Brecher zerschlägt, dass ihn Erinnerungen und Gedanken zurückholen, dorthin, von wo er sich mit seinem Aussteigen abgekoppelt hatte. Er macht Ordnung, Inventur in seinem Leben, legt aus. „Assez!“
Und dazwischen immer wieder das Wort „Assez“, als wolle sich Wandeler vor der Auflösung schützen, dass ihn einer der Brecher zerschlägt, dass ihn Erinnerungen und Gedanken zurückholen, dorthin, von wo er sich mit seinem Aussteigen abgekoppelt hatte. Er macht Ordnung, Inventur in seinem Leben, legt aus. „Assez!“
Ruth Erat malt, wenn sie schreibt. Ihre Prosa wirkt wie Standbilder, ein gemaltes Bild nach dem andern. Es ist nicht die Geschichte, die vorantreibt, ein sich aufbauender Plott. So sehr Moritz Wandeler sinniert, reflektiert und seine Gedanken treiben lässt, so sehr malt Ruth Erat literarisch dichte Bilder, mischt Klangfarben, hebt mit Formulierungen Gedankengänge hervor, koloriert innere wie äussere Bilder eines Menschen, der aus seinem Rahmen hinausgetreten ist. Was wenig erstaunt, wenn man das Schaffen der Künstlerin kennt. Ruth Erat malt seit Jahrzehnten, verfasst Gedichte, zeichnet.
Ganz offensichtlich geht es der Autorin nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Der Text um Moritz Wandeler sind ihre Leinwände, eine lange Serie von Bildern, die sowohl von Nahem wie aus der Ferne zu betrachten sind. Wer die Erzählung „Im Meer treibt die Welt“ lesen und geniessen will, muss auf anderes neugierig sein als auf eine Story. Selbst die Figur Wandeler bleibt während des Lesens in seltsamer Distanz, erschliesst sich nie ganz, bleibt ein Rätsel. Wer sich von ihrem Erzählen mitnehmen lassen will, muss sich wie bei den Bildern der Malerin Ruth Erat hineinlesen, einlassen in eine Komposition, in ihre kunstvolle, zarte Sprache, den zuweilen mäandernden Erzählfluss.
Man bleibt allein mit Moritz Wandeler, geht mit ihm zwischen Meer und Land herum, sieht andere Menschen, ohne je wirklich mit ihnen in Kontakt zu kommen. „Im Meer treibt die Welt“ ist der Roman eines Gestrandeten, dessen Gedanken wie Brandung über sein Innerstes schwappen.
Eigen ist auch die Erzählperspektive, denn Ruth Erat wechselt von einer Erzählstimme, aus der Er-Perspektive immer wieder zum Selbstgespräch. Und dann spricht Wandeler zu sich selbst in der Du-Form, treibt sich an, kommentiert, gibt sich eine sprachliche Spur, sucht nach Sinn und Muster, nach Antworten und Klarheit.
„Kein Wunder, stellte Wandeler fest, dass der Mensch am Ende derart ermüdet.“
Und dass „Im Meer treibt die Welt“ im Waldgut Verlag von der Dichterin Irène Bourquin herausgegeben wurde, verbindet drei Sprachwelten, jene des Verlags, der Herausgeberin und jene Ruth Erats; die Welten, die sprachlich verschwistert sind, die sich nur der Sprache verpflichtet fühlen.
 Ruth Erat wuchs in Bern und Arbon auf, wurde Lehrerin, studierte an der Universität Zürich und promovierte mit einer Arbeit über Mechthild von Magdeburg. Sie engagierte sie sich politisch und wurde 2015 ins Stadtparlament von Arbon gewählt. Daneben war und ist sie als Malerin, Zeichnerin und Schriftstellerin tätig. 1999 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Im gleichen Jahr erschien bei Suhrkamp ihre Erzählung «Moosbrand». Ruth Erat ist Verfasserin von erzählenden, lyrischen und dramatischen Werken, zeichnet, malt und gestaltet Installationen.
Ruth Erat wuchs in Bern und Arbon auf, wurde Lehrerin, studierte an der Universität Zürich und promovierte mit einer Arbeit über Mechthild von Magdeburg. Sie engagierte sie sich politisch und wurde 2015 ins Stadtparlament von Arbon gewählt. Daneben war und ist sie als Malerin, Zeichnerin und Schriftstellerin tätig. 1999 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Im gleichen Jahr erschien bei Suhrkamp ihre Erzählung «Moosbrand». Ruth Erat ist Verfasserin von erzählenden, lyrischen und dramatischen Werken, zeichnet, malt und gestaltet Installationen.
Rezension zu «Zum Trocknen aufgehängte Flügel» (Waldgut Verlag) auf literaturblatt.ch
Webseite der Malerin und Autorin
Beitragsbild © Ruth Erat «Zum Rand hin», Gouache und Kohle



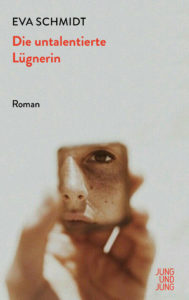 sich auf ihre Gesundheit auswirkten; Essstörungen. «Die untalentierte Lügnerin» ist aber kein Roman über Essstörungen. Maren kommt zurück zu einer Familie, die sich schon seit Jahren im Zustand des Zerfalls befindet; Vater und Mutter zerstritten und trennten sich, der Vater lebt weit weg, die Mutter heiratet wieder, mehr die Sicherheit und das Geld als den Mann, Marens Stiefvater lebt ein Doppelleben, ihr älterer Bruder hat sich nach Finnland abgesetzt und ihr jüngerer Halbbruder studiert in der Ferne den Waldrapp. Obwohl Eva Schmidt das Familiengeflecht bis in Kleinigkeiten schildert, obwohl sie deutlich macht, wie vielschichtig und verknotet dieses Gefüge ist, ist «Die untalentierte Lügnerin» auch kein Familienroman, kein Soziogramm. Einzelne Figuren, wie der Vater und Jazzmusiker in der Hauptstadt, bleiben skizzenhaft. Eva Schmidt bemüht sich viel mehr um die Wirkung dieser Personen in Marens Leben.
sich auf ihre Gesundheit auswirkten; Essstörungen. «Die untalentierte Lügnerin» ist aber kein Roman über Essstörungen. Maren kommt zurück zu einer Familie, die sich schon seit Jahren im Zustand des Zerfalls befindet; Vater und Mutter zerstritten und trennten sich, der Vater lebt weit weg, die Mutter heiratet wieder, mehr die Sicherheit und das Geld als den Mann, Marens Stiefvater lebt ein Doppelleben, ihr älterer Bruder hat sich nach Finnland abgesetzt und ihr jüngerer Halbbruder studiert in der Ferne den Waldrapp. Obwohl Eva Schmidt das Familiengeflecht bis in Kleinigkeiten schildert, obwohl sie deutlich macht, wie vielschichtig und verknotet dieses Gefüge ist, ist «Die untalentierte Lügnerin» auch kein Familienroman, kein Soziogramm. Einzelne Figuren, wie der Vater und Jazzmusiker in der Hauptstadt, bleiben skizzenhaft. Eva Schmidt bemüht sich viel mehr um die Wirkung dieser Personen in Marens Leben.

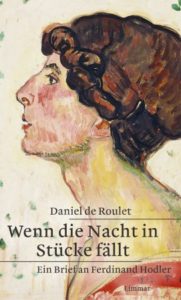 Eine Liebe, aus der ein Kind entstand, Pauline, während die Ehe mit Berthe kinderlos blieb. Eine Liebe, die mit Valentines Krebserkrankung schon wenige Jahre später tiefe Schatten bekam. Eine Liebe, die Leidenschaft transformierte, von obsessiver Körperlichkeit zu innigstem Nebeneinander am Kranken- und Sterbebett. Eine Liebe, die auch den Blick und das Schaffen des Künstlers transformierte. Mit einem Mal war es nicht mehr Symbolismus und Verklärung, sondern ganz direkter Realismus. Die Liebe zu Valentine und das Sterben dieser Frau erschütterten nicht nur sein Dasein, sondern auch seinen Blick auf die Welt, seine Malerei, jene Malerei, die der Schriftsteller Daniel de Roulet so sehr erschüttert und zu verstehen versucht.
Eine Liebe, aus der ein Kind entstand, Pauline, während die Ehe mit Berthe kinderlos blieb. Eine Liebe, die mit Valentines Krebserkrankung schon wenige Jahre später tiefe Schatten bekam. Eine Liebe, die Leidenschaft transformierte, von obsessiver Körperlichkeit zu innigstem Nebeneinander am Kranken- und Sterbebett. Eine Liebe, die auch den Blick und das Schaffen des Künstlers transformierte. Mit einem Mal war es nicht mehr Symbolismus und Verklärung, sondern ganz direkter Realismus. Die Liebe zu Valentine und das Sterben dieser Frau erschütterten nicht nur sein Dasein, sondern auch seinen Blick auf die Welt, seine Malerei, jene Malerei, die der Schriftsteller Daniel de Roulet so sehr erschüttert und zu verstehen versucht.

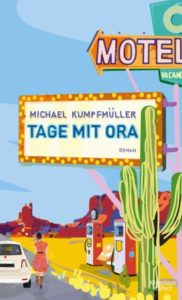 gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.
gemeinsame Reise als Chance sich kennenzulernen? Zum einen ist man als Schicksalsgemeinschaft aneinander gebunden. Man fliegt im gleichen Flieger, fährt im selben Auto, sitzt am gleichen Tisch und teilt (vielleicht, warum nicht) das gleiche Zimmer und Bett. 13 Tage durch den Süden der USA, an der Hand genommen von einem Song der Indie-Band Bright Eyes und ihrem Song „June On The West Coast“. Eine Reise nicht als Touristen auf der Jagd nach Sehenswürdigkeiten, sondern eine Reise zum andern. Die langen Fahrten durch die Wüsten und wüsten Orte als Kontrast zu dem, was in den beiden passiert; Landschaft, Städte, Koffer und Hotels als Kulisse für ein Abenteuer, das sich eigentlich nur zwischen den beiden abspielt.

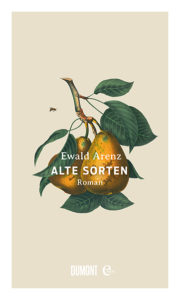 Aber auch Sally spürt und merkt, dass das Leben der Frau auf dem Hof irgendwann ordentlich aus dem Tritt gekommen sein musste. Liss ist allein, wird nicht besucht. Fragen nach ihrer Vergangenheit blockt sie genauso wie Sally jene nach ihrer Gesundheit. Und als Liss mit Sally im Wald ein Reh mit ihrem Traktor verletzt, Liss mit aller Selbstverständlichkeit eine Pistole aus einer Box holt und dem Leiden des Rehs mit einem schnellen Schuss ein Ende setzt, weiss Sally endgültig, dass Liss nicht einfach nur verschroben und verschlossen ist. Liss ist geprügelt von einer Vergangenheit, einem dominanten Vater, der seine Macht einzusetzen wusste. Sie verliebte sich in einem Mann. Eine Liebe, die grösstmögliche Freiheit versprach und in einem fatalen Reflex endete. Sally ist umklammert von Mutter- und Vaterliebe, die ihr nicht bloss den Atem nimmt, sondern all den Platz, den sie bräuchte, um ihren übergrossen Gefühle in den Griff zu bekommen.
Aber auch Sally spürt und merkt, dass das Leben der Frau auf dem Hof irgendwann ordentlich aus dem Tritt gekommen sein musste. Liss ist allein, wird nicht besucht. Fragen nach ihrer Vergangenheit blockt sie genauso wie Sally jene nach ihrer Gesundheit. Und als Liss mit Sally im Wald ein Reh mit ihrem Traktor verletzt, Liss mit aller Selbstverständlichkeit eine Pistole aus einer Box holt und dem Leiden des Rehs mit einem schnellen Schuss ein Ende setzt, weiss Sally endgültig, dass Liss nicht einfach nur verschroben und verschlossen ist. Liss ist geprügelt von einer Vergangenheit, einem dominanten Vater, der seine Macht einzusetzen wusste. Sie verliebte sich in einem Mann. Eine Liebe, die grösstmögliche Freiheit versprach und in einem fatalen Reflex endete. Sally ist umklammert von Mutter- und Vaterliebe, die ihr nicht bloss den Atem nimmt, sondern all den Platz, den sie bräuchte, um ihren übergrossen Gefühle in den Griff zu bekommen.
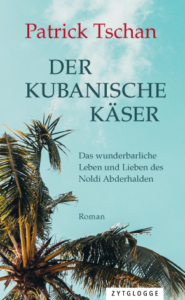 Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht.
Noldi Abderhalden erwacht zu spät, mehr als einmal. Aber Noldi Abderhalden ist es gewohnt, in die Hände zu spucken und die Dinge anzupacken. Er sitzt seine Zeit nicht einfach ab, sondern mausert sich auf der anderen Seite der Welt zum Züchter, Käser und Geschäftsmann. Sogar das Donnerrollen, das aus seinen Lenden zu stammen scheint, bekommt er in den Griff, lernt Liebe kennen und das Glück des Tüchtigen. Nur die Sehnsucht nach dem kleinen Tal zwischen Säntis und Churfirsten lässt sich nie ganz zähmen, ob im Geschmack seines Käses oder nach dem Verstreichen seiner besiegelten Pflicht. Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.
Patrick Tschan, 1962 in Basel geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie, führte in zahlreichen Theaterstücken Regie und ist seit vielen Jahren in der Werbung und Kommunikation tätig. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller-Fussballnationalmannschaft. Zuletzt erschienen von ihm die Romane «Keller fehlt ein Wort» (2011), «Polarrot» (2012),»Eine Reise später» (2015) bei Braumüller. «Der kubanische Käser» ist sein erstes Buch bei Zytglogge.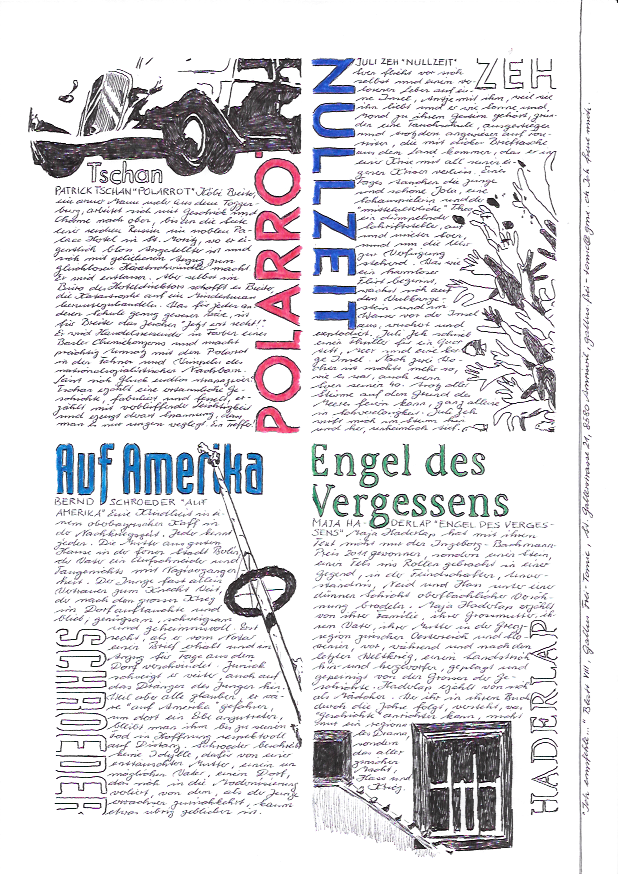

 Aber nachdem er, der allen Frauen gegenüber stets zuvorkommend und niemals aufdringlich war, eine Frau kennenlernt und von ihr zukünftig getragen wird, startet er als erfolgreicher Schriftsteller durch. Von den Fesseln der Filmindustrie und des Alltags befreit, schreibt sich Mandeville in die Herzen der Amerikaner genauso wie in jene der Europäer. Nur nicht ins Herz seines Vaters, der sich noch immer schämt über seinen aus vom britischen Selbstverständnis emanzipierten Sohn.
Aber nachdem er, der allen Frauen gegenüber stets zuvorkommend und niemals aufdringlich war, eine Frau kennenlernt und von ihr zukünftig getragen wird, startet er als erfolgreicher Schriftsteller durch. Von den Fesseln der Filmindustrie und des Alltags befreit, schreibt sich Mandeville in die Herzen der Amerikaner genauso wie in jene der Europäer. Nur nicht ins Herz seines Vaters, der sich noch immer schämt über seinen aus vom britischen Selbstverständnis emanzipierten Sohn.
 Pete versteht, genauso wie der rätselhafte, mythische Altvater Schuppenwurz, eine märchenhafte Stimme im Buch und im Äther dieses Dorfes, was mit dem Verschwinden des kleinen Lanny aus den Angeln gehoben wird. Mit einem Mal ist alles anders. Was im ersten Teil ein Kammerspiel zwischen Lannys Eltern, dem Künstler Pete und der Stimme aus dem Off, jener von Altvater Schuppenwurz ist, wird im zweiten Teil, nachdem Lanny verschwunden ist und bleibt zu einem mehr- und vielstimmigen Chor aus Dorfmitgliedern und Kommentaren, die sich immer tiefer ins undurchsichtige Geschehen im Dorf einmischen. Das, was die Mutter in ihren Kriminalgeschichten schrieb, wird mit einem Mal Dreh- und Angelpunkt in einer Geschichte um Verzweiflung, Panik, Verleumdung und Schuld.
Pete versteht, genauso wie der rätselhafte, mythische Altvater Schuppenwurz, eine märchenhafte Stimme im Buch und im Äther dieses Dorfes, was mit dem Verschwinden des kleinen Lanny aus den Angeln gehoben wird. Mit einem Mal ist alles anders. Was im ersten Teil ein Kammerspiel zwischen Lannys Eltern, dem Künstler Pete und der Stimme aus dem Off, jener von Altvater Schuppenwurz ist, wird im zweiten Teil, nachdem Lanny verschwunden ist und bleibt zu einem mehr- und vielstimmigen Chor aus Dorfmitgliedern und Kommentaren, die sich immer tiefer ins undurchsichtige Geschehen im Dorf einmischen. Das, was die Mutter in ihren Kriminalgeschichten schrieb, wird mit einem Mal Dreh- und Angelpunkt in einer Geschichte um Verzweiflung, Panik, Verleumdung und Schuld.

 USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.
USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.

 Die Geschichte eines Mannes, der in seinem Testament fordert, man möge ihn mit Gesicht nach unten in den Sarg legen, sein letzter und unbedingter Wille. Ein Wille, der seinem eigenen Handeln verwehrt ist. Nicht einmal seine Frau, die als einzige keine einzige Träne zu vergiessen scheint, auch nicht der Leichenredner, sie alle bringen ihn nicht in die Lage, die er vor seinem Tod zum letzten Willen machte. Der letzte Wunsch wurde ihm abgeschlagen.
Die Geschichte eines Mannes, der in seinem Testament fordert, man möge ihn mit Gesicht nach unten in den Sarg legen, sein letzter und unbedingter Wille. Ein Wille, der seinem eigenen Handeln verwehrt ist. Nicht einmal seine Frau, die als einzige keine einzige Träne zu vergiessen scheint, auch nicht der Leichenredner, sie alle bringen ihn nicht in die Lage, die er vor seinem Tod zum letzten Willen machte. Der letzte Wunsch wurde ihm abgeschlagen. Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.
Janko Ferk (1958) ist Richter des Landesgerichts Klagenfurt, Honorarprofessor und Schriftsteller. Bisher hat er mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht, zuletzt die Monographie «Recht ist ein «Prozeß». Über Kafkas Rechtsphilosophie», sowie die Essaysammlungen «Kafka und andere verdammt gute Schriftsteller» und «Wie wird man Franz Kafka?» Seine neueste literarische Veröffentlichung ist die «Forensische Trilogie» (Edition Atelier, Wien 2010). Für seine literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis des P.E.N.-Clubs Liechtenstein.