Was bedeutet es, sich als Paar ewige Treue zu versprechen. Silas und Romy versprachen sich schon früh mehr als nur ein gemeinsames Leben zu teilen. Sollte dereinst jemand der beiden durch Krankheit zuerst sterben, würde man es gemeinsam tun. Nicht nur „bis dass der Tod euch scheidet“, sondern darüber hinaus. Und als man bei Romy die Diagnose Alzheimer stellt, wird aus dem Versprechen Absicht.
Silas und Romy sind seit Jahrzehnten ein Paar, ein alt gewordenes Paar. Zwei, die ihr Glück in einem kleinen, einsamen Haus in den Dünen gefunden haben, mit Sicht aufs Meer, das stetige Rauschen unterlegt. Wie jeden Morgen beginnen sie den Tag gemeinsam, Spiegeleier, Brötchen und schwarzen Kaffee. Danach ein Spaziergang bis zum nahen Hof, im Gehen nicht immer nebeneinander im Gleichschritt, aber immer miteinander. Schon als junge Leute gehörten sie nicht zur lauten Sorte. Das einzige, was laut werden konnte, war ihre Leidenschaft, sei es in der Liebe oder in Gesprächen. Sie lernten sich als junge Studenten auf dem Campus kennen, an einem flirrend heissen Tag, als sich Silas für einmal mutig und entschlossen an die Seite der lesenden Romy setzte. „Romeo und Julia“. Aus dem Gespräch über das Drama einer grossen Liebe wurde ihre grosse Liebe, die alles überdauern sollte.

Dann sollte es ein Dienstag im Mai sein, ein Abend. Silas hatte als ehemaliger Arzt alles organisiert. Das Natrium-Pentobarbital-Pulver, zwei Schaukelstühle mit Sicht aufs Meer, dazwischen ein kleiner runder Tisch, ein Tablett mit zwei Gläsern. „Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben“, sagt sie, er dasselbe. Sie trinken gemeinsam aus den Gläsern, stellen die Gläser hin, lehnen sich zurück und halten sich an den Händen. Es sollte kommen, im Schlaf und sie beide hinüber begleiten.
„Ich möchte gehen, Silas, das Leben ist nur ein Geschenk, wenn es als ganzer Mensch erlebt werden kann. Aber ohne Gedächtnis bist du kein Mensch mehr.“
Aber wenig später wacht Silas wieder auf. Romys Hand ist ihm entglitten, Romys Leben ist ihm entglitten. Sie sitzt tot im Stuhl neben ihm und Silas durchfährt der Schmerz des Verlassenseins vielfach. Da war doch ein Versprechen. Immer und immer wieder. „Denk an unser Versprechen.“ Und dann die Vorbereitungen, der genau besprochene Plan. Die Akribie, der vorbestimmte Tag, die genaue Uhrzeit, nichts dem Zufall überlassen. Sie lassen sich im Stich, verlassen einander ausgerechnet im schwersten Moment, diesem einen, unwiederbringlichen.
Es ist nicht nur die über ihn einbrechende Einsamkeit, das Gefühl, verlassen zu sein. War hinter dem Umstand, dass sein Trank nicht tödlich war, Absicht? Wollte Romy trotz des Versprechens gar nicht den gemeinsamen Schritt, sondern nur den letzten Liebesbeweis? Warum liess sie ihn alleine mit ihrer Entscheidung, dieses eine, alles entscheidende Mal? Einzuholen war sie nicht mehr.
Silas taumelt durch eine Nacht, die er nicht mehr wollte, eine Welt, von der er sich verabschiedet hatte, weil alle Welt in seiner Liebe zu seiner Frau war. Wie durch einen Blitzschlag ernüchtert.
Die Novelle von Lu Bonauer ist eine Liebesgeschichte, die berührt und Fragen stellt. Vor nicht allzu lange Zeit ging ich mit meiner Frau spazieren. Wir sind seit über 35 Jahren verheiratet. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Zufall gleichzeitig sterben lässt, ist verschwindend klein. Jemand von uns beiden wird alleine bleiben, zurück bleiben Und doch tut man so, als blieben die Stränge auf ewig parallel. Romy und Silas wählten den gemeinsamen Prellbock, den gemeinsamen Ausstieg, das gemeinsame Ende. Aber Silas muss feststellen, dass die akribische Planung Fassade war, er ausgerechnet in der schwersten Stunde einer „Lüge“ aufgesessen ist. Wohin mit Gefühlen, die sich nicht kontrollieren lassen.
Lu Bonauers Novelle „Die Liebenden bei den Dünen“ ist ein zartes Stück Literatur, dem man nach dem Lesen gerne einen besonderen Platz in seiner Bibliothek geben möchte!

Interview mit Lu Bonauer
Shakespeares „Romeo und Julia“ endet, Ihre Novelle beginnt mit dem maximalen Drama; mit der Gewissheit, nach Jahrzehnten Harmonie und Zweisamkeit unwiderruflich und entgegen des gemeinsamen Versprechens der unsterblichen Liebe, verlassen worden zu sein. Was war die Initialzündung zu Ihrer Novelle?
Ich sehe mich grundsätzlich als Schriftsteller, dessen Stoffe existenziellen Fragen nachspüren. In diesem Text stehen zwei Menschen vor einer Grenze, dem Tod, den sie zu ihrem gemeinsamen Tod machen wollten, um zusammen weitergehen zu können. Aber dann bleibt Silas alleine zurück mit all seinen Gefühlen, seiner Trauer, seinem Schmerz. Bei „Die Liebenden bei den Dünen“ hat mich diese grosse Liebe zweier Menschen beschäftigt, die ein Leben lang zusammengehalten haben, und die sich dieser letzten grossen Herausforderung stellen müssen.
Sie schreiben oft über „altersbedingte Themen“. Ist das nicht eher ungewöhnlich für Ihr Alter?
Diese Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Vielleicht schreibe ich, wenn ich alt werden darf, über Kindheit und Jugend (schmunzelt). Die momentane Antwort ist: Ich weiss es nicht, nicht wirklich. Es ist vielmehr das Interesse für und die Achtung vor alten Menschen und ihren Lebensgeschichten. Einmal hoffentlich selber zurückblicken zu können. Sich jetzt schon mit einem Ich und auch Du in einer noch etwas fernen Zukunft zu befassen, das hat auch etwas Befreiendes und Unverkrampftes, insbesondere, wenn der tägliche Irrsinn uns den Atem zu nehmen droht.
Sie beschreiben eindringlich die Zerrissenheit zwischen Enttäuschung, Verzweiflung, Einsamkeit und Schmerz. Müsste man als kluger Mensch nicht gelernt haben, dass die wirklich wichtigen Dinge nicht planbar sind, erst recht dann nicht, wenn sich deren Verwirklichung auf die Zuverlässigkeit anderer stützt?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Erfüllung und Glück sind nicht planbar. Hinzukommt, dass das eigene und gemeinsame Glück kaum in jeder Lebenslage übereinstimmen. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Im besten Fall existieren in einer Partnerschaft gleiche Vorstellungen dazu, um zu zweit einen Plan vom Glück umzusetzen. Ohne beidseitige Zuversicht ist die Unzuverlässigkeit nicht weit. Und das Gefühl, auch in der Liebe frei zu sein, kann sich niemals entwickeln. Romy und Silas sind fest verwurzelt in der Liebe zueinander. Umso schwieriger ist es für Silas, sich dem Bewusstsein zu stellen, dass der Mensch letztlich in seinen Entscheidungen frei ist, ein freies Wesen ist, frei auf der Welt, frei im Kosmos.
Aus der Sicht Romys verstehe ich ihr Handeln, ihre Absichten. Ich verstehe die Verzweiflung Silas ebenso. Und das macht den Reiz der Novelle aus. Die Lektüre Ihres Buches provoziert die eigene Auseinandersetzung mit der Frage, woran Liebe scheitern könnte. Scheitert man nicht viel mehr an sich selbst?
Natürlich. Ob unerfüllte Liebe, zerrüttete oder zerbrochene Liebe, das Eigene verpflichtet dazu, das einst oder vermeintlich Gemeinsame zu hinter- oder zu erfragen. Das Scheitern gehört zum Glück dazu. Nicht zu scheitern bedeutet allenfalls, im Unglück zu verharren. Sich das Scheitern einzugestehen, ist bekanntlich oft schwierig. Das Eingeständnis, gescheitert zu sein, ist ein Akt der Sorgsamkeit gegenüber sich und dem eigenen Leben. Im Buch stellt sich Silas diesem Akt. Aber ist es wirklich ein Scheitern? Romy und er haben das gemeinsame Glück bis zuletzt bewahren können. Und nun fordert Romy ihn nochmals heraus und sie tut es für eben diese Liebe, die ihr genauso das Wichtigste ist.
Romy emanzipiert sich in ihrem letzten Schritt. Silas dachte, Sie hätten ihre Ehe stets in vollkommener Übereinstimmung gelebt. Ist diese Liebesgeschichte also auch ein Abgesang auf die Ideale einer traditionellen Ehe?
Den Stoff, den ich im Buch bearbeite, stellt die Liebe als etwas Universales und zugleich Persönliches dar . Und somit wirkt die Liebe fern eines institutionellen Kraftfeldes. Das war mir beim Schreiben wichtig. Jede Liebe ist aussergewöhnlich auf ihre Weise. Bei Romy und Silas wurzelt das Aussergewöhnliche in ihrer Verbundenheit zum Buch „Romeo und Julia“, einer Geschichte, die ein gegenseitiges Versprechen auslöst und somit in ihre eigene Geschichte bis zuletzt hineinatmet.
Versprechen scheinen gemacht zu sein, um sie zu brechen. Nirgends so sehr wie in der Liebe. „Unsterbliche Liebe“ – das Maximum eines Versprechens. Muss man daran glauben, damit man es wagen kann?
Oh ja, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Und hinter den Bergen liegt irgendwo das Meer. Und das Meer spielt eine wichtige Rolle im Buch. Wenn man gewillt ist, das Weite, das Unbekannte immer wieder von Neuem zu erforschen. Weshalb sollte so etwas „Kühnes“ (lacht) wie die unsterbliche Liebe nicht möglich sein?
Lu Bonauer, geboren 1973 in Basel, schreibt Prosa und Lyrik. Seine Texte sind in mehreren Anthologien erschienen und wurden bei diversen Wettbewerben ausgezeichnet, unter anderem war er Gewinner des Schreibwettbewerbs OpenNet der Solothurner Literaturtage und des Monatstextes März 2002 des Literaturhaus Zürich. 2008 und 2016 erhielt er jeweils für die Romanprojekte „Herzschlag hinter Stein und «OLIs God“ einen Förderpreis des Fachausschuss Literatur BS/BL. Lu Bonauer erhielt im Frühjahr 2019 einen Werkbeitrag von der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Beitragsbild © Lu Bonauer
















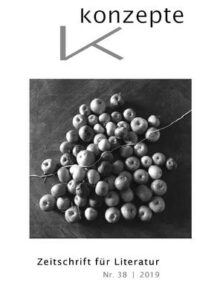



 Regula Portillo, geboren 1979, wuchs im Kanton Solothurn auf, studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Fribourg und Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie lebte und arbeitete mehrere Jahre in Nicaragua, Mexiko und Deutschland. Für ihr Schaffen hat sie Förderpreise und Werkbeiträge von Stadt und Kanton Bern und dem Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn erhalten. 2017 ist ihr erster Roman «Schwirrflug» erschienen. Seit 2018 lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als Texterin in einer Kommunikationsagentur.
Regula Portillo, geboren 1979, wuchs im Kanton Solothurn auf, studierte Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Fribourg und Buch- und Medienpraxis an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie lebte und arbeitete mehrere Jahre in Nicaragua, Mexiko und Deutschland. Für ihr Schaffen hat sie Förderpreise und Werkbeiträge von Stadt und Kanton Bern und dem Kuratorium für Kulturförderung des Kantons Solothurn erhalten. 2017 ist ihr erster Roman «Schwirrflug» erschienen. Seit 2018 lebt sie mit ihrer Familie in Bern und arbeitet als Texterin in einer Kommunikationsagentur.













 Éric Vuillard, 1968 in Lyon geboren, ist Schriftsteller und Regisseur. Für seine Bücher, in denen er große Momente der Geschichte neu erzählt und damit ein eigenes Genre begründete, wurde er u. a. mit dem Prix de l’Inaperçu, dem Franz-Hessel-Preis und dem Prix Goncourt ausgezeichnet.
Éric Vuillard, 1968 in Lyon geboren, ist Schriftsteller und Regisseur. Für seine Bücher, in denen er große Momente der Geschichte neu erzählt und damit ein eigenes Genre begründete, wurde er u. a. mit dem Prix de l’Inaperçu, dem Franz-Hessel-Preis und dem Prix Goncourt ausgezeichnet.