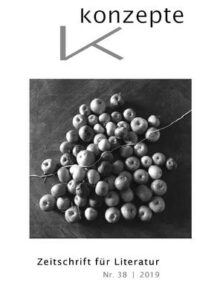Ich musste während der Lektüre von „Fretten“ immer wieder einmal Luft holen. Helena Adler hat sich auch mit ihrem neuen Roman in einen Rausch geschrieben. Ein Rausch, der mich einsaugt und mich in Sphären trägt, die mich trunken machen. Die Schreibe der Salzburgerin ist wie ein Meteorit; sie schlägt ein und wenn man ihren Kern zu fassen bekommt, schillert er!
Sie schreibt. Aber ihr Schreiben ist anders! Man muss diesen Funkelstein nicht gegen das Licht halten. Er leuchtet von selbst. Sie spielt mit der Sprache in einer Virtuosität, der man in dieser Intensität und Kunstfertigkeit nur ganz selten begegnet. Kann gut sein, dass da etwas zu wachsen beginnt, das dereinst alles andere überstrahlen wird. Dabei ist ihre Sprache längst mächtig genug, dass ich mich als Schreibender in Ehrfurcht verneige. 2020 war Helena Alder mit ihrem Zweitling „Die Infantin trägt den Scheitel links“ in der Shortlist des Österreichischen und der Longlist des Deutschen Buchpreises – und nun 2022 bereits wieder in der Shortlist des Österreichischen Buchpreises. Als ob die Jury noch einmal nachdoppelt – und nun, als logische Konsequenz, der Autorin den Buchpreis ihres Landes zuspricht.
„Wir tanzen um die Wette, und ich tanze um mein Leben. Wir tanzen dem Tod durch die Lappen, denn solange wir tanzen, passiert uns nichts.“
Helena Adler klärt ganz zu Beginn des Buches: fret/ten (süddeutsch / österreichisch) sich abmühen, sich plagen, mühsam über die Runden kommen, sich aufreiben, sich wundreiben.
„Fretten“ ist als Roman die Fortsetzung von „Die Infantin trägt den Scheitel links“. In seiner Art noch zorniger, noch stärker, noch konsequenter. Aus dem Mädchen ist eine junge Frau geworden, die in ihrem Sein, ihrer Wahrnehmung, ihrem Erleben in krassem Gegensatz zu dem steht, was die geranienbehängten Bauernhöfe, die schmucken Kapellen und das saftige Grün mit den schmucken Hügeln und Bergen sonst als Idyll hergeben müssen.

Eigentlich will sie nur weg; weg aus der Fassade, weg aus der Umklammerung von Geschichte und Gegenwart, der Unausweichlichkeit, der Selbstverständlichkeit des Immer-schon-so-Gewesenen. Am liebsten weg aus dem Kaff in die Stadt, auch wenn das Provinznest in der Nähe in nichts der grossen Freiheit entspricht, in die sie sich verbal verabschieden will. Sie, die schon auf einer versifften Rückbank einer Schrottkarre zur Welt kam. Sie schliesst sich als Wilde mit anderen zusammen, streift durch die Gegend, tut all das, wovon sie weiss, dass man es nicht tun sollte, zieht bandenmässig in der Provinzstadt herum. Sie brechen in Villen ein oder auch mal in einen Schlachthof, um die Fleischseiten vom Dach auf jene zu schmeissen, die mit Abendrobe zum Sehen-und-Gesehenwerden pilgern. Sie sind unentwegt auf der Suche, ohne ein Ziel. Sie passen nirgends hin und nirgends hinein, es ist ihnen zuwider, sich einzufügen und unterzuordnen. Rebellion ist Prinzip. Man wiegelt sich auf, ohne zu wissen wohin, wo hinaus. Sie will aus der Hexenküche, auch wenn sie keine Ahnung hat, wo ein Ausweg sein sollte. Die Erzählerin hext selbst. Es fühlt sich an, als wäre die ganze Welt längst zerbrochen und wir die Scherben, die niemand aufsammeln will.
Bis sie schwanger wird, ein Kind bekommt. Bis alles in ihr die Richtung wechselt, nur die Intensität nicht. Bis ihr Blick, der sonst immer nach aussen gerichtet war, mit einem Mal ganz nach innen gerichtet wird. Bis aus der Störerin, der Zerstörerin eine Beschützerin wird, während mich Demut überfällt. Eine noch nie dagewesene Demut, eine abhandengekommene Demut, die ich im Laufe der Jahre aus Trotz gegenüber jeglicher Vergänglichkeit abgelegt hatte… Alles, was zuvor auf Abwehr, Rebellion und Ablehnung eingestellt war, wird zu einem weichen, schützenden Schal um die empfindsame Existenz des Kindes.
„Die Distanz zum Mond ist lächerlich, gemessen an der Liebe zu dir.“
Die Kraft ihrer Sätze, ihrer Bilder ist das eine. Das andere die Melodie, die Musik, laut, kraftvoll, als wäre das Erzählblut mit gedopt, als würde beim Lesen der eigene Puls unmerklich schneller werden. Helena Adler sprüht vor Lust und Witz, vor Spielfreude und Fabulierkunst. Und nichts ist gekünstelt. Helena Adlers Sprache ist ihr ganz eigener, absolut solitärer Sound. Eine Sprachmusik, die unverkennbar nur die ihrige ist. Ich kann nicht behaupten, dass sich aus der Sprache allein heraushören würde, wer sie „spielt“. Bei Helena Adler kann man es! Da wird Wut und Zorn zu ästhetischer Kraft.
Ironie des Moments: Ich las „Fretten“ in einem Zisterzienserkloster. In einer Klause um den Tisch herumschreitend, laut lesend, vorbei an Heiligenbildern und dem gestrengen Blick in Öl gemalter Kirchenmänner. Diesen Roman, der durchsetzt ist mit katholischen Fragmenten aus Psalmen und Gebeten! „Fretten“ ist sprachliche Offenbarung! Man lese und staune!
Interview
Dein ganz eigener Ton, den Du in Deinem Roman anschlägst, steht durchaus in einer österreichischen Tradition. Eine Tradition, die ich so nicht in der Schweizer Literatur der letzten Jahrzehnte herausgehört hätte. Diese Mischung aus ungezügelter Leidenschaft, überbordender Fabulierlust und Wut. Ist das ein letzter Rest Aufbäumen gegen monarchische Obrigkeitsergebenheit?
Was genau das ist, weiss ich selbst nicht. Letzter Rest? Auf keinen Fall. Das ist doch erst der Beginn. Aber ein Aufbäumen, ein Trotz, ein Widerstand: ja, zweifellos. Gegen bestehende Umstände, gegen Borniertheit, gegen Obrigkeitshörigkeit, gegen Intoleranz. Gegen Kapitalismus. Gegen Arschlöcher und scheussliche Wichte, die selbst wie die Made im Speck leben und sich über andere Menschen erheben, vor allem über jene, die unter widrigen Umständen versuchen zu überleben.

„fretten“ ist ein Verb und bedeutet „sich abmühen, sich plagen, mühsam über die Runden kommen, sich aufreiben, sich wundreiben“. Das erklärst Du auch in Deinem Roman. Inhaltlich passt das Verb genau zur Protagonistin. Aber auch zu Dir und Deinem Schreiben? Es scheint, als wäre Deine Art der Sprache, des Schreibens eine sehr musikalische, verbunden mit viel Lust und Freude (auch wenn ich weiss, dass Schreiben harte Arbeit sein kann).
Fretten passt zu mir wie mein finsteres Gesicht zu meinem fiesen Lacher. Für mich ist das ganze Leben ein einziges Gfrett. Ein Passionsweg. Ein ständiges «Sichabmühen und Durchwursteln, ein Über-Abhänge-hangeln, ein unentwegtes Luftanhalten, eine Aneinanderreihung von Augen-zu-und-durch-Momenten, ein andauerndes Aushalten, Überwinden und Fortschreiten ohne Rast. Ob es zu meinem Schreiben passt, das ist eine andere Frage. Es passt in Teilen zu meinem Schreibprozess. In Phasen, in denen es mir nicht gut geht. Da kann ich nämlich nicht schreiben und verzweifle darüber. Dann muss ich mich wieder selbst am Haarschopf aus dem Morast ziehen und von vorne beginnen. Aber dann, wenn es mich packt, bin ich woanders. Dann bin ich Teil des Babylonischen Gartens, blühe dort als Passionsblume und trinke das Wasser aus dem Euphrat.
Man sieht sie überall in ihrem schwarzen Look, farbigen Haaren, genietet und gepierct. Es scheint immer mehr, dass die Gesellschaft in Gruppen zerfällt, die sich gegenseitig nichts zu sagen haben. Gut, wenn ein Roman wie „Blutbuch“ von Kim de l’Horizon den Deutschen Buchpreis erhellt und LeserInnen Welten öffnet. Wieviel „Aufklärung“ und „Wachrütteln“ steckt im Schreiben, in Deinem Schreiben?
Das kann ich nicht beurteilen. Den Anspruch auf Aufklärung erhebe ich keinesfalls. Aber freilich ist es ein Wunsch andere Welten zu eröffnen.
Deine Protagonistin wird schwanger, bekommt ein Kind. Mit einem Mal verändern sich die Perspektiven dieses Lebens in permanentem Aufruhr vollständig. Eine Erfahrung die wohl alle Eltern machen, Mütter mit Sicherheit mehr als Väter. Du bist auch Mutter. Waren das Erfahrungen, die Du auf Deine ganz eigene Art so verschriftlichen musstest?
Manche Rezensenten sehen in «Fretten» eine Fortführung der «Infantin» und ich frage mich, ob ihnen nicht aufgefallen ist, dass sich die Sprache verändert hat. Für mich sind es zwei unterschiedliche Werke, die sich maximal in der Kindheit überschneiden, vielleicht was den Inhalt betrifft. Doch der Kern liegt anderswo, und zwar in der Mutterschaft. Und dafür wollte ich eine eigene Sprache erschaffen, die meiner Empfindung am nächsten kommt. Darüber wurde noch viel zu wenig geschrieben, darüber wollte ich schonungslos und ehrlich sein, aber auch all die Liebe hineinstopfen, die ich für mein Kind empfinde. Auch, wenn meine Mutterliebe das übersteigt, was ich imstande bin, auszudrücken.

Neben dem Schreiben bist Du auch bildende Künstlerin. Deine Romane sind Literatur gewordene Klangbilder. Was unterscheidet Dein Malen von Deinem Schreiben?
Beides passiert vor allem über ein Gefühl. Frei assoziativ. Das Schreiben geht viel über Klang. Beides ist sehr innwendig. Allerdings bin ich durchs Schreiben ausgelaugter, es entspricht mehr meiner Königsdisziplin. Das Schreiben verlangt mehr ab, hinter der Leinwand kann ich mich besser verstecken. Beim Schreiben bin ich viel ausgesetzter. Das Schreiben ist mein Hirn und Herz, das Malen mein Körper. Vielleicht.
Schreibende MalerInnen und malende SchriftstellerInnen haben Tradition. Braucht das eine das andere?
Nicht notwendigerweise. In meinem Fall empfinde ich es als Bereicherung. Ich bin Autorin und ich bin auch Künstlerin. In erster Linie aber profitiere ich von meinem inneren Reichtum an Bildern, ich kann jederzeit einen Spaziergang durch meine innwendige Gemäldegalerien antreten, andererseits übersetze ich manchmal durchaus auch Geschriebenes in Skizzen.
Helena Adler, geboren 1983 in Oberndorf bei Salzburg in einem Opel Kadett, lebt als Autorin und Künstlerin in der Nähe von Salzburg. Studium der Malerei am Mozarteum sowie Psychologie und Philosophie an der Universität Salzburg. Mit ihrem Debüt «Die Infantin» war sie auf der Shortlist des Österreichischen und auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2020.
Rezension zu «Die Infantin» auf literaturblatt.ch
Beitragsfoto © Eva Trifft