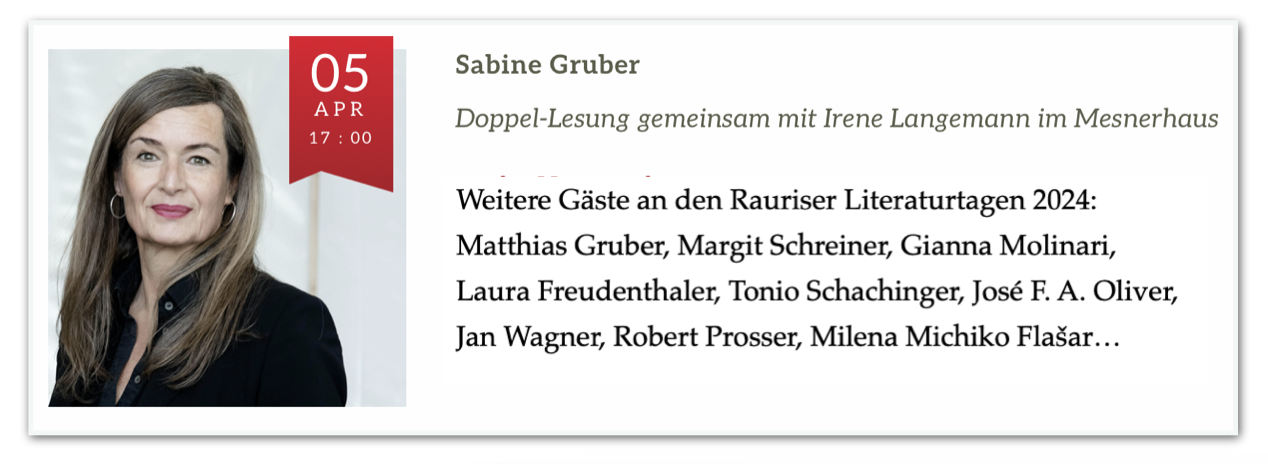Was wünscht sich ein Mädchen, eine junge Frau mit 14? Die Zugehörigkeit in einer Peergroup, Anerkennung, die Sehnsucht nach der grossen Liebe, Träume, Freundschaften. Matthias Gruber hat sich in seinem preisgekrönten Debüt „Die Einsamkeit der ersten Art“ ein Leben ausgesucht, dass von vielem ausgeschlossen ist.
 Eigentlich ist sie doch mit ihrem Namen schon gestraft; Arielle. Arielle leidet unter einem Gendefekt. Was heisst; Arielle hat als Mädchen fast keine Haare auf dem Kopf, fast keine Zähne im Mund und kann nicht schwitzen. Nicht nur die heissen Sommer sind ihr ein Graus, jede körperliche Anstrengung, das Leben überhaupt. Ektodermale Dysplasien heisst diese Krankheit, oder noch nichtssagender XLHED. Matthias Gruber nennt den Namen dieser Krankheit in seinem Buch nie. „Die Einsamkeit der ersten Art“ ist auch kein Buch über diese Krankheit. Und doch trägt das Mädchen den Makel mit sich. Ein Makel, der nicht abgelegt werden kann in einer Welt, die sich vor allem an Äusserlichkeiten orientiert. „Die Einsamkeit der ersten Art“ ist auch kein trauriges Buch, sondern mit erstaunlich viel Witz und Humor erzählt. Ein Buch, das mit diesem Makel kein Kapital schlagen will, schon gar kein emotionales.
Eigentlich ist sie doch mit ihrem Namen schon gestraft; Arielle. Arielle leidet unter einem Gendefekt. Was heisst; Arielle hat als Mädchen fast keine Haare auf dem Kopf, fast keine Zähne im Mund und kann nicht schwitzen. Nicht nur die heissen Sommer sind ihr ein Graus, jede körperliche Anstrengung, das Leben überhaupt. Ektodermale Dysplasien heisst diese Krankheit, oder noch nichtssagender XLHED. Matthias Gruber nennt den Namen dieser Krankheit in seinem Buch nie. „Die Einsamkeit der ersten Art“ ist auch kein Buch über diese Krankheit. Und doch trägt das Mädchen den Makel mit sich. Ein Makel, der nicht abgelegt werden kann in einer Welt, die sich vor allem an Äusserlichkeiten orientiert. „Die Einsamkeit der ersten Art“ ist auch kein trauriges Buch, sondern mit erstaunlich viel Witz und Humor erzählt. Ein Buch, das mit diesem Makel kein Kapital schlagen will, schon gar kein emotionales.
Arielle geht zur Schule. Während sich ihre Klassenkolleginnen über Social Media ganz über ihre Äusserlichkeiten definieren und die Jungs weit entfernt, wie auf einem unerreichbaren Planeten ihr Ding abziehen, wächst Arielle in einem Zuhause auf, das wenig Zeit hat für die Nöte der Tochter. Der Vater verdient sein Geld mit Entsorgungen und Räumungen und sucht in entsorgten Computern auf Festplatten nach Kryptowährung. Aber weil er, vom Amt zu Räumungen geschickt, mit dem Sammelgut auf illegalen Wegen Bares kassiert, fällt er in Ungnade und ist mehr und mehr auf das Geschick seiner psychisch labilen Ehefrau angewiesen. Aber auch sie ist von sich selbst gefangen, hofft mit Kosmetikartikeln das grosse Geld zu verdienen, über Social-Media-Kanäle zur Influencerin zu avancieren, in der Hirarchie eines Schneeballsystems die grosse Bühne zu besteigen.

Arielles Vater werkelt in seiner Kammer und sucht nach einem Schatz, Arielles Mutter schichtet in ihrem Keller, in ihrer Online-Boutique – und Arielle versucht mit dem Leben mehr oder weniger alleine zurechtzukommen. Am meisten weggetragen fühlt sie sich, wenn sie mit ihrem Vater im Lieferwagen auf Tour ist, oder wenn sie auf der Müllsammelstelle, wo alles landet, was als Spur hinter den Menschen hergezogen wird, im Studio von Aljosha, in einem Container beim Schrottplatz eine Atempause findet, wenn sie sich in die Welt am Rand mischt.
Und doch möchte ausgerechnet sie helfen. Ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrer Freundin Yasmine und Aljosha, der von einem Leben in Berlin träumt, von einer Kunstschule, weit weg vom Schmuddeldasein und den Blicken all jener, die ihn in seinem Andersein höchstens tolerieren. Aljosha ist schwul.
Die Situation spitzt sich zu, als Arielle sich ein gebrauchtes Handy unter den Nagel reisst und mit den Fotos eines unbekannten Mädchens nicht nur der Mutter unter die Arme greifen will, sondern damit auch einen Feldzug gegen Jungs führen, bei denen sie als sich selbst nur Unverständnis ernten würde. „Die Einsamkeit der ersten Art“ ist eine bunte Geschichte, von den Rändern her erzählt, ein Stück Menschengeschichte, als wäre diese an ein Ende gestossen, als würde sich das Menschsein in lauter Sinnlosigkeiten bis hin zu Müllhalden und Schrottcontainern ausleeren.
Wenn Matthias Gruber von den Anstrengungen der Mutter erzählt, im Kosmetikbuisiness Fuss zu fassen, dann sträuben sich die Nackenhaare. Wenn die Krone der Schöpfung nur noch hinter Äusserlichkeiten herhechelt und man den wahren Kern von Leben und Sterben aus dem Blick verloren hat, dann ist „Die Einsamkeit der ersten Art“ nicht tröstlich, aber äussert unterhaltsam, mutig erzählt, frisch von der Leber. Matthias Gruber ist eine unverkrampfte, junge Stimme von der ich mir viel verspreche.

Interview
Zuerst möchte ich Ihnen zum Rauriser Literaturpreis gratulieren! Wer einen Blick auf die Liste aller ehemaligen PreisträgerInnen wirft, ist beeindruckt. Das sind keine Eintagsfliegen. Viele der Namen sind heute Eckpfeiler der deutschsprachigen Literatur. Setzt Sie das nicht etwas unter Druck oder kann man den Preis einfach als Anerkennung für die Qualität eines ersten Romans geniessen?
Zusätzlichen Druck verspüre ich zum Glück noch nicht. In erster Linie freue ich mich einfach, dass der Roman durch den Preis noch etwas zusätzliche Aufmerksamkeit bekommt. Es erscheinen so viele großartige Bücher und das in einer solchen Geschwindigkeit, dass ein einzelner Roman nicht viel Zeit hat, um seine Leser*innen zu finden. Vielleicht kann der Preis diese Zeitspanne ein wenig verlängern.
Obwohl die Pupertät eine Zeit des Suchens und Ausprobierens ist, ist es bei vielen Jugendlichen genau die Zeit, in der man auf keinen Fall aus der Reihe tanzen will, in der man zu erstaunlich viel „Uniformierung“ bereit ist, sich einer Peergruppe anschliesst und alles peinlich findet, was keiner Norm entspricht. Gewisse Menschen scheinen aber gar nie darüber hinauszukommen! Arielle (Was für ein Name!) hat keine Chance, einem Bild zu entsprechen, genetisch bedingt. Während andere, scheinbar ebenso genetisch bedingt, unumstösslich in dieser Norm gefangen sind. Ist Schreiben ein Ausbruchsversuch?
Ich denke, wir alle tragen diese verbesserten Versionen von uns in der Hosentasche herum. Auf unseren Social Media-Profilen spielen wir uns selbst und möchten dabei klüger, schöner und witziger erscheinen, als wir uns im echten Leben fühlen. Mich hat interessiert, wie es einem Menschen geht, dem das nicht möglich ist, weil sein Äußeres nicht einfach durch einen Filter oder eine bestimmte Pose verändert werden kann.
Durch Zufall kann Arielle einen eigentlichen Avatar generieren, mittels eines Telefons, das sie sich bei den Touren mit ihrem Vater unter den Nagel reisst. Ein „Spiel“, in dem die Realität mit einem Mal zurückschlägt. Ist das nicht ein bisschen viel Moralität angesichts dessen, was mittels Social Media alles erreicht werden kann? Frage ich meine SchülerInnen in ähnlichem Alter wie Arielle, so ist „InfluencerIn“ ein vielgenanntes Ziel.
Es ging mir beim Schreiben nicht um ein Verteufeln sozialer Netzwerke. Die Arbeit am Buch war eher ein Versuch, auszuloten, wie umfassend diese Plattformen mittlerweile unser Leben beeinflussen: Unser Selbstbild, unsere Beziehungen, die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit gestalten und die Welt betrachten. Das betrifft längst nicht nur Jugendliche, sondern alle.
In einem Interview erzählen Sie, sie hätten zusammen mit ihrem Kind auf einem Spielplatz ein auffälliges Kind gesehen und danach recherchiert. So sei dieses Kind mit dem Gendefekt Ektodermalen Dysplasie in ein bereits angefangenes Manuskript gekommen. Gab es auch den direkten Kontakt mit Menschen mit dieser „Krankheit“? Ist es nicht abwertend, einen solchen Genunterschied als „Krankheit“ zu bezeichnen?
Über die Vermittlung einer Selbsthilfegruppe konnte ich Kontakt zu Menschen mit Ektodermaler Dysplasie aufnehmen und mit ihnen Interviews führen. Ich bin dafür sehr dankbar, denn ohne diese Einblicke hätte ich den Roman gar nicht schreiben können. Die Frage, ob die Bezeichnung Krankheit per se abwertend ist, kann ich nicht beantworten. Ich vermute aber, es kommt auf den Kontext an. Ein respektvoller Umgang mit Betroffenen sollte jedenfalls selbstverständlich sein. Leider ist das oftmals nicht der Fall, wie auch die Interviews für das Buch gezeigt haben. Nicht wenige Menschen mit Ektodermaler Dysplasie werden wegen ihres Aussehens ausgegrenzt, verspottet und stigmatisiert. Vieles, was ich in Interviews gehört habe, konnte ich kaum glauben.
Bei einem Museumsbesuch trifft Arielle auf jenes Tier, dass als erstes seiner Art vom Wasser ans Land kam. Arielle, die nicht schwitzen kann und eigentlich ganz gerne im kühlen Wasser bleibt, fühlt die Einsamkeit, weil niemand wirklich nachvollziehen kann, was in ihr und mit ihr geschieht. Erst recht, weil wir in einer Gesellschaft der Äusserlichkeiten existieren und dauernd taxieren, schubladisieren und urteilen. Einsamkeit in einer Gesellschaft, die unter Dichtestress leidet?
Das ist ein wichtiger Punkt. Arielle selbst macht ihren Gendefekt selten zum Thema. Natürlich ist er für sie in mancherlei Hinsicht einschränkend, aber zum Problem wird er nur deshalb, weil ihre „Andersartigkeit“ immer und immer wieder von außen an sie herangetragen wird. Erst diese Schubladisierung isoliert sie und macht sie zur Außenseiterin. Die Szene im Naturkundehaus ist für mich auch deshalb eine Schlüsselszene, weil sich in Arielles Wahrnehmung etwas verschiebt. Wie der Ichthyostega wird auch sie plötzlich nicht durch ein scheinbares Defizit definiert. Sie ist die Erste ihrer Art.
Arielles Mutter leidet an Ekzemen an der Hand und träumt vom grossen Geschäft mit Kosmetika. Ihr Vater entsorgt Hinterlassenschaften, räumt Wohnungen. Auch er träumt; vom lukrativen Kryptogeldfund in „herrenlosen“ Computern. Arielle, die das Spiel mitmacht, sucht aber eigentlich nach ganz anderem; nach Geborgenheit, Freundschaft, Liebe. Unser Tun hängt sich mehr und mehr an digitale Schein- und Nebenwelten. Ihr Roman moralisiert ganz dezent. Er drückt auch nicht auf die Mitleidsdrüsen. Wollen Sie einfach eine gute Geschichte erzählen oder schwingt nicht immer eine Absicht mit im Schreiben?
Ich wollte von Menschen erzählen, deren Welt in Trümmern liegt. Und von ihren oft vergeblichen Versuchen, damit umzugehen. Die Schicksale der Figuren stehen also klar an erster Stelle. Aber natürlich bewegen sich diese Menschen nicht im luftleeren Raum. Die Dinge, unter denen sie leiden, haben Ursachen. Insofern ist es natürlich ein Roman über gesellschaftliche Ungerechtigkeit und ein zutiefst politisches Buch. Vieles bleibt dabei allerdings in der Andeutung. Vieles läuft über Leerstellen, auch sprachlich. Ich finde, ein Roman braucht diesen Raum. Sonst hätte ich ein Sachbuch oder einen Essay geschrieben.
Beitragsbild © Eva Krallinger-Gruber