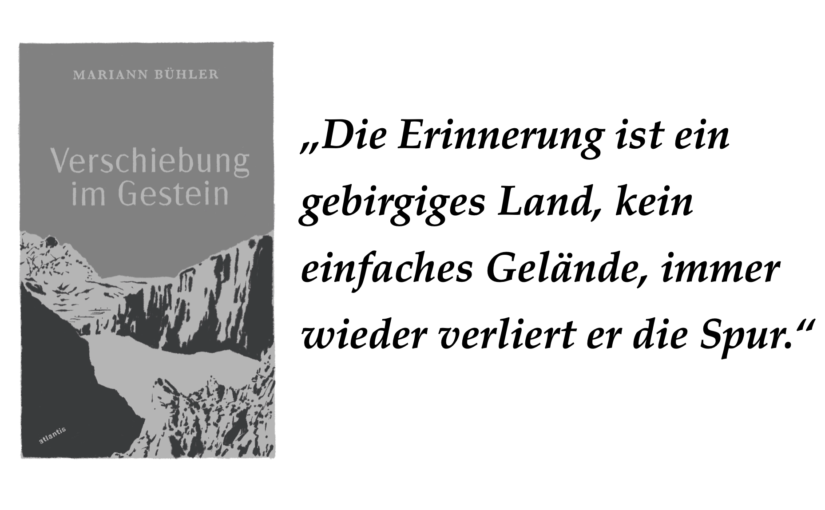Man kennt sie, jene, die in verlassene Häuser steigen, mit Taschenlampe und Rucksack, Fotos von Lost Places machen, Spuren suchen nach verlorenem, vergessenem Leben. In einem kleinen Haus, kurz vor der Räumung, treffen zwei junge Menschen aufeinander, Letta, die ungefragt eingestiegen ist und Paul, der im Haus seiner Grossmutter Ordnung machen will.
Wer ein Leben lang ein Haus bewohnt, hinterlässt einen kleinen Kosmos voller Spuren, Signale, Markierungen, dinggewordener Erinnerungen. Ich erinnere mich gut an die Besichtigung jenes Hauses, in dem wir zehn gute Jahre mit unserer Familie verbringen konnten. Die Frau, die mit ihrem Hund Jahrzehnte in dem Haus wohnte, am Schluss nur noch im Untergeschoss, musste wegen eines Unfalls ins Pflegeheim. Als man uns das Haus zeigte, sah man auf dem kleinen Tisch im Wohnzimmer noch einen Notizzettel und in der Küche auf der Anrichte eine Schale mit Früchten.

Lore führte vor ihrem Tod ein ruhiges und zurückgezogenes Leben. Nicht einmal ihre nächsten Nachbarn wussten etwas von der stillen Frau. Agnes Siegenthaler verrät nur Verschlüsseltes aus dem Leben der stillen Frau. Das wird auch sichtbar im Aufbau des eigenwilligen Romans. Wenn Agnes Siegenthaler von Lore erzählt, dann sprechen die Dinge im Haus von der Frau und den Menschen, die mit Lore Zeit in diesem Haus teilten. Textpassagen, die sich eindeutig vom Erzählstrang nach ihrem Tod absetzen, lyrische Prosa, gesetzt wie Gedichte. Für mich als Leser sind es Atempausen, Einladungen, meinen Lesefluss zu verlangsamen, dem Text Zeit zu lassen, auf die Stimmen der Dinge einzugehen, auf das Hasenauge, die Porzellanfigur, den Hygrometer, die Kaffeetasse, den Elefanten aus Glas. Agnes Siegenthaler gibt den stumm gewordenen Dingen in Lores Haus ihre Stimme zurück, den eingelagerten Erinnerungen, die sich sonst spurlos verflüchtigen. Jeder, der schon einmal die Pflicht hatte, ein Haus Räumen zu müssen, weiss, wie wertlos mit einem Mal Dinge geworden sind, die in einem anderen Leben unentbehrlichen Wert besassen.
Paul ist Lores Enkel. Als er das Haus seiner Grossmutter aufschliesst, merkt er, dass Spuren zu finden sind, die nicht von seiner Grossmutter stammen. Und irgendwann findet er im grossen Bett der Grossmutter eine junge Frau liegen, jemanden, den er nicht kennt, von dem er aber spürt, das keine schlechten Absichten der Grund dafür sind, dass sich jemand unerlaubt Zutritt in das Haus seiner Grossmutter verschaffte. Letta wacht auf. Vielleicht wacht sie aber nicht nur aus dem Schlaf auf, sondern auch aus deinem Rauschzustand, der sich jedes Mal einstellt, wenn Letta in ein nicht mehr bewohntes Haus einsteigt.
Letta ist keine Einbrecherin. Sie ist nicht an dem interessiert, was Einbrecher interessieren würden. Sie hat sich in ihrer Passion ein eigentliches Protokoll zurechtgelegt, das sie genau befolgt. Sie sucht nach einem Andenken. Aber nach einem Andenken, das nicht sie aussucht, sondern von dem sie ausgesucht wird. Ein Taschentuch mit gehäkeltem Rand und den eingestickten Worten „Mensch nütze den Tag, denn er ist kurz“, eine zerkratzte Schallplatte von Miles Davis, ein einzelner Kinderschuh mit vergilbten Maikäfern als Muster. Letta sucht nach dem Andenken in diesem Haus, sucht viel länger als erwartet, erst recht mit Verzögerung, weil da dieser Mann auftaucht und erklärt, er wäre der Enkel. Letta und Paul sind Suchende; Letta nach dem Andenken, Paul mit der Aufgabe, die Asche an Lores liebstem Ort zu verstreuen.
Das verlassene Haus kurz vor seiner Räumung wird zum Schauplatz vieler Begegnungen. Vordergründig zwischen Letta und Paul, unterschwellig zwischen Lore über all die Dinge mit den Menschen, die einst in diesem Haus ein Stück ihres Lebens verbrachten, mit Lore Leben teilten.
„So nah, so hell“ ist ein zartes Debüt von grosser poetischer Kraft. Ein Buch, das viel Aufmerksamkeit verdient, geschrieben von einer Autorin, die mit diesem Roman einen vielversprechenden Weg begonnen hat. Wir werden noch mehr lesen!
Interview:
Ich las Dein Debüt mit grossem Interesse, mit ungetrübter Freude. Nur schon, weil Du eine mutige Form gewählt hast, Lyrisches mit Prosa mischst, deinem Erzählen ganz verschiedene Stimmen und Tonlagen gibst. War von Beginn weg klar, dass Du mehr als nur eine Art des Erzählens für Dein Debüt wähltest? Wieviel Mut brauchte es?
Die unterschiedlichen literarischen Formen sind zusammen mit den verschiedenen Erzählperspektiven entstanden. Es war klar für mich, dass diese nicht einfach in derselben Weise erzählen können. So haben die Gegenstände eine Art Chorfunktion für mich, wie sie gemeinsam und doch sehr individuell von etwas erzählen, was direkt nicht mehr erfahrbar wäre. Ihre Sprache gleicht der verknappten Form von Lyrics in Liedern und hat auch etwas Künstliches. Die Felsteile ihrerseits erlauben es sich, über Jahrtausende auszuholen und doch kurze Momente hervorzuheben. Wenn über Letta oder Paul erzählt wird, sind wir relativ nah an ihnen dran und folgen ihren Bewegungen und Gedanken. Es ist eine alltäglichere und menschlichere Sprache. Es hat nicht unbedingt Mut gebraucht, den Text auf diese Weise zu schreiben, es war vielmehr schön und hat Spass gemacht, zu entdecken, wie es gelingt, eine Geschichte aus unterstimmlichen literarischen Formen heraus zu erzählen. Danach waren es eher Ausdauer und Standhaftigkeit, die nötig waren, um die unterschiedlichen Formen und Perspektiven, zu verteidigen, nicht davon abzukommen und einen Verlag zu finden, der bereit war, dieses Textgewebe herauszubringen.
In alten Kurzbiographien über Dich heisst es „Für ihre Texte sucht sie nach Zeugenschaft in verlassenen Häusern und bei herumirrenden Steinblöcken. Sie interessiert sich für unwahrscheinliche Perspektiven und für das übersehene Offensichtliche.“ Mit diesen beiden Sätzen könnte man auch Letta, die Protagonistin in deinem Roman beschreiben. Keine alltägliche Leidenschaft. Irgendwie doch knapp an den Rändern zur Illegalität. Auch ein Outing?
Ich glaube, ich habe in dieser Kurzbiografie eine Methode offengelegt, die ich brauchte, um ins Schreiben zu kommen. Für diesen Text bin ich von konkreten Orten ausgegangen, die dann im Laufe des Erzählens zu fiktionalen Orten wurden. In dieser Kurzbiografie übertreibe ich ein wenig. Tatsächlich war ich in nicht mehr als einem verlassenen Haus unterwegs und das im Rahmen der Legalität. Aber zugegeben, das klingt auch etwas nach Letta. Möglicherweise ist aus dieser Methode ihre Figur entstanden. Sie ist da aber deutlich abenteuerlicher und eigenwilliger unterwegs, als ich es war.
Ich musste in meinem Leben schon mehrfach helfen, eine Wohnung oder ein Haus zu räumen. Ein ganz eigenes, spezielles Erlebnis. Da wandert in eine Entsorgungsmulde, was zuvor ein Leben lang wie ein Schatz gehütet wurde. Man nimmt Dinge in die Hand, die ihren Wert mit einem Mal verloren, ihre Geschichte eingebüsst haben. Letta sucht nach einem Andenken, einem kleinen Denkmal, das auch im Unscheinbaren steckt. Ist Letta eine Anwältin jener, die ins Vergessen zu rutschen drohen?
Was du in der Frage beschreibst, war auf eine gewisse Weise eine Erzählabsicht von mir: über ein Leben zu schreiben, das scheinbar ungesehen vergangen ist und darüber, wie die Dinge, die für diese Person Schätze waren, mit ihrem Tod zu Müll werden. In dem Roman übernehmen diese Anwaltschaft gegen das Vergessen aber eher die Stimmen der verschiedenen Gegenstände. Durch sie wird nochmals ein Licht auf ein zurückgezogenes Leben geworfen, welches sich zunehmend ohne menschliche Beziehungen abspielte.
Ich glaube, Letta verfolgt da egoistischere Motive, sie sucht nach Dingen, die eigentlich mit ihr zu tun haben, sie sucht sich eine Art selbst gewählte Hinterlassenschaft zusammen. Es sind eher die Umstände, die sie dazu bringen, näher an Lore heranzugehen, über sie nachzudenken.
Paul ist mit der Urne seiner Grossmutter in diesem Haus. Er nimmt zum einen Abschied von seiner Grossmutter, zum andern ist er da mit der Aufforderung seiner Grossmutter, ihre Asche an ihren Lieblingsort zu bringen. Paul muss im Haus mit seiner Grossmutter Zwiesprache halten, um herausfinden, wo dieser „Lieblingsort“ sein könnte. Dein Roman ist neben diesem Kammerspiel zwischen Letta, Paul und Lore auch ein Buch über den Abschied. Wie wichtig ist dir dieses Thema?
Hier geht es um den Abschied von einem Menschen, der zurückgezogen lebte und eigentlich von den Menschen, die dableiben auch nicht vermisst wird. Solche Geschichten gibt es ja sehr viele. Und Paul nimmt sicherlich Abschied von Lore, aber auch von einem Teil seiner selbst. Vielleicht geht es um diesen selbstbezogenen Anteil von Abschied. Aber auch andere Lesarten sind möglich, zum Beispiel Abschied zu nehmen, von einem Leben, welches man vielleicht gerne geführt hätte, Abschied nehmen von Bildern, die wir uns von Menschen machen.
Bist Du ein Mensch, der Dinge sammelt? Wie sehen Deine Regale aus? Ist Schreiben eine Form des Festhaltens, den Dingen ihre Stimme zu geben?
Ich glaube nicht, dass ich den Dingen eine Stimme geben wollte, ich wollte eine Form finden, in der ich Lores Geschichte erzählen kann. Es ging um ein Erschrecken darüber, dass ein Menschenleben vergeht und die materiellen Dinge einfach weiterbestehen, dableiben, und würden sie nicht entsorgt, könnten sie unerträglich lange da sein. Es ging um die Imagination darüber, was in diesen Räumen passiert sein könnte; und gesehen haben es halt bloss die künstlichen Augen dieser Gegenstände. Daher benutze ich die Dinge eher, als dass ich ihnen eine Stimme gebe. Um mit ihrer Hilfe die Geschichte von Lore zu erzählen.
Selbst bin ich keine grosse Sammlerin, so ganz traue ich den Dingen wohl nicht über den Weg.
Agnes Siegenthaler, geboren 1988 in Bern, hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und davor Soziale Arbeit studiert. Sie schreibt Prosa und Lyrik und arbeitet aktuell an ihrem zweiten Roman. Neben dem Schreiben ist sie als Soziokulturelle Animatorin in einer interkulturellen Bibliothek tätig. Aufgewachsen im Emmental, lebt und arbeitet die Autorin rund um die Städte Bern und Fribourg. «So nah, so hell» ist Agnes Siegenthalers Debüt.
Agnes Siegenthaler «Meret 2» & «Café Krokodil» auf der Plattform Gegenzauber
Beitragsbild © Karen Moser & Elias Bannwart