Christian Baron erzählt in seinem Debütroman „Ein Mann seiner Klasse“ von Armut, von seinem prügelnden Vater, seiner depressiven Mutter – und wie ihm der Aus- wie Aufstieg gelang.

Von dort, was man ‚unten‘ nennt
von Frank Keil
Doch, es gibt Lichtblicke. Es gibt Momente, in denen der Vater noch nicht so heillos betrunken ist, dass er hemmungslos um sich schlägt und seine Gewaltausbrüche keine Grenzen kennen. Helle Momente, in denen er vielleicht angetrunken ist, daher gut gelaunt, lustig gestimmt bald, zu Scherzen aufgelegt; wo er aus heiterem Himmel den einen oder anderen Geldschein springen lässt und dann können sich seine Kinder was kaufen, was sie grad wollen; dann umgarnt er seine Frau, auf charmante Art. Oder Momente, wo er seinem ältesten Sohn plötzlich sagt, der könne sein, wie er will, seinetwegen auch schwul – Hauptsache er sei auf das, was er sei, stolz. Richtig stolz. So wie auch sein Vater stolz auf sich sei, egal was die Nachbarn sagten oder die Polizei oder das Jugendamt. Es sind – wie gesagt – Lichtblicke. Meistens aber ist es dunkel. Sehr dunkel. Bis rabenschwarz.
Christian Baron kommt von dort, dass man „unten“ nennt, wenn man nicht von dort kommt; sondern von „oben“ oder – noch beliebter, weil unverfänglicher: „so aus der Mitte“. Er hat einen anderen Weg erst einschlagen können, nachdem das Jugendamt zugriff und dem Vater nach dem Tod seiner Frau die Kinder entzog. Er hat nicht nur die Schule abgeschlossen, er hat studiert und er ist Journalist geworden, Redakteur. Aktuell ist er beim Berliner „Der Freitag“ beschäftigt. Und als die Wochenzeitung eine Kulturbeilage zum Weltfrauentag produzierte, schreibt er für diese einen Essay: „Ganz egal, ob geprügelt und ob das Geld versoffen wurde: Ich wollte immer genau so werden wie mein Vater“, der Untertitel (www.freitag.de/autoren/cbaron/ein-mann-seiner-klasse). Die Literaturagentin Franziska Günther bekommt ihn in ihre Hände, und sie kontaktet Baron und schlägt ihm vor, genau darüber ein Buch zu schreiben. Und er setzt sich hin und schreibt seine Lebensgeschichte auf, und er hat sie vor allem literarisch geformt.
Die Kapitel heissen ZORN, GLÜCK, SCHMERZ und ÜBERRASCHUNG. Sie heissen SCHAM, STOLZ, ANGST, LIEBE, dann HASS und HOFFNUNG. Und das letzte Kapitel heisst ZWEIFEL. Jeweils in Grossbuchstaben.
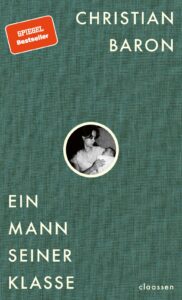
„Vom Laster gefallen“ murmelnd der Vater, wenn er von der Arbeit kommt und irgendetwas mit nach Hause bringt, was er sich sonst nicht leisten könnte, manchmal Spielzeug für die Kinder. Er ist kräftig und stark, der Vater, er arbeitet als Möbelpacker, der alles tragen kann, im doppelten Sinne des Wortes. Und er fürchtet sich nicht – und das hat seine guten, aber vor allem hat es seine schlechten Seiten. Von denen er durchaus weiß, die ihm nicht unbekannt sind. Dass er, der so stolz auf seine körperliche Arbeit ist, die er jeden Tag stemmt, genau davon nicht leben kann, macht die Wut aus, die ihn immer wieder packt. Hätte es einen Ausweg gegeben? Gibt es einen für einen wie ihn?
Baron, 1985 in Kaiserslautern geboren, erzählt die Geschichte seiner Kindheit einerseits gradlinig und direkt; andererseits wechselt er hin und wieder in sachte Rückblenden. Schaut sich zu wie er schaut, auf sich und seine Geschwister und die Eltern, damals. Ist aber auch unterwegs in der erzählerischen Gegenwart, sitzt dann mit seinem entsprechend erwachsenem Bruder zusammen und sie reden über das, was damals war; an das sie sich durchaus unterschiedlich erinnern, wie das so ist. Und im nächsten Moment geht es wieder zurück ins damalige Geschehen, mit einer Unmittelbarkeit, die einen packt, als sei man dabei. Im Schlechten wie im manchmal im Guten.
Und so ist sein Buch entsprechend auch keine blanke Abrechnung mit seinem Vater. Es ist kein hasserfülltes Buch, das ist es so gar nicht. Baron schreibt von dem, was damals war; schlüpft als erwachsener und als entsprechend distanzierungsfähiger Autor in die Sicht eines Kindes, dass sich seine Welt, in der es nun mal lebt, so erklären muss, dass das Leben in ihr aushaltbar bleibt. Und am besten mehr als das. Und er erzählt auch davon, dass es helfen kann, das Lebens (s)eines Vaters zu verstehen, was nichts damit zu tun hat, es zu entschuldigen oder zu billigen. Sondern: verstehen, um wichtiges für sich selbst zu erfahren. Etwa: Warum man seinen Vater, der einen schlägt, trotzdem liebt. Das es kein entweder/oder ist, als Kind. Und später dann auch nicht mehr.
Wobei wir bei alledem nicht im luftleeren Raum bleiben, sozusagen. Es gibt schliesslich auch Nachbarn, die wegschauen oder die mal gegen die Wand hauen, wenn es drüben in der kleinen Wohnung drunter und drüber geht und sie der Lärm stört. Es gibt Mitschüler, die dem Erzähler immer wieder klar machen, dass er unter ihnen nichts zu suchen hat; dass er wieder dort hingehen soll, wo er herkommt. Und dass er dort zu bleiben hat. Auch davon erzählt Baron.
Und es gibt starke Frauenfiguren, offenbar im Leben wie erst recht im Buch. Die Mutter etwa, die in ihren Jugendjahren Gedichte schrieb – und es gibt eine Szene, in denen ein Lehrer diese Gedichte vor der versammelten Klasse verhöhnt und die nun sichtbare Brutalität steht in nichts dem nach, was ihr Mann später mit ihr anrichtet, wenn er ihren Kopf greift und zuschlägt. Gewalt – auch davon erzählt Baron – sind nicht nur Schläge. Man kann auch einen Menschen niederschlagen, ohne ihn zu berühren.
Und es gibt die Tante, die zu retten versucht, was noch zu retten ist: ihre Schwester, die immer wieder in tagelange Depressionen versinkt und dann das Bett nicht verlässt; die Kinder, die in dem Wechselspiel von unerwarteter Zuneigung und plötzlich ausbrechender Gewalttätigkeit unterzugehen drohen. Wie soll man das auch verstehen, dass mit einem Mal wieder alles ganz anders wird?
Es sind denn auch immer wieder die hoffnungsvoll aufscheinenden Momente, die einen durch die Lektüre leiten und die davon erzählen, dass Menschen auch in Momenten großer Bedrängnis versuchen sich ihre Freiräume zu sichern und seien es noch so weniger: Die Mutter tanzt hingebungsvoll zur Musik der Kelly Family. Mit dem Vater spielen die beiden Jungs eine Runde Super Mario auf der Konsole, die rein zufällig vorher vom Laster gefallen ist. Und gelegentlich taucht auch ein ganz feiner Humor auf; der Humor der vordergründig Unterlegenen, die nicht daran denken, dass sie klein beigeben; die darauf bestehen, dass auch ihr Leben eine eigene Würde und immer auch Geschichte hat.
Ja, es gab Momente, in denen sass man gerne mit dem Erzähler, seinen drei Geschwistern und der Mutter in der kleinen Küche und schaute zu, was sich ergab; hörte zu, was gesprochen wurde, was gescherzt. Und wenn der Vater hinzukam, dann war das zuweilen auch okay. Eher selten, eigentlich fast nie. Aber manchmal eben doch. Und genau diese Momente versucht der Autor zu bewahren. Auch um sich zu retten, vielleicht bis heute.

Christian Baron wurde 1985 in Kaiserslautern geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Germanistik in Trier. Nach Stationen bei der Lokalzeitung Die Rheinpfalz und Neues Deutschlandsowie Veröffentlichungen bei nachtkritik, Neue Zürcher Zeitung und Theater der Zeit arbeitet er seit 2018 als Redakteur bei der Wochenzeitung der Freitag.
Das Harbour Front Literaturfestival vergibt den Klaus-Michael Kühne-Preis zum elften Mal an das beste Romandebüt des Jahres. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll junge Literatur fördern und deren Bedeutung unterstreichen.
Die Mitglieder der Hauptjury – Felix Bayer (Spiegel), Stephanie Krawehl (Buchhandlung Lesesaal), Stephan Lohr (NDR Kultur a.D.), Maximilian Probst (Zeit) und Meike Schnitzler (Brigitte) – begründen ihre Entscheidung für Christian Baron und seinen Roman „Ein Mann seiner Klasse“ (Claassen) wie folgt:
„In seinem autobiografisch angelegten literarischen Debüt «Ein Mann seiner Klasse» beschreibt Christian Baron auf sehr eindrückliche Art das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie in Armut. Die Jury hat besonders überzeugt, dass die Leserinnen und Leser in ein Milieu geführt werden, das oft nur als statistische Grösse auftaucht. Hier bekommt diese Welt eine Stimme und das in einer literarisch klug gestalteten Weise. Christian Baron verzichtet auf Klischees und ideologische Zuordnungen. Vielmehr entlarvt er die Muster gesellschaftlicher Kategorisierungen und überzeugt durch die Bestandsaufnahme eines Lebens mit einem stets betrunkenen und prügelnden Vater und einer depressiven und früh an Krebs gestorbenen Mutter – Mit allem Schrecken, mit allem Schmerz, aber auch mit den Momenten von Stolz und Glück.“
Beitragsbilder © Hans Scherhaufer





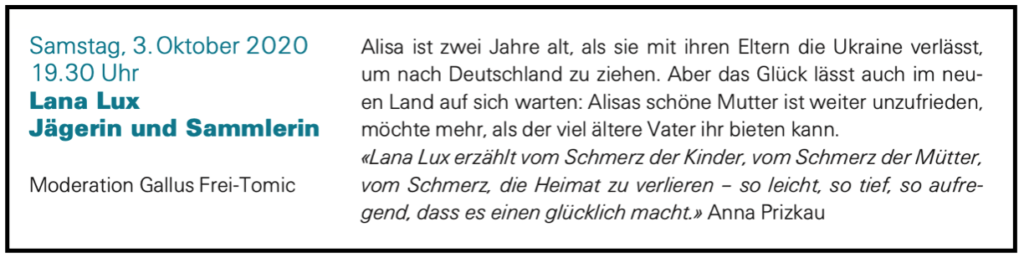








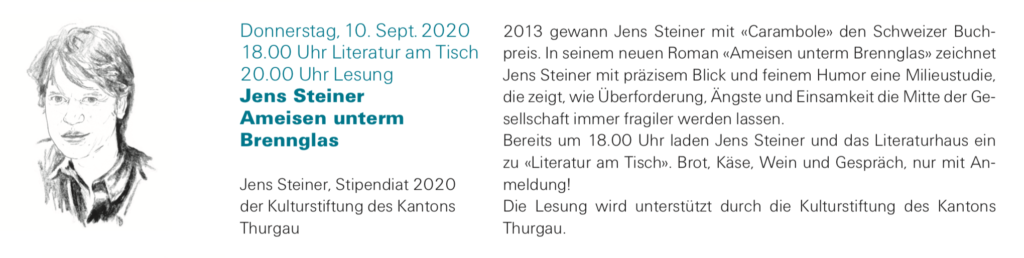




 Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»
Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»







 Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.
Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren im Luchterhand Verlag.
 Gastbeitrag von Cornelia Mechler
Gastbeitrag von Cornelia Mechler
