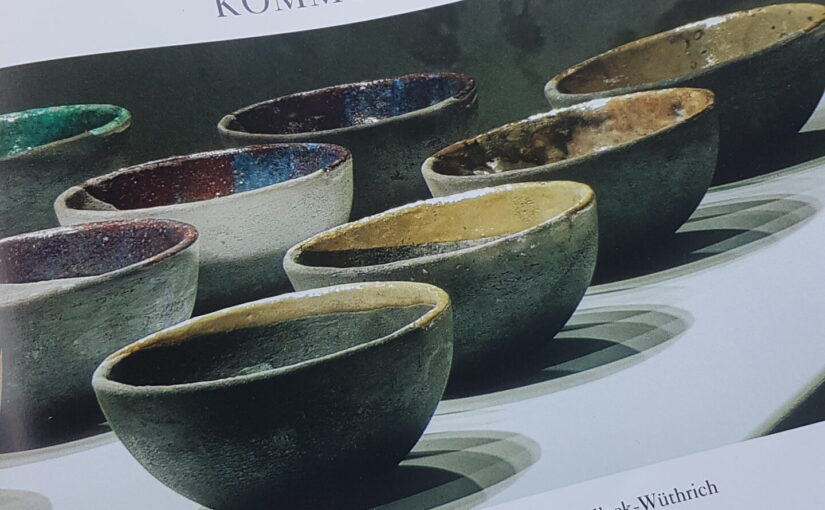I
Geduckter Rauch
Trafen sich ein Mann.
Trafen sich und hatten nur den Namen bei. Ihm Düren.
Trafen sich in dieser hochbegabten Steppe aus kurz
Geschorener Musik. Wie das klingt. Frag Ihm doch.
Ihm seine Augen, ich beginne immer mit den
Augen, wirkten, aber waren braun und
Zerstritten.
Als hätte
Ihm
In einer verschärften Situation
Die Brille zu lange auf –
Behalten. (Siehst du.) Die enge Allee
Durch den stahlblonden Heimat ist eine
Verschorfte Situation. Da passen zwei März Ärzte
Ohne Schwestern nebeneinander. Warum ausgerechnet
Zwei. Das kann ich dir sofort sagen, weil du nur so, schon von
Weitem mit Mitte rechnest. Heimat kannst du schon auswendig
Lernen, sobald sie nur über Wörter verfügt, die
Freiwillig bei dir bleiben. Draußen, aber nicht unbedingt, zerriss der
Schnee. Ich wusste, dass du nur Gas lachst, die blasse Allee in einer
Angenehmenen Stadt, von der links und
Rechts Flammen ab –
Gehen. Pass doch auf, wo du hin
Trittst, Kleiner, das
Schöne Feuer.
Zuerst ist es ganz sacht und spielt mit dir Mutter, Vater,
Mitte. Dann ist es ganz Mitte und spielt mit dir Mutter, Vater,
Feuer. Ist die Asche schon fertig. Wie lange braucht
Ihr denn noch. Einsblondundachtzig. Das müsste doch in
Einem Land zu machen sein, auch wenn es
Hier nicht ganz für die sieben Winden reicht, aber vier,
Dürre, flache würden sich schon auf –
Treiben lassen. Einer davon hat Strandgut geatmet, ein wenig
Schaum, ein wenig Flaschen –
Rost. Dieser wäre Ihm sicher der liebste. Ich habe das
Land nicht im Reim erstickt. Dabei ersticke ich
Es gar nicht so gern. Ihm hat es so gewollt.
Trafen sich ein Mann.
Trafen sich und hatten nur den Namen bei. Ihm Düren.
Trafen sich in dieser kurzbegabten Steppe aus hoch –
Geschorener Musik.
II
Ihrisches Crescendo
Trafen sich eine Frau.
Trafen sich und hatten nur den Namen bei. Ihr Belwas.
Trafen sich in dieser hochgesteppten Musik aus kurz –
Geschorener Begabung. Ich habe das Land nicht
Im Reim erstickt. Dabei ersticke ich es gar nicht so
Gern. Ihm hat es so gewollt. Ihr hat es so
Gewollt. Schaum,
Elektrischer Süden rückt von den Rändern nach
Innen, Lehn –
Sucht bleibt unser Ledergewächs, das Lager
Hinauf, frisch
Gerissene Ängste ändern die Sätze
Auf, was ist
Schon eher zu Ende (sag an) als kaum zu
Beginnen, Belwas.
Ihr hatte ihr glänzendes Haar, ich beginne immer mit dem
Haar, aus frischen Kastanien gezogen. Weiß lag noch Mehl
Auf dem Nabel. Ihrs Monat war der Oktober, geflochten aus Segel –
Bekleideten Stürmen und den Überresten der Stranddorn –
Kolonnen. Ihrs Heirat war folgerichtig mit dem Tag zusammen –
Gefallen, da sie sich entschlossen hatte, allein zu
Lieben. Doch nun trug sie einmal den Ring. Und das
War schon immer so. Ihr hatte darauf bestanden,
Ihren Mann nicht weiter zu erwähnen. Ich hatte
Ihrs Schmerzen längst begriffen und willigte ein, natürlich
Auch, um ihr, als Figur weiter folgen zu dürfen, ihr, der von
Vornherein nichts anderes übrigblieb, sie bis ins
Feinste auszukosten, die Technik des Scheiterns,
Belwas, wenn du das durch –
Hältst, finde ich dich zum Kosten. Schmerz gegen
Schmerz ergibt irgendwann weit hinten an der Küste
Einen neutralen Aufprall. In Ihrs Fall war es anders, sie
Konnte nicht schwimmen, und das machte sich
Ihr zunutze. Nach drei Tagen wurde
Ihr, an den Strand geworfen, gefunden. Weiß platzte
Der Schaum auf dem Nabel.
Trafen sich eine Frau.
Trafen sich und hatten nur den Namen bei. Ihr Belwas.
Trafen sich in dieser hoch –
Begabten Steppe aus kurz –
Geschorener Musik. Frag Ihm doch. Frag
Ihr doch.
III
Verwaschene Grafschaft
Traf sich eine Mann und ein Frau.
Traf sich und hatte nur den Namen bei. Ihm Düren. Ihr
Belwas.
Der golfene Strom hatte seine flache Wärme ins Land
Gespült und das Januarmittel aufgeheizt auf sieben Komma sieben
Grad, so dass Sich selbst hier, in dieser
Abgeraschelten, bröckeligen Gegend Palme
Und Rhododendron als zarte Requisiten entfalten konnten, was sich als
Äußerst günstig erwies, denn dieser subtropische Hauch hatte die
Beiden Toten ein wenig grün betastet. Verwesung ist doch auch nichts
Anderes als nachlassende Kondition. Ihm hatte ein aschfahles Gesicht. Ich
Beginne immer mit Asche. Ihrs Körper hatte die ausgeschlafene Form fleisch –
Farbenen Wassers. Ich beginne immer mit Wasser. Nur, dass sie nicht weinte, schien
Ihren Körper noch zusammenzuhalten. Es ist natürlich einfach, zwei
Verendete Körper leger in dieselbe Landschaft zu streuen. Ich hatte ziemlich
Genau darauf geachtet, dass es sich dabei um eine Region
Handelte, so wie die Grafschaft Galway, die ziemlich dünn besiedelt
War, so dass ich einigermaßen sicher sein konnte, nicht in die Lage zu
Geraten, ländliche Bauern und deren Hütten skizzieren zu müssen, sobald
Es Ihm und Ihr darauf anlegten, auf etwas Lebendiges zuzuhalten. Obwohl
Eine schon vor Jahren verlassene Lehmmauer doch auch etwas
Hat. Dass sich Ihm und Ihr vorher noch nie gesehen hatten, blieb erstmal
Ihre einzige Verwandtschaft. Doch was willst du mit zwei Menschen
Anfangen, die frieren, Hunger haben, doch keine Hütte aus ungefähr gleich –
Langem Holz. Hier ist ein Hochlandrind zum Umwickeln. Hier
Sind die Beeren. Hier sind neun besonders eng stehende
Bäume. Bevor ich die Beiden jedoch sich näherkommen
Ließ in der geölten Mechanik der Küste, nahm ich von
Schafen, nahm von den Schultern und Säften, das, was sich eignet zur
Scham. Jetzt bist du dran, Düren. Darf ich Sie zu einem Fell
Einladen. Darf ich Sie zu den Beeren einladen. Darf ich Sie zu den
Neun besonders eng stehenden Bäumen einladen. Am Ende solcher
Sätze, die auch immer in einen Dschungel von nicht –
Gesagten Sätzen münden, die jedoch nie den gemeinsamen
Kern preisgeben, am Ende solcher Sätze entzündete sich immer
Beinahe das schmale Fest des Fleisches. Ein wenig zuckten
Die Lenden auf, in ihrer deutlichen, ledernen
Sprache. Jetzt bist du dran, Belwas. Ihr sagte zwar
Nichts. Ihr berührte zart mit dem Ellenbogen
Ihms Kinn.
IV
Tage ja Monatelahm
trug ständig das Meer die gleichen Klänge nach innen, vor
Die Hütte aus ungefähr gleichlangem Holz.
Die neun besonders eng stehenden Bäume hatten Ihm und
Ihr mit Schlamm und Steinwerk höhergezogen, so dass keine
Behaarten Sterne mehr dazwischenfahren konnten, nur die Geräusche
Gestrandeter Seevögel hatten noch gute Aussichten eingelassen zu
Werden. Düren hatte mit Feuer, das Feuer habe ich ihnen zukommen
Lassen, falls es Fragen gibt, Düren hatte mit Feuer einen majestätischen Stamm
Gehöhlt, den er in den frühen Stunden der kaum behinderten Sonne zum
Fischen benutzte, bis das Netz, das Netz habe ich ihnen zukommen lassen, falls
Es Fragen gibt, bis das Netz gefüllt war mit beweglichem Bronzebesteck. Belwas
Hatte in Ihms Abwesenheit ihr glänzendes Haar zu weichen, fließenden Kastanien
Geflochten, die langsam und feucht auf die Lenden zu –
Strömten. Den ganzen Tag nur die braune See, der Regen roh und in Würfel
Geschnitten. So hielt die Insel ihren genauen
Unterricht ab. Düren, nach vorn, an die Tafel, an welche denn
Sonst. Hat ein Wort wie Heimat, wenn es dich ständig in einer beengenden
Situation betrifft, nicht auch außerhalb solcher Zustände seine
Neutrale Geschlossenheit. Sind nicht die Worte selbst zu
Einem Täuschungsobjekt einer nicht eingestandenen, einer
Verhinderten Liebe geworden, runtergehandelt zu dem Preis, für etwas
Anderes nur Schmiere zu stehen. Erst wenn die Scham zerrissen,
Zuckend vor unseren Füßen liegt, krümmt sich die Sprache
Zurück in ihren tierisch zarten Zustand, gehört so noch
Enger an die Zähne. Die wesende Geburt des Herbstes, beige faulten
Die Bäume ineinander über, hatte es längst bewiesen, selbst die Liebe war
Nur eine Schlichtungsform der Neugier. Jetzt, nach überstandenen Monaten
Der Ähnlichkeit, hielt ich es für angebracht, ihm und ihr eine gleich –
Mäßige und bedächtige Zerstörung der Insel durch das Wasser vorzu –
Schlagen. Ihms und Ihrs Reaktionen darauf waren diesem
Traurigen Programm angemessen. Belwas löste ihre erstaunlichen Kastanien
Zu einem allmählichen Wasser. Golf, Rhododendron und eine
Schon vor Jahren verlassene Lehmmauer hatten sich in feinen
Fasern verbunden. Auch wenn es hier nicht ganz
Für die sieben Winde reicht. Aber vier dürre, flache
Würden sich schon auftreiben lassen. Und es kam wie ein trockenes, hoch –
Triftiges Gas, das in den feinen Fasern ein zittriges Sirren
Erzeugte und beim Berühren das Wasser
Verähnelte in eine starre, elektrische
Weide. Tage ja monatelahm trug ständig das Meer die gleichen
Klänge nach Hütte, vor die Holz aus ungefähr gleich –
Langem Innen. Jetzt bist du dran, Ihm. Darf ich Sie zu den nass
Gewordenen Beeren einladen. Darf ich sich zu den neun besonders eng
Unter Wasser stehenden Bäumen einladen. Darf ich dich in das Fell
Tun. Ein wenig zuckten die Lenden auf, in ihrer
Deutlichen, ledernen Sprache. Sehgestöber, Sanddornperlen von der Schnur
Gelassen, Schlamm und Steinwerk in weicher
Veränderung, Geräusche aufgespülter Seevögel, nur, dass
Sie nicht weinte, schien Ihrs Körper noch zusammenzu –
Halten. Es gelang ihr nicht mehr, ihm zu zeigen, wie sehr
Sich über ihnen die See schloss. Das gefiel ihm an
Ihr. Und ihr machte es Spaß, Ihm nicht zeigen zu
Müssen, wie sehr sich über ihnen die See schloss.
(Dürwas)
(Veröffentlicht in «Die Verteilung des Lächelns bei Gegenwehr» (Gedichte und Texte 1986-1988, Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Leipzig))

Thomas Kunst wurde am 09.06.1965 in Stralsund geboren. Nach dem Abitur studierte Thomas Kunst zunächst 3 Monate Pädagogik in Leipzig und ist seit 1987 als Bibliotheksassistent der Deutschen Nationalbibliothek tätig. Er schreibt Gedichte und Romane. Kunst debütierte 1991 bei Reclam Leipzig mit dem Buch »Besorg noch für das Segel die Chaussee. Gedichte und eine Erzählung«. Bislang sind 20 Einzeltiteln veröffentlicht worden. 2021 war er mit seinem Roman «Zandschofer Klinken» auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. 2023 überreichte man ihm den Kleist-Preis. 2024 wir bei Suhrkamp sein neuer Gedichtband «Wü» erscheinen.
Beitragsbild © Franziska Reck








 Beatrix Langner, 1950 geboren, ist promovierte Germanistin, Autorin und Literaturkritikerin und lebt in Berlin. Seit 1990 zahlreiche Rundfunk-Features und Kulturreportagen für DeutschlandRadio Berlin sowie Feuilletons und Kritiken für Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Deutschlandfunk Köln u.a. Sie veröffentlichte eine Biografie über Jean Paul (C. H. Beck), für die sie 2013 den Gleim-Literaturpreiserhielt, und ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland.
Beatrix Langner, 1950 geboren, ist promovierte Germanistin, Autorin und Literaturkritikerin und lebt in Berlin. Seit 1990 zahlreiche Rundfunk-Features und Kulturreportagen für DeutschlandRadio Berlin sowie Feuilletons und Kritiken für Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Deutschlandfunk Köln u.a. Sie veröffentlichte eine Biografie über Jean Paul (C. H. Beck), für die sie 2013 den Gleim-Literaturpreiserhielt, und ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland.