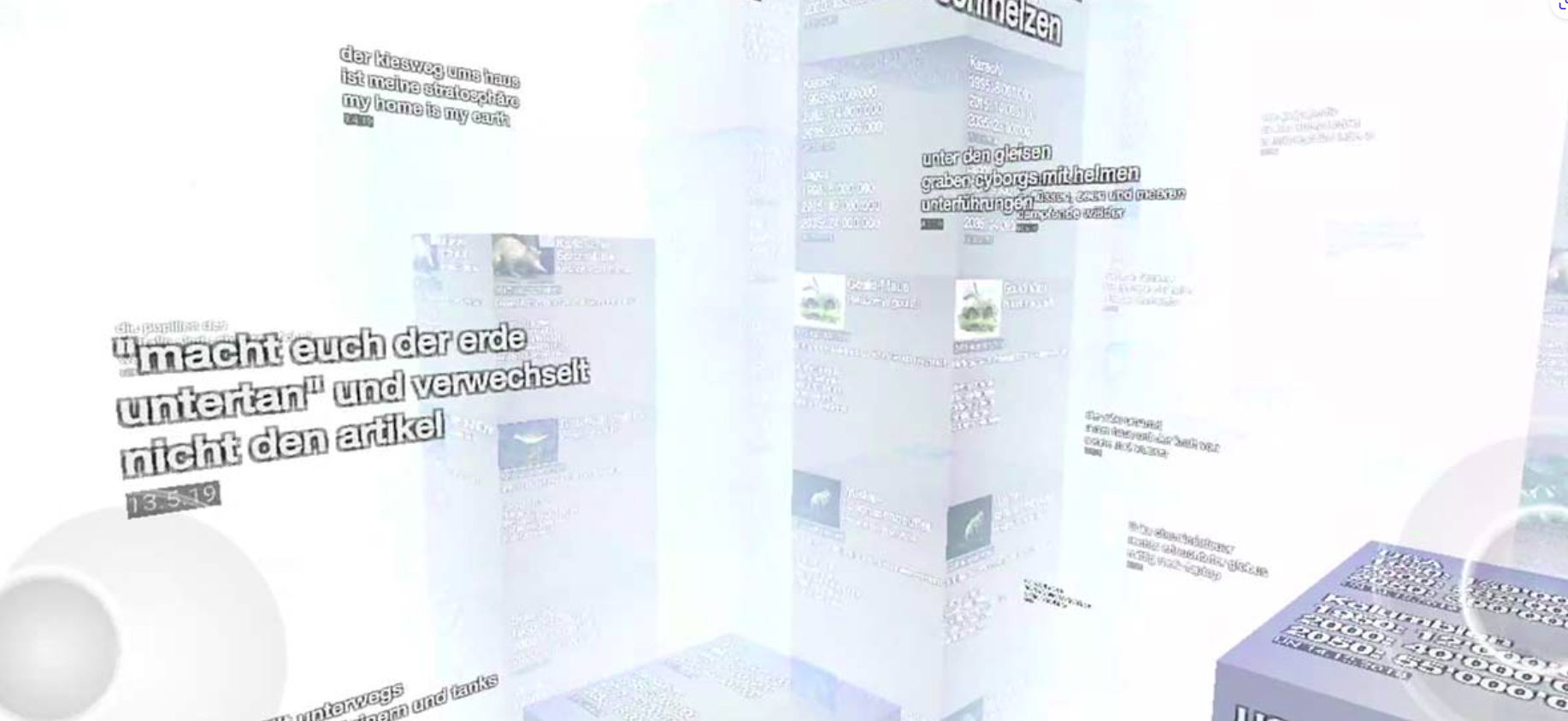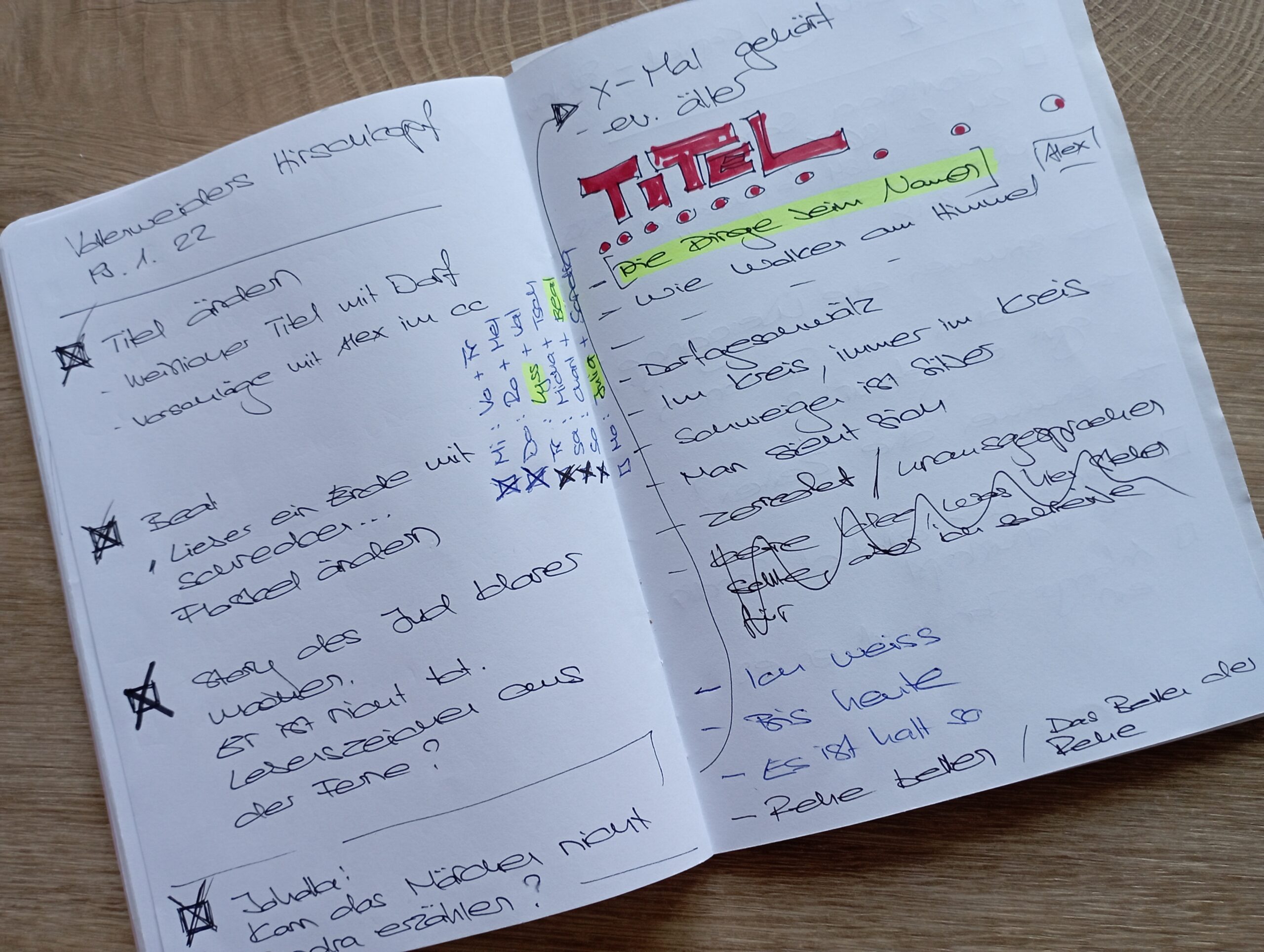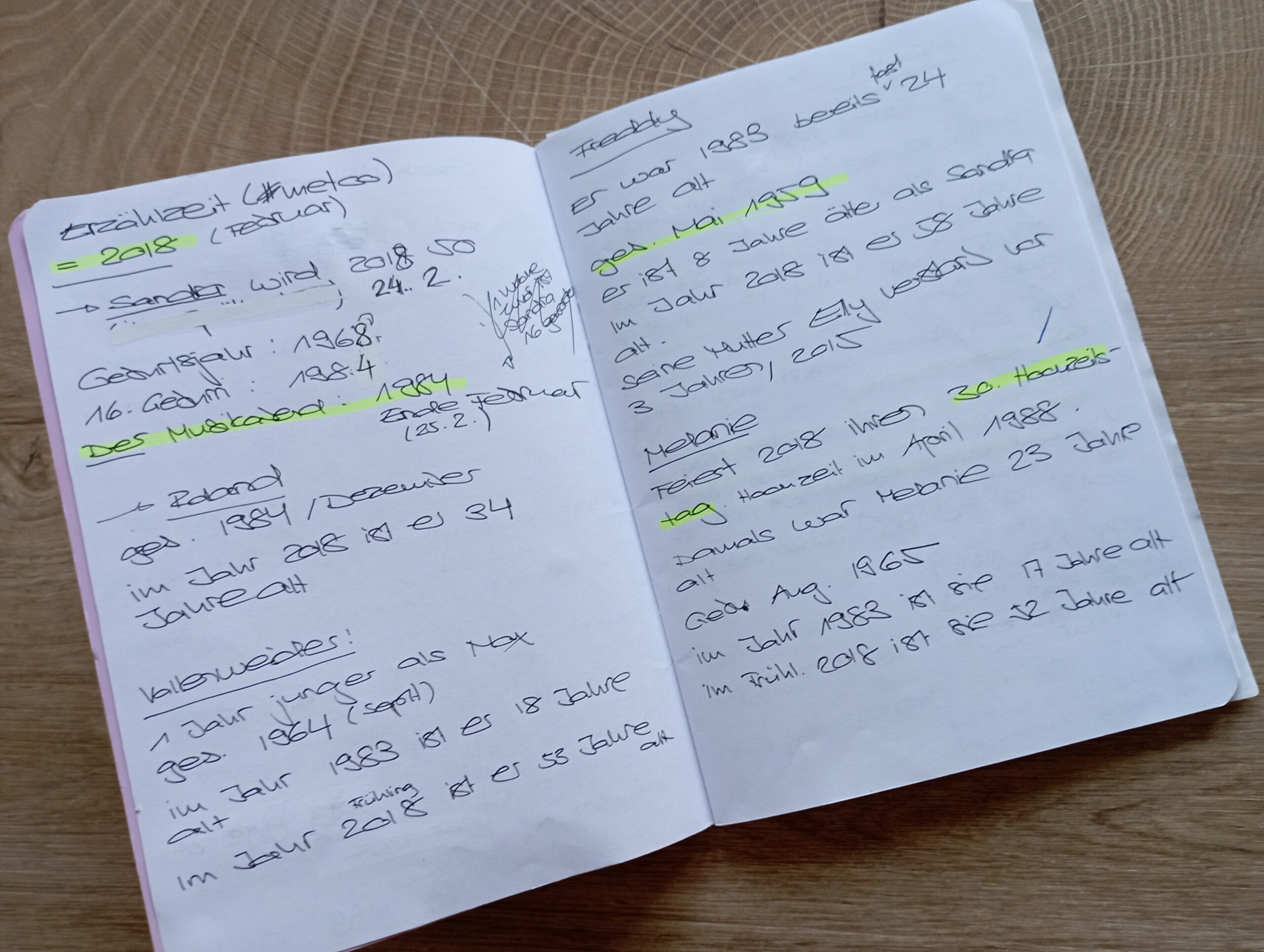Die Gabel
Er schneidet sein cordon bleu, sie stellt das Weinglas wieder auf den Tisch. «Weisst du, Mari, ich weiss eigentlich gar nicht mehr, wie du aussiehst», sagt er. «Ich sehe dich da und sehe dich auch nicht. Wenn ich auf deine Wangen sehe, denke ich immer nur, ich sehe wieder die gebleichten Küchenwände unserer ersten Wohnung im Schangnau, als ich Möbel ausgeliefert habe für den Steffen. Am Abend sind wir am Küchentisch gesessen und unter der Lampe hat alles dieselbe Farbe gehabt. Deine Wangen hatten den matten Schimmer, wie die Wand hinter dir. Und diesen Schimmer sehe ich jetzt noch auf deinen Wangen, da kann man nichts machen. Und deine Augen, das sind die Augen vom Sean. Das sind Kinderaugen für mich. Sie sagen mir immer, wie er hat Landschaftsmahler werden wollen und du stolz auf ihn gewesen bist und ich nur gemeint habe, dass man damit kein Geld verdiene, auch wenn er Talent habe, was ich nicht beurteilen könne. Dabei haben mich die Augen vom Sean zuerst an deine Augen erinnert und nun ist es umgekehrt. Und bei deiner Stirn ist der Huttwiler Wald, wo wir uns immer gestritten haben, das Moos an den Bäumen, wo du deine Stirn daraufgelegt hast und immer, wenn ich gedacht habe, dass du weinst und ich dir einen Arm um die Schultern gelegt habe, hast du zu wüten angefangen und mich beschimpft und auf deiner Stirn ist noch etwas Moos gewesen, was du nicht weggemacht hast. Und bei deinen Haaren sehe ich wieder die Scheiben meines Alten VWs, die innen sich beschlagen haben im Winter, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, weil deine Eltern mich dich nicht besuchen lassen wollten und wir uns draussen getroffen haben, auch im Winter und deine Haare sind über die Scheibe geglitten und feucht geworden und du hast dich geekelt vor dem feuchten Haar, dass ich dich nicht mehr habe berühren dürfen an dem Abend. Aber wenn ich deine Lippen ansehe, dann sehe ich auch meine Wohnung in Aarwangen, wo du nie gewesen bist, den Velourteppich der Wohnung, ich weiss nicht weshalb. Damals als wir uns getrennt haben für zwei Jahre und du mit diesem Basler zusammen warst. Da bin ich oft auf diesem Velourteppich geschlafen, weil mir das Bett zu leer gewesen ist und mein Gesicht ist am Morgen wund gewesen von diesem Teppich. Das kommt mir in den Sinn, wenn ich deine Lippen ansehen. So ist das: Bei den Wangen die Küchenwände in Schangnau und bei den Augen die Augen von Sean und bei der Stirn das Moos im Huttwiler Wald und bei den Haaren die feuchten Scheiben vom VW und bei den Lippen der Velourteppich. Eigentlich ist es nur dein Hals, an dem ich nichts sehe, als deinen Hals, den ich immer gern geküsst habe und der mir schon aufgefallen ist, als du mich nicht beachtet hast und ich neben dir gesessen bin und mich nicht getraut habe dich anzusprechen.»
Im Oltner Restaurant lächelt sie, streicht kurz über seinen Handrücken und nimmt wieder ihr Besteck auf. Sie bemerkt wie er erneut auf ihre Wangen sieht, auf ihre Stirn, ihre Augen, ihre Haare, auf ihren Hals, und sie schiebt ein Stück des cordon bleus an den Tellerrand, sticht mit der Gabel hinein. Sie mag kein cordon bleu und bestellt es immer nur, weil er es mag und sie ihm sagen kann, dass sie satt sei und ob er nicht den Rest noch möge. Sie nimmt mit dem Messer den heruntergelaufenen Käse auf und streicht ihn auf das Stück Fleisch an der Gabel.
Wunderschön
Matthias Hauser ist blind, doch seit seiner Kindheit fotografiert er jedes Ereignis, welches ihm wichtig scheint, lässt die Fotos entwickeln und klebt sie in ein Album. Bilder des ersten Schultags, der ersten Liebe, der Reise nach Marokko. Auch wenn er nicht sehen kann, meint Matthias Hauser, so sehe doch die Kamera für ihn und nichts ginge verloren. Trotzdem hat er seine Bilder noch keinem Menschen gezeigt, aus Angst, es könnte nicht das darauf sein, was er sich vorstellt. Als Matthias Lisa kennenlernt, sie sich verlieben und bald heiraten wollen, holt er an einem Abend ein erstes Mal sein Album hervor. Lange und schweigend blättert Lisa durch die Bilder, bis sie zu ihm sagt, sie seien wunderschön.
Kurz vor Olten
«Hey Peter, ja, ich bin’s … stör ich dich? Nein, ich bin im ZUG. … Gut … nein, kein Stress.»
Einige lesen, einige sehen in ihre Laptops. Ein dicker Mann schläft mit offenem Mund.
«Hab vorhin auf dem Perron gewartet, und mir überlegt: wie lange ist es her, seit ich eigentlich mit jemandem geredet hab. Wirklich, also so richtig geredet … man spricht viel, wenn der Tag lang ist, aber nicht richtig … Was ich sagen wollte, Peter … In der letzten Zeit kommt es mir vor, als wär ich … wär ich allein. Ich weiss, das klingt komisch, wenn jemand wie ich das sagt. Ich habe ja nie Mühe auf Menschen zuzugehen, da kenn ich nichts, und bei meinem Beruf, da lernt man immer neue Leute kennen und in Langenthal kennt mich die halbe Stadt und … und die Vereine und die Projekte. Aber weisst du, Peter, ich … Ich fand das komisch, als ich mir das überlegt hab und ich hab mir gedacht: das müsse etwas Anderes sein, allein … das kannst du bei jemandem wie mir nicht sagen, nein, so etwas wie das Burn-out vom Lüthi, das … Aber es kommt mir vor, als versteht mich niemand. Als wüsste gar niemand, wer ich bin. Dann dachte ich, es seien die Frauen. Und wenn jemand bis vierzig keine gefunden hat, dann findet er keine. Dass es dieses Alleine-Sein ist. Die Bettkälte. Und ich gebe zu, dass es nicht leicht war, aber heute, wenn man sich an das Leben so gewöhnt hat, da will man auch nicht noch eine Frau. Ehrlich, da … Da gibt es die, die sind glücklich mit einer Frau und die, die sind unglücklich mit einer Frau. Und da gibt es die, die sind glücklich ohne Frau und die anderen sind unglücklich ohne Frau. Da gibt es immer beides. Aber wenn ich mich etwas frage, dann warum ich eigentlich keine Frau hab; wenn ich doch so gut mit den Leuten kann. Und es ist mir auch nie schwergefallen, eine Frau anzusprechen und ich hab mit so mancher etwas gehabt, ich hab sie gar nicht mehr gezählt. Das sage ich nicht zum Prahlen, Peter, du weisst das. Aber ich will dich gar nicht so lange aufhalten, und dich vollquatschen, Peter, nein, um was es … Aber es ist genau das. Das hab ich mich gefragt. Warum ist da trotzdem nie etwas Richtiges daraus geworden. Und ich denk mir auch, dass ich vielleicht schon eine spannende Person bin und viel erlebt habe und viel mache, aber wenn man mich kennt und wirklich kennt, dann ist es halt vorbei. Ich weiss nicht, ob ich jemand bin, mit dem man länger etwas zu tun haben will. Ich bin ein komischer Mensch, und rede viel und mache viel, und das macht mich auch interessant und deshalb kann ich auch gut mit Menschen. Aber das ist dann auch alles. Aber ja, Peter, ich muss aussteigen. War schön mit dir zu sprechen, hab das mal gebraucht. Sorry, jetzt, dass ich dich so vollgequatscht hab. Ist wahrscheinlich einfach eine Laune und morgen ist es wieder vorbei. Ja, man sieht sich. Du, am Donnerstag, dann ist ja die Opel-Messe in Burgdorf. So, ich muss. Tschüss, Peter, tschüss.»
Er steht auf. Ohne aufzulegen, schiebt er das Mobil-Telefon wieder in die Tasche. An der Türe wartet er mit drei Männern und einer Frau. Er hat Peter nicht angerufen.
Der Zug hält, er steigt aus. Als er sich umdreht, sieht er hinter den Fenstern die Passagiere des Regionalzuges nach Olten. Einige lesen, einige sehen in ihre Laptops. Es war ein langer Tag.
Intensivkurs Französisch
Nachdem die Lehrerin nach der letzten Stunde des Französischkurses sie zu einem Kaffee eingeladen hat, kommen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam aus dem Restaurant. Michael Ledermann geht neben einer grossgewachsenen Frau, ohne etwas zu sagen. Er kennt ihren Namen nicht, nur den Nachnamen hat er während den Stunden erfahren. Sie heisst Madame Schleiermacher. Vorhin im Restaurant sprachen sie in einer kleinen Gruppe über Paris. Nun hat sich die Gruppe aufgelöst, einige gehen zu zweit, einige allein. Er neben ihr. Er mag Madame Schleiermacher, wenn auch nur wegen ihrer Art Kugelschreibern nervös auf dem Pult zu drehen. Gerne würde er das Gespräch fortführen, doch es fällt ihm nichts ein. Schade sei es, sei der Kurs bereits vorbei, könnte er sagen. Er hätte viel gelernt. Nett sei es von der Lehrerin, hätte sie sie alle zum Kaffee eingeladen, auch das könnte er sagen. Er sagt nichts. Es wäre zu offensichtlich, dass er nur ein Gespräch anfangen möchte. Er hört vorne die Lehrerin etwas erzählen, das er nur schwer versteht. Es geht um Tulpen. Thomas Ledermann sieht zurück. Er sieht das Restaurant. Die Fenstergläser glänzen in der Sonne. Eines der Fenster ist geöffnet. Sie wohnt in Zürich, hat sie erzählt. Er könnte sie fragen, ob sie von Zürich hierher pendle. Das könnte er. Doch ist zu viel Zeit vergangen. Wenn er sie jetzt etwas fragen würde, würde sie denken, er hätte sich die ganze Zeit überlegt, was er mit ihr sprechen könnte. Es wäre seltsam.
Die Leber
Bereits als sie den ersten Bissen der Kalbsleber in den Mund schiebt, merkt sie, dass es ihr nicht schmeckt. Das Fleisch ist schwammig und beinahe sauer. Muriel Amstutz denkt an das Kalb, das man wegen dieser Leber geschlachtet hat, nicht nur geschlachtet, man hat es gehalten, aufgezogen, es hat wegen diesem Stück Fleisch gelebt, und nun schmeckt es ihr nicht, es ekelt sie sogar ab dieser sauren Art von Fleisch. Muriel Amstutz wird still. Es war der jungen Kuh so gegangen, wie ihr selbst. Alle die Erwartungen, die die Menschen an sie hatten – und es waren im Grunde wenige – konnte sie nicht erfüllen. Die Buchhändlerlehre hat sie abgebrochen, letzten Sommer ist ihre langjährige Beziehung auseinandergegangen. Am Ende ihrer Tage würde es wenig geben, was sie richtig gemacht hätte. Je mehr sie darüber nachdenkt, desto mehr versteht sie dieses Kalb. Und obwohl es ihr noch immer nicht schmeckt, ist sie froh, es bestellt zu haben.
Goethe (eine Novelle)
Nachdem der Basler Pharmakonzern Novartis Patrick Huber gekündigt hat, haust dieser jahrelang ausgesteuert erst in Muttenz dann in Pratteln und züchtet in der Küche aus dem Genmaterial eines Fingerknöchels den Klon des längst verstorbenen Weltliteraten Johann Wolfgang von Goethe heran. Huber übergibt den Goethe-Klon, den er im umgebauten Backofen bis zum Säuglingsstadium reifen liess, seiner Freundin Flavia Gut, damit sie das Geschöpf wie ihr eigenes Kind aufziehe.
Der Klon erhält den Namen Johann Wolfgang Gut.
Johann überspringt mehrere Klassen, beginnt mit fünfzehn Philosophie, Botanik, Mathematik, englische und deutsche Literatur, Chemie und Physik zu studieren. Seinen ersten Doktortitel erhält er noch vor seinem zwanzigsten Geburtstag. Johann Wolfgang legt sich nicht auf ein Gebiet fest, seine Studien treiben ihn in alle Richtungen. In einem Zeitungsbericht wird er als letzter Universalgelehrter betitelt, bald fällt das Adjektiv: „olympisch.“
Ein brillanter Mensch jedoch auch ein umgänglicher Gesellschafter, ein ästhetischer Wanderer, ein engagierter Politiker und Redner, so sieht man ihn. Johann Wolfgang Gut ist der Mensch der Menschen.
An einem zweiten Dezember, Johann Wolfgang Gut ist vierundzwanzig Jahre alt, schlägt er die Einleitung zu Goethes Farbenlehre auf, die ein Freund ihm anempfohlen hat, obwohl er selbst sie für überholt hält. Er beginnt zu lesen. Johann Wolfgang erkennt in Goethe einen Seelenverwandten. Am nächsten Montag lässt er sich drei Biographien zukommen, eine Woche später kauft er Goethes Werke in hundertdreiundvierzig Bänden. Johann verlässt das Haus nicht mehr, wandert, politisiert, schreibt nicht mehr, Johann hält keine Reden, beantwortet keine Mails, keine Anrufe nimmt er entgegen. Johann Wolfgang Gut liest Goethe.
Jahre vergehen, zusehends verarmt Johann; er zieht nach Pratteln in die Wohnung seines Paten und geheimen Schöpfers Patrick Huber, der mittlerweile eine Professur für Genetik erhalten hat. Johann Wolfgang schläft in der Küche, die überstellt ist von Goethe-Bänden und Kommentaren. Im Alter von zweiunddreissig Jahren stirbt der Goethe-Klon Johann Wolfgang Gut an einem Magengeschwür.
Während er am Küchenboden liegt, schmiegt sich eine Katze an seinen Kopf. „Gewiss weiss ich, Bützi“, sagt er keuchend zum Tier, „ich hätte mehr tun müssen als lesen. Aber jetzt … was mich jetzt plagt, ist nicht, das Neue, das ich nicht gesucht habe, die Taten, die ich nicht vollbracht habe, sondern die Seiten dort auf dem Pult, bei denen ich noch nicht weiss, was darin steht.“ Die Katze leckt ihre Tatzen.

René Frauchiger, geboren 1981 in Madiswil, ist Autor von Kolumnen und Kurzgeschichten, sowie Gründer und Mitherausgeber vom Literaturmagazin «Das Narr» (seit 2011). Heute leitet René Frauchiger den Bereich Werkstätten des Aargauer Literaturhauses und lebt in Basel. Im September 2019 erschien sein erster Roman: «Riesen sind nur grosse Menschen» im homunculus-Verlag, 2022 folgte «Ameisen fällt das Sprechen schwer» bei Knapp.