Alle Jahre wieder im späteren Frühling, ja nicht zu früh, denn das hätte ihm geschadet, trug Gerlinde sorgfältig, beinahe zärtlich, ihren Gartenzwerg ins Freie. Das „Freie“ war ein Stücklein Steingarten vor dem Haus, angrenzend an den Fussweg zum Bahnhof. Nebst Pflanzen die dereinst üppig duften, blühen und sich sanft im Winde wiegen würden, bevölkerte Gerlinde ihr Gärtchen mit Antiquitäten. Ein kleines Steinpferd und der Torso einer Keramikskulptur standen zwischen den Steinen.
„Ach Gerlinde, du hast mir doch schon so manchen Stein in den Garten geworfen, dass ich dir endlich auch einmal etwas schenken möchte“, hatte eine ihrer Freundinnen letzten Sommer gesagt und ihr, sorgfältig in Seidenpapier eingewickelt, einen wunderschönen Gartenzwerg gebracht.
„Er heisst Salomon“, hatte sie schmunzelnd hinzugefügt. „Ich habe ihn in Griechenland gekauft. Mir war sofort klar, dass er in deinen Steingarten gehört.“
Gerlinde kannte viele Leute. Ihr früherer Beruf als Postbotin hatte das mit sich gebracht. Aber auch ihr Wesen. Leutselig, extravertiert, unkompliziert wären passende Bezeichnungen für die umtriebige Mittsechzigerin gewesen. Aber leider auch manchmal etwas zu vertrauensselig und gutgläubig.
Oft war sie unterwegs, um Hilfe jeder Art zu leisten. Sie kochte, kaufte ein für ältere Menschen, schnitt sogar Fingernägel oder verfasste Briefe. Oder sie liess sich begeistern für eine Nistkastenreinigung mit dem ornithologischen Verein.
Von Zeit zu Zeit schloss Gerlinde ihr kleines Haus für ein paar Tage, um auf Wanderungen oder Bergtouren aufzubrechen.
„Das bringt mich oft an meine Grenzen. Aber gerade das ist es, was ich daran so liebe“, pflegte sie zu sagen. Und auch:
„Ich bin halt ein Naturkind.“
Inzwischen hockte Zwerg Salomon einsam zwischen den Steinen, bis Gerlindes Tochter Nadine auf die Idee kam, ihm eine Partnerin zuzugesellen.
„So ist das doch viel besser und schöner. Die Beiden können sich unterhalten und Beobachtungen über die Menschen anstellen, die zum Bahnhof eilen.“
Die traute Zwergenidille dauerte genau zwei Tage, danach waren die Beiden unauffindbar. Gerlinde verstand die Welt nicht mehr. So etwas Unbegreifliches hatte gar keinen Platz in ihrem Welt-und Menschenbild. Sofort wollte sie mit der Suche beginnen. Aber wie und wo? Sie hängte handgeschriebene Zettel auf an manchen Orten im Dorf und war höchst erstaunt und erfreut über deren wundersame Wirkung. Salomon und seine Freundin kamen über Nacht zurück.
Kurz darauf ging es nach dem Schneeballprinzip: nach und nach bevölkerte sich ihr Gärtlein mit ganzen Zwerg-Sippschaften, über deren Herkunft niemand Genaueres wusste. Sie schienen sich wohl zu fühlen und vermehrten sich. Gerlinde war nicht die einzige, die sich darüber freute. Aus ihrem Küchenfenster beobachtete sie gerührt manche Fussgänger, die beglückt oder auch kopfschüttelnd für einen Augenblick stehen blieben.
Dann kam der Tag, an dem die Sache plötzlich eine Eigendynamik annahm und richtig kommerziell wurde.
An diesem nebligen Morgen, es war schon Frühherbst und Gerlinde wollte etwas länger liegen bleiben, schellte das Telefon zu ungewohnt früher Stunde.
„Guten Tag, Gerlinde. Ich bins, Franziska. Wir kennen uns von der Bergwanderung vom vorletzten Sommer. Weißt du noch? Bitte verzeih, dass ich so früh anrufe, aber ich bin in Verlegenheit und vielleicht kannst du mir aus der Patsche helfen.“
„Natürlich gerne, wenn dein Anliegen nicht allzu ausgefallen ist.“
„Doch, leider ist es das und ich traue mich kaum, darüber zu sprechen.“
Nach längerem Drumherum rückte Franziska endlich mit ihrem Anliegen heraus.
„Dürfte ich dir nicht meinen Gartenzwerg in die Ferien geben? Ich verreise für drei Monate. Da stünde er dann so einsam vor dem Haus, dass ich fürchte, er könnte gestohlen werden. Auch wäre er bei dir nicht so allein. Weißt du, seit mein Hund vor zwei Jahren gestorben ist, hängt mein Herz halt an ihm und wenn ich zurück bin hole ich ihn sofort wieder ab. Was sind deine Preise? Ich bezahle gerne auch etwas mehr.“
Gerlinde, schlagfertig und humorvoll erwiderte:
„Natürlich, gerne. Wie heisst er denn und was kriegt er zu essen? Etwa gar eine spezielle Diät?“
„Er heisst Adalbert, das musst du natürlich wissen.“
Das also war die Geburtsstunde von Gerlindes kleinem Nebenerwerb. Am Rand des Steingärtleins, gut sichtbar für die Fussgänger auf dem Weg zum Bahnhof, war seit kurzem eine kleine Holztafel angebracht, deren Inhalt viel heimliches Schmunzeln auslöste und immer weitere neue Kunden brachte. Darauf stand zu lesen:
Ferienheim für Gartenzwerge
Persönliche Betreuung zugesichert
Moderate Preise
Gerlinde hatte nun einen kleinen Kummer. Ob sie wohl die neuen Einnahmen von der Steuer absetzen durfte?
Die Beichte
Müde und mit schmerzenden Füssen von den Strapazen eines langen Stadttages setzte ich mich in die dritte Bankreihe der kleinen Quartierkirche. Es dämmerte früh an diesem Novembertag und schon von weitem waren mir die flackernden Kerzen links und rechts der weit geöffneten Tür aufgefallen, hatten mich angelockt. Ich hatte keine Pause geplant, doch es war Orgelmusik nach daussen gedrungen und hatte mich unwiderstehlich ins Innere gezogen. Da war noch etwas anderes, Mächtigeres gewesen: Weihrauch, Duft aus ferner Kinderzeit. Warm, vertraut, geheimnisvoll.
Dieser Duft hatte mit Leichtigkeit Jahrzehnte übersprungen und klar und deutlich hörte ich wieder Mutters Stimme, die mir am freien Mittwochnachmittag schon von weitem zugerufen hatte:
„Gut, dass du schon daheim bist. Dein Obermini hat angerufen. Du sollst um halb zwei Uhr in der Kirche sein. Es sei wichtig.“
„Dass ich jetzt nicht mit meinen Freundinnen aufs Eis kann, stört mich nicht, meine alten Schlittschuhe sind mir eh zu klein und drücken mir die Zehen ab.“
Ein Jahr zuvor war ich den Ministranten beigetreten. An der Weihnachtsfeier in unserer Kirchgemeinde war der Wunsch dabei zu sein, erwacht.
Eingekleidet in ein langes weisses Gewand, vorne am Altar stehen oder knien, dem Priester im richtigen Moment bringen, was er gerade benötigt, in die geheimnisvolle Sakristei eintreten und, vor allem, das Weihrauchgefäss schwenken dürfen. Das alles war überaus verlockend gewesen. Doch den Ausschlag gegeben hatte der Weihrauch, dieser unbeschreibliche Duft mit seiner wohligen Wärme und Geborgenheit. Deshalb gehörte ich seit dem Frühling zu den Minis, einer Gruppe von Kindern, die sich auch ausserhalb der Gottesdienste zu allerlei Freizeitaktivitäten trafen, Unterricht erhielten und lernten, was während des Gottesdienstes zu tun war. Wann stehen, wann knieen, wann kommen und wann gehen. Dabei vom Kirchenvolk geschätzt und geliebt zu werden.
Mutter war stolz auf mich.
Seither betrachte ich mit besonderem Interesse die Weihrauchgefässe, diese kunstvoll gearbeiteten Schmuckstücke, wann und wo immer ich sie erblicke.
Seither?
Es gab auch Aufgaben für uns Minis, die in aller Stille getan werden mussten. Zum Beispiel abwechslungsweise am freien Nachmittag in der spärlich besuchten Kirche die unzähligen Kerzenständer auf dem Altar und zu Füssen der Heiligen vom Wachs befreien und neue Kerzen einsetzen. Diese Aufgabe gefiel mir besonders gut, denn der Weihrauch, der noch seit der Elf-Uhr-Messe über unseren Köpfen waberte, beglückte mich auf unerklärliche Weise. Ich holte die schweren schön dekorierten und leise duftenden Kerzen aus dem Schrank in der Sakristei und begann sie zu verteilen. Manchmal musste ich eine kleine Leiter zu Hilfe nehmen, wenn die Heiligen auf ihren Gipspodesten für die kleine Person, die ich damals war, zu hoch oben standen. Ich staunte, wie viele dieser Statuen an den unterschiedlichtsten Orten im grossen Kirchenraum verteilt waren, und bald wurde ich mit ihnen vertraut wie mit Freunden, mit denen ich mich unterhalten konnte. Anfangs nur zögerlich, doch bald bildete ich mir ein, Antworten zu erhalten, und ich begann Fragen zu stellen und mein Herz zu öffnen. Die Stunden in der meist leeren Kirche wurden mir unentbehrlich.
Nicht immer war ich allein. Der Priester war nach kurzem freundlichem Gruß in meine Richtung in seinem Beichtstuhl verschwunden und bereit, den wartenden Gläubigen die Beichte abzunehmen. Aus dem Unterricht wusste ich darüber Bescheid und fühlte mich nicht gestört. Ich beobachtete Menschen, die erregt flüsterten, sich Tränen abwischten und leise, wie sie gekommen waren, wieder verschwanden. Ich verstand ihre Worte nicht, sollte ich auch nicht, spürte aber meist eine gewisse beklommene Atmosphäre und war froh, wieder allein zu sein wenn die Letzten gegangen waren.
Ein Mann mittleren Alters kam öfter. Er dämpfte seine Stimme nicht, schrie sogar manchmal und fluchte, so dass ich mich ängstlich hinter einen der Heiligen flüchtete, mir die Ohren zuhielt und mich bemühte, seine Worte nicht zu verstehen. Denn das wäre Sünde gewesen. Was konnte ich aber dafür, dass ich Dienst hatte, er immer lauter redete, so dass ich schliesslich einzelne Wortfetzen verstand und damit seine düstere Geschichte zu ahnen begann. Worte wie: „nicht zurückhalten“ „immer wieder“ schälten sich heraus. Der Mann faszinierte und verängstige mich zugleich, doch mit der Zeit begann ich absichtlich zu lauschen und konnte nicht mehr aufhören damit. Was ich da hörte, senkte sich als eine Last auf mich, die schwerer und drückender wurde, je öfter ich seiner Beichte zuhörte. Ich war seiner Geschichte verfallen, steckte in der Falle, durfte ich doch mit niemandem über mein Geheimnis sprechen. Auch nicht mit meinen vertrauten Gipsheiligen, die sicher verschwiegen gewesen wären.
Dieses Erlebnis ging nicht spurlos an mir vorbei. Ich wurde immer stiller, bleicher und bald richtig krank. Die Haare fielen mir büschelweise aus und ich wurde schwach, konnte kaum noch stehen und gehen. Keines der mütterlich-kummervoll zubereiteten Süppchen schmeckte mir und ich fror erbärmlich. Mutter holte Ärzte, einen nach dem andern, die mir alle nicht helfen konnten. Ich verlor Gewicht. Natürlich wusste ich selber genau was mir fehlte, musste aber die schreckliche Geschichte für mich behalten. Ein Teufelskreis hatte begonnen und sich über zwei lange Jahre hingezogen.
All das war mir an jenem Novemberabend, durch den Duft des Weihrauchs, so klar wieder vor Augen gekommen, als ob es gestern gewesen wäre.
In meiner Oase der Besinnlichkeit und des Innehaltens, war es plötzlich laut geworden. Es hatten Vorbereitungen einer Gruppe von Musikanten begonnen, die ein Musical einübten für den Weihnachtsabend. Noch etwas chaotisch, doch es blieb ihnen ja noch viel Zeit bis zur Aufführung. Die vertrauten Melodien hatten meine Blockflöte von damals hervor gezaubert, und ich merkte belustigt, wie meine Finger begannen, die imaginären Löcher abzudecken und die Melodien mitzuspielen.
Mit der Stille war es endgültig vorbei, aber Irgendwann, erinnerte ich mich, hielt das kranke Kind dem Druck nicht länger Stand, und ich weihte meine Mutter ein. Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben, doch schliesslich gab sie mir den erlösenden Rat:
„Du musst zur Beichte gehen, so rasch als möglich.“
Ein väterlicher Seelsorger nahm mir die Beichte ab. Lange hatte er zugehört, ohne mich zu unterbrechen.
Verena Uetz-Manser ist Musikpädagogin, Familienfrau und Grossmutter. Als Tochter von Gretel Manser-Kupp, Kinderbuchautorin, begann sie schon früh gerne zu schrieben, erst spät auch Gedichte. Verena Uetz-Manser ist Mitglied von femscript.ch und als solche nimmt sie teil am Schreibtisch Winterthur. Veröffentlicht wurde in einer Publikation aus dem Kameru-Verlag: ‹dreiundsechzig›, sporadisch auch in Zeitschriften.



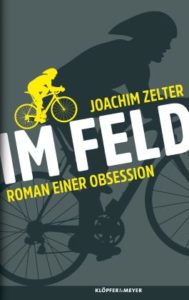 die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).
die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).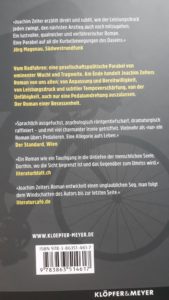
 Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).
Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).
 Ewigkeit vor der Eisdiele warten. Genügend Zeit, um beim Missachteten alle Dämme brechen zu lassen, erst recht als das Ding hinter der Eisdiele auch noch korrigiert. Es bricht aus Avischai Milner heraus, eine Kasskade verbaler Hässlichkeiten, deren Wirkungen unabsehbar werden. Ein Schrei Nuphars und alles läuft zusammen. Eine einzige Frage an das Mädchen mit den verquollenen Augen und Avischai Milner steht unter Verdacht, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. In einem einzigen Moment richtet sich die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation, des Kollektivs auf den Schrecken eines Mädchens, um den im gleichen Moment Verurteilten ohne ein rechtskräftiges Urteil mit Schimpf und Schande zu bestrafen.
Ewigkeit vor der Eisdiele warten. Genügend Zeit, um beim Missachteten alle Dämme brechen zu lassen, erst recht als das Ding hinter der Eisdiele auch noch korrigiert. Es bricht aus Avischai Milner heraus, eine Kasskade verbaler Hässlichkeiten, deren Wirkungen unabsehbar werden. Ein Schrei Nuphars und alles läuft zusammen. Eine einzige Frage an das Mädchen mit den verquollenen Augen und Avischai Milner steht unter Verdacht, sich an dem Mädchen vergangen zu haben. In einem einzigen Moment richtet sich die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation, des Kollektivs auf den Schrecken eines Mädchens, um den im gleichen Moment Verurteilten ohne ein rechtskräftiges Urteil mit Schimpf und Schande zu bestrafen. Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, lebt und arbeitet als Autorin und Psychologin in Tel Aviv. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman, »Eine Nacht, Markowitz« (2013), dem der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt Israels zugesprochen wurde, wird derzeit von der BBC verfilmt.
Ayelet Gundar-Goshen, geboren 1982, lebt und arbeitet als Autorin und Psychologin in Tel Aviv. Für ihre Kurzgeschichten, Drehbücher und Kurzfilme wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet. Ihr erster Roman, »Eine Nacht, Markowitz« (2013), dem der renommierte Sapir-Preis für das beste Debüt Israels zugesprochen wurde, wird derzeit von der BBC verfilmt.
 erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät.
erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät. Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.
Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.
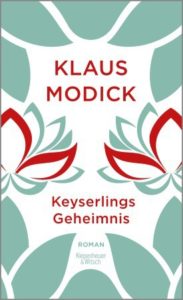 schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.
schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.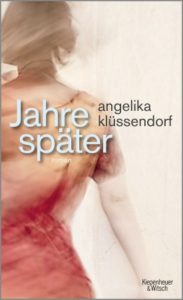 aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!
aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!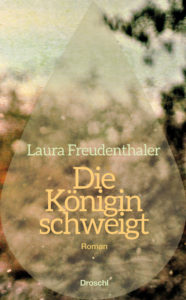 Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!
Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!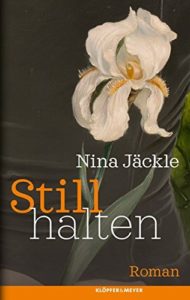 vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
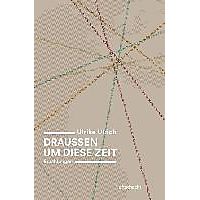 Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt und arbeitet seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien im Luftschlacht Verlag ihr Debütroman «fern bleiben», dem im März 2013 der zweite Roman „Hinter den Augen“ folgte. 2015 erschien ebendort ihr erster Erzählband «Draussen um diese Zeit».
Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt und arbeitet seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien im Luftschlacht Verlag ihr Debütroman «fern bleiben», dem im März 2013 der zweite Roman „Hinter den Augen“ folgte. 2015 erschien ebendort ihr erster Erzählband «Draussen um diese Zeit».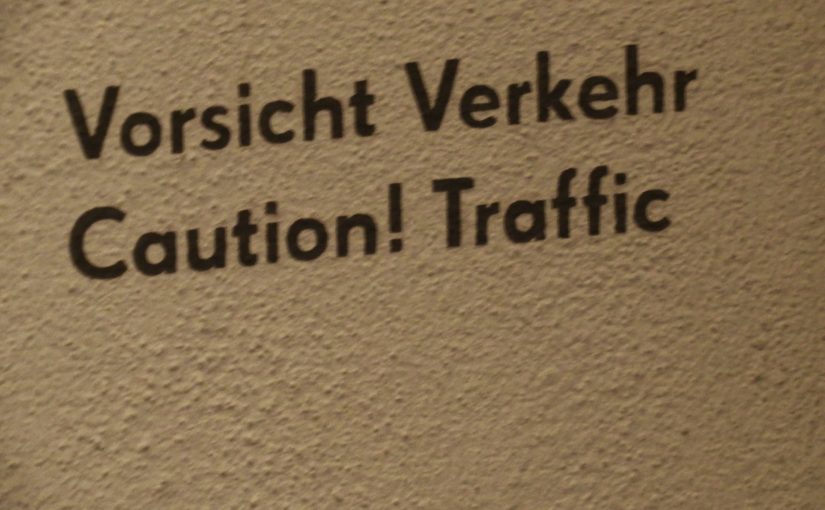
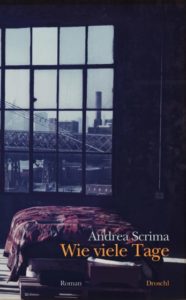 «Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung.
«Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung. Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.
Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.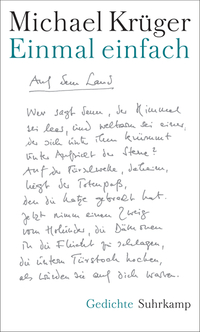
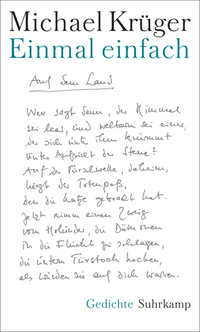
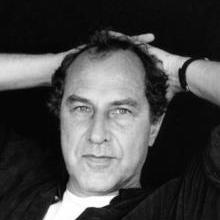 Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler- und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen hat. Seit 1981 ist er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.
Michael Krüger wurde am 9. Dezember 1943 in Wittgendorf/Kreis Zeitz geboren. Nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium absolvierte er eine Verlagsbuchhändler- und Buchdruckerlehre. Daneben besuchte er Veranstaltungen der Philosophischen Fakultät als Gasthörer an der Freien Universität Berlin. In den Jahren von 1962-1965 lebte Michael Krüger als Buchhändler in London. 1966 begann seine Tätigkeit als Literaturkritiker. Zwei Jahre später, 1968, übernahm er die Aufgabe des Verlagslektors im Carl Hanser Verlag, dessen Leitung er im Jahre 1986 übernommen hat. Seit 1981 ist er Herausgeber der Literaturzeitschrift Akzente.
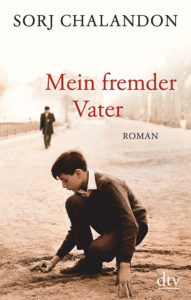 wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden.
wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden. Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.
Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.
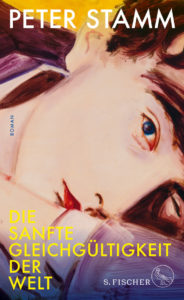 die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.
die sich immer deutlicher mit der gegenwärtigen Geschichte mit ihrem Freund zu decken scheint. Christoph hatte damals, als er Magdalena verlor und mit ihr eine gemeinsame Zukunft, endlich den Stoff für seinen Roman gefunden. Den einzigen, den er je geschrieben hatte und der mit zunehmender Zeit immer mehr zur Ahnung werden sollte. So wie ihm Magdalena entglitt, tat es auch das Schreiben, selbst als er sich mit allem Elan auf die Suche nach Inspiration machte, für Jahre weg aus seinem gewohnten Umfeld zog, sich unsichtbar machte. Um im anderen Leben festzustellen, dass man nicht vorkommt, nicht einmal mehr seine eigenen Spuren, erst recht nicht das Buch, das man einst geschrieben und verkauft hatte, sichtbar bleiben.