Ein junger Übersetzer soll in Venedig das sichten, was eine gefeierte, alt gewordene Übersetzerin zurückgelassen hat. Er bricht auf in eine Stadt, die sich nicht nur dem Wasser ergeben muss, in eine Wohnung, die dem Verlassen preisgegeben, in ein Leben, das abgebrochen ist. Bruno Pellegrinos stimmungsvoller Roman ist für einmal keine Liebesode an eine sterbende Stadt, sondern ein Mahnmal der Vergänglichkeit.
Sonst reist man in die Stadt im Wasser, um sich von Kulisse umgeben, um sich von Geschichte und Kunst betören oder dem langen Schweif vieler Erzählungen einlullen zu lassen. Aber der junge Mann reist nicht in die Lagunenstadt, um sich ihrem Charme zu ergeben. Eine Stiftung schickt ihn, weil eine hoch angesehene Übersetzerin mitten aus ihrem Leben gerissen wurde und die Institution sicherstellen will, dass nichts von Bedeutung mit einem Mal verloren sein könnte. Er reist in die Stadt, in die Wohnung einer Frau, die der Wahn aus einem Leben gerissen hatte, das ganz der Sprache, der Übersetzung gewidmet war.

Stellen sie sich vor, sie öffnen die Tür zu einer Wohnung, die während Jahrzehnten das Refugium einer Frau war, die ganz offensichtlich nur für sich und die Sprache lebte. In den Lebensraum einer Frau, die den Koffer gepackt hatte, um in ihre Heimatstadt zu fahren, in der man sie für ihr Lebenswerk auszeichnen wollte, die die Reise aber nie angetreten hatte. Die stattdessen in ihrem Wahn in einer Klinik vor der Stadt eingewiesen wurde, ganz offensichtlich nicht in der Hoffnung, je in ihr altes Leben zurückkehren zu können.
Ein junger Mann ganz am Anfang seiner Karriere als Übersetzer im Gemäuer einer Frau, die in ihrem Beruf alles erreicht, sich als Mensch aber in der Einsamkeit verloren hatte. Er dringt ein. Er ordnet und katalogisiert, was an Schriftstücken wild durcheinander einen Kosmos ausmacht, den er selbst nicht durchdringen kann. Er spürt einem Leben nach, das noch nicht erloschen ist, aber wegtauchte in einen Wahn, von dem es kein Zurück zu geben scheint.
Man quartiert ihn in einem Studentenheim ein, gibt ihm die Schlüssel zur Wohnung der Übersetzerin mit und alle Zeit der Welt, um festzuhalten, was Zeit und Feuchtigkeit in jenem Zuhause in der Lagunenstadt bedrohen. Aber das Wasser nährt nicht nur das Papier, das sich in der Feuchtigkeit wellt. In den Wintermonaten drohen die Fluten einmal mehr, die Lagunenstadt, die mit stoischer Gelassenheit auf die immer wiederkehrende Bedrohung reagiert, einzunehmen. Eine Situation, die den jungen Mann verunsichert und bedroht, die ihn ängstigt und in stille Panik versetzt. Hier die Frage, wer die Frau war, in deren Wohnung er die Schlüssel für ein Leben sucht, dort die Bedrohung durch das Wasser, das sich in alles hineinzufressen scheint. Ein zurückgelassenes Leben, in dem seine Grossmutter zuhause zu sterben droht, er in einer Stadt, die dem Untergang geweiht ist.
Bruno Pellegrinos Roman „Stadt auf Zeit“ ist ein Buch über Vergänglichkeit. Für einmal kein Buch, das die Schönheit der Lagunenstadt besingt, sie zu einer Kulisse der Leidenschaft macht. Die Stadt stirbt. Das Wasser ist überall. Sie saugt sie in sich auf, wie ein fauliger Schwamm. Was der Mensch macht, ist dem Zerfall preisgegeben, selbst mit dem matten Versuch, dem Sterben Einhalt zu gebieten. „Stadt auf Zeit“ ist weder melodramatisch noch in irgend einer Weise romantisierend. Es ist ein Stück Totengesang. Noch viel mehr, weil die Übersetzerin, die ein Leben lang die Schlüssel zur Sprache suchte, vom Wahn dahingerafft wurde. Ein Roman voller Metaphern und feuchtdunklen Tiefen.
Bruno Pellegrino, geboren 1988, lebt in Lausanne und Berlin. Er studierte Literaturwissenschaften, veröffentlichte zahlreiche Texte in Literaturzeitschriften. Für seine Novelle «L’idiot du village» (2011) wurde er mit dem Prix du jeune écrivain ausgezeichnet. Pellegrino ist Mitbegründer von AJAR, einer Gruppe junger Autorinnen und Autoren in der Romandie. «Atlas Hotel» ist sein erster Roman (auf Deutsch erschienen im Rotpunktverlag). «Là-bas, août est un mois d’automne» erschien bei Zoé und wurde unter anderem mit dem Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne und dem Prix Alice Rivaz ausgezeichnet; unter dem Titel «Wo der August ein Herbstmonat ist» wurde es, übersetzt von Lydia Dimitrow, 2021 im verlag die brotsuppe veröffentlicht.
Lydia Dimitrow, geboren 1989 in Berlin, studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin und Lausanne. Sie ist Autorin von Theatertexten und Prosastücken (u.a. erhält sie 2023 eins der Berliner Arbeitsstipendien für Literatur in deutscher Sprache, vergeben von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa) und arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen und dem Französischen (u.a. Isabelle Flükiger, Jamey Bradbury, Pascal Janovjak, Bruno Pellegrino und jetzt Antoinette Rychner). Ausserdem ist sie Gründungsmitglied der Theaterkompanie mikro-kit.
Beitragsbild © Éditions Zoé, Romain Guélat





 Es war das Jahr der Unfälle. Danach hiess es amigs, wir lebten halt hier unten im Bermudadreieck. Wobei, im Bermudadreieck wird spurlos verschwunden.
Es war das Jahr der Unfälle. Danach hiess es amigs, wir lebten halt hier unten im Bermudadreieck. Wobei, im Bermudadreieck wird spurlos verschwunden. Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.
Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue». 2021 gewann Christoph Schneeberger den Schweizer Literaturpreis.
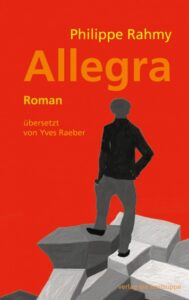

 2018 und 2019 verbrachte Johanna Lier mehrere Monate in Griechenland und auf der Insel Lesbos und kam eher zufällig ins Registrierung- und Ausschaffungszentrum Moria. Eine Gewalterfahrung, die eine Antwort erforderte. Die Autorin kehrte nach Moria Camp zurück und begann, basierend auf Kriterien aus James Baldwins Essay «Everybodys Protest Novel», zu recherchieren und zu schreiben.
2018 und 2019 verbrachte Johanna Lier mehrere Monate in Griechenland und auf der Insel Lesbos und kam eher zufällig ins Registrierung- und Ausschaffungszentrum Moria. Eine Gewalterfahrung, die eine Antwort erforderte. Die Autorin kehrte nach Moria Camp zurück und begann, basierend auf Kriterien aus James Baldwins Essay «Everybodys Protest Novel», zu recherchieren und zu schreiben.


 Weil ihn die Bilder aus jener Zeit auch im Alter nicht loslassen. Weil er nie aus seinem Schweigen herausfand. So wie ihn die Schicksale der verstorbenen Kinder nicht loslassen, die Geschichten, die er sich zusammenreimt, die den Kindern eine Vergangenheit schenken, die erklärbar machen, warum man sie auf dem Friedhof vergessen hat. Er macht seinen Kindern Geschenke, bemüht sich viel mehr als nur um die Bepflanzung, das Kreuz, den Grabstein und den Weg dorthin. Er gibt den Kindern Namen; Primel, Forsythie, Hyazinthe, Pfingstrose oder Anemone. Er redet zu ihnen, leistet ihnen Gesellschaft, ist ihnen Behüter und Vater.
Weil ihn die Bilder aus jener Zeit auch im Alter nicht loslassen. Weil er nie aus seinem Schweigen herausfand. So wie ihn die Schicksale der verstorbenen Kinder nicht loslassen, die Geschichten, die er sich zusammenreimt, die den Kindern eine Vergangenheit schenken, die erklärbar machen, warum man sie auf dem Friedhof vergessen hat. Er macht seinen Kindern Geschenke, bemüht sich viel mehr als nur um die Bepflanzung, das Kreuz, den Grabstein und den Weg dorthin. Er gibt den Kindern Namen; Primel, Forsythie, Hyazinthe, Pfingstrose oder Anemone. Er redet zu ihnen, leistet ihnen Gesellschaft, ist ihnen Behüter und Vater.
 Immer und immer wieder dreht sich Literatur um Erinnerungen. Literatur ist die Kunst des Erinnerns, sei es im Zusammenhang mit Historie oder um das, was man in sich trägt, eingegraben bis in die Gene. Historisches Erinnern, das sich unweigerlich und gleichermassen mit Deutung und Wertung verbindet, ist wie persönliche, individuelle Erinnerung Motor des Tuns und Denkens. Literatur, selbst wenn sie sich oberflächlich betrachtet mit Gegenwart oder Zukunft beschäftigt, ist immer transformierte Erinnerung. Und wenn sich Aleida und Jan Assmann, gemeinsam Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, in Leukerbad mit ihrem Schreiben vorstellen, dann gleich mehrfach und ineinander verwoben. Über ihre Forschungen zum Thema „Kollektives Gedächtnis“ wird in verschiedenen Gesprächsformationen diskutiert und schnell klar, dass sich Literatur nicht nur mit Erinnerung befasst, sondern mit ihrem Niederschlag ganz deutlich zu „kollektiven Erinnerung“ beiträgt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine kollektive Erinnerung, die in eine ganze Generation wirkt.
Immer und immer wieder dreht sich Literatur um Erinnerungen. Literatur ist die Kunst des Erinnerns, sei es im Zusammenhang mit Historie oder um das, was man in sich trägt, eingegraben bis in die Gene. Historisches Erinnern, das sich unweigerlich und gleichermassen mit Deutung und Wertung verbindet, ist wie persönliche, individuelle Erinnerung Motor des Tuns und Denkens. Literatur, selbst wenn sie sich oberflächlich betrachtet mit Gegenwart oder Zukunft beschäftigt, ist immer transformierte Erinnerung. Und wenn sich Aleida und Jan Assmann, gemeinsam Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, in Leukerbad mit ihrem Schreiben vorstellen, dann gleich mehrfach und ineinander verwoben. Über ihre Forschungen zum Thema „Kollektives Gedächtnis“ wird in verschiedenen Gesprächsformationen diskutiert und schnell klar, dass sich Literatur nicht nur mit Erinnerung befasst, sondern mit ihrem Niederschlag ganz deutlich zu „kollektiven Erinnerung“ beiträgt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Eine kollektive Erinnerung, die in eine ganze Generation wirkt.
 Zoltán Danyi las in Leukerbad aus seinem bei Suhrkamp erschienenen ersten Roman „Der Kadaverräumer“. Der Erzähler wird in der Vojvodina in die serbische Armee eingezogen und Augenzeuge kriegerischer Gräuel, wird nach dem Krieg „Kadaverräumer“, der tote Tiere von den Strassenrändern zu sammeln hat, wird Schmuggler, Flüchtling, unglücklich Liebender, Leidender an seinem Körper. Ein Mann, der nicht verdauen kann. „Der Kadaverräumer“ ist aber nicht einfach nacherzählte Erinnerung, sondern in langen mäandernden Sätzen ein in sieben Klagelieder gefasster Gedankenstrom. Er erschliesst sich mir als Leser nicht so einfach, da die Schichten des Fliessens vielfach sind, starke Bildern und Sätze zeigen, was der Wahnsinn eines Krieges und dessen Folgen in einem Menschen für Katastrophen anrichten können, auch dann, wenn die offensichtliche Aggression längst Erinnerung ist.
Zoltán Danyi las in Leukerbad aus seinem bei Suhrkamp erschienenen ersten Roman „Der Kadaverräumer“. Der Erzähler wird in der Vojvodina in die serbische Armee eingezogen und Augenzeuge kriegerischer Gräuel, wird nach dem Krieg „Kadaverräumer“, der tote Tiere von den Strassenrändern zu sammeln hat, wird Schmuggler, Flüchtling, unglücklich Liebender, Leidender an seinem Körper. Ein Mann, der nicht verdauen kann. „Der Kadaverräumer“ ist aber nicht einfach nacherzählte Erinnerung, sondern in langen mäandernden Sätzen ein in sieben Klagelieder gefasster Gedankenstrom. Er erschliesst sich mir als Leser nicht so einfach, da die Schichten des Fliessens vielfach sind, starke Bildern und Sätze zeigen, was der Wahnsinn eines Krieges und dessen Folgen in einem Menschen für Katastrophen anrichten können, auch dann, wenn die offensichtliche Aggression längst Erinnerung ist.
 erschienenen Roman „Wie die Milch aus dem Schaf kommt“ macht sich die Erzählerin und Protagonistin Selma auf die Suche nach ihrer Herkunft. Nach dem Tod ihrer Grossmutter findet Selma unerwartet in einer Tupperware-Box Papiere und Hinterlassenschaften, die klar machen, dass nichts so ist, wie es schien. Selma macht sich auf eine lange Reise, sowohl zeitlich wie geographisch, weit zurück ins 19. Jahrhundert, tief hinein in die bäuerliche Welt des thurgauischen Donzhausen, weit weg bis in die Ukraine und nach Israel.
erschienenen Roman „Wie die Milch aus dem Schaf kommt“ macht sich die Erzählerin und Protagonistin Selma auf die Suche nach ihrer Herkunft. Nach dem Tod ihrer Grossmutter findet Selma unerwartet in einer Tupperware-Box Papiere und Hinterlassenschaften, die klar machen, dass nichts so ist, wie es schien. Selma macht sich auf eine lange Reise, sowohl zeitlich wie geographisch, weit zurück ins 19. Jahrhundert, tief hinein in die bäuerliche Welt des thurgauischen Donzhausen, weit weg bis in die Ukraine und nach Israel.