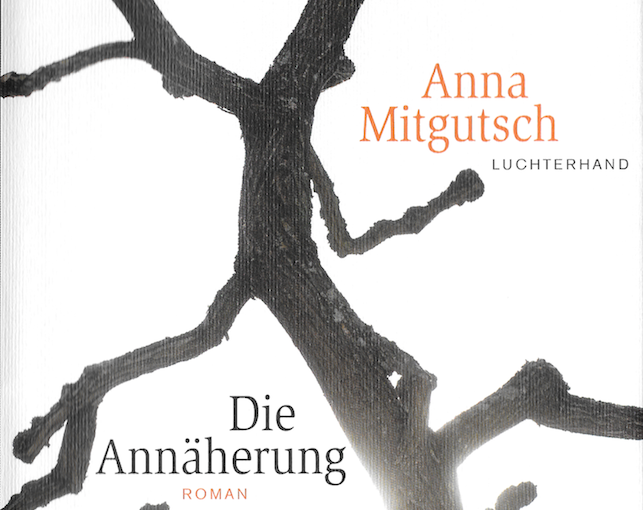Drei Frauen und ein Mann, alle im Herbst ihres Lebens, alle von der Geschichte und ihrer Geschichte an einen Ort gedrängt, der nicht jener sein soll, an dem es enden darf. Kerstin Hensels neue Novelle „Regenscheins Farben“ erzählt von der Kunst; der Kunst der Malerei, der Kunst der Selbstbefreiung, der Kunst, das Glück nicht bloss zu suchen, sondern es notfalls beidhändig zu greifen.
„Regenbein Hühnerklein! Regenbein, was soll das sein!“, ruft man der kleinen Karline schon im Mädchenalter in der Schule hinterher, weil sie anders ist, als alle andern. Vielleicht, weil sie schon anders riecht, weil Hanne Regenbein, Karolines Mutter in der Post arbeitet und dort Mehlkleister, Büroleim und Knochenleim herumsteht. Weil Vater Karl Walzenfahrer im Strassenbau ist und Karline neben Mutters Ingredienzien auch jene des Vaters dem Mädchen zum Malen und Zeichnen zur Verfügung stehen: Teer, Bitumen und Flüssigbeton. Karline beginnt bei der Post zu arbeiten, liebt aber nur die Malerei, malt im Verborgenen, erliegt ihrer unbändigen Lust, den Pinsel zu führen, auch wenn man ihr zu verstehen gibt, dass ihre Art des Malens nicht den Sehgewohnheiten der Gegenwart entspricht.
Sie haust in einer Mansarde, weit oben, auf das Mindeste reduziert. Bis fünf Jahre nach der Wende der Fotograf Rüdiger Habich zur ihr hinaufsteigt mit Fotoapparat und Stativ und in einem letzten, überschäumenden Energieanfall von der unbekannten Künstlerin eine Porträtreihe schiesst, die in der angesagten Galerie Wettengel gefeiert wird. Seine letzte Arbeit, denn abgehängt und frustriert von der digitalen Revolution in der Fotografie packt Habich seine Apparate in den Keller, um sich künftig ganz im Schatten Karlines auszuruhen.
Karline malt weiter, auch wenn ihr Mann Rüdiger immer mehr nur noch ein Schatten seiner selbst, zum Klotz wird, zum eifersüchtigen Hüter ihres kleinen Lebens. Und weil Rüdiger sich selbst noch einmal ins Lebenszentrum seiner malenden Frau rücken will, soll vor seinem absehbaren Ableben noch einmal eine Porträtreihe entstehen, diesmal aber mit seinem Konterfei. Rüdiger stirbt. Karline trägt die Bilder in den Keller, den Mann auf den Friedhof. Es hat fast fünfzig Jahre gedauert, bis Karline ihre ersten Schritte in echte Freiheit unternimmt, wenn auch zaghaft und nicht ohne Hilfe und der stillen Drohung, selbst aus dem Grab: „Ich weiss, wo du bist.“
Aber Karlines Leben ist mit dem Tod ihres tyrannischen Gatten alles andere als vorbei. Auf dem Friedhof, dessen Grabesruhe immer wieder vom lauten Dröhnen startender Flugzeuge zerrissen wird, lernt sie Lore Müller-Killian, eine gestelzte Industriellenwitwe mit Hang zum Theatralischen, kennen und die 80jährige Kunstprofessorin Zita Schlott. Sie alle hegen und pflegen die Gräber ihrer verstorbenen Ehemänner, jede auf ihre Art, die einen mit Hacke und Erde, die andere mit Kühltasche, Kristallkelch und Piccolo.
Und alle drei schauen sie auf den grossen alten Mann mit Hakennase und tadellosem Auftritt. Auf den Galeristen Wettengel, selbst Witwer geworden, seit Jahrzehnten verzahnt mit den Biographien der drei Frauen.

Kerstin Hensel erzählt die Geschichten des illustren Quartetts, wie die drei Frauen um die Gunst von Eduard Wettengel buhlen: Karline in der Hoffnung, endlich jenen Förderer ihrer Kunst zu finden, der sie an der Hand nimmt, raus aus ihrer Isolation, Zita in der Hoffnung, ihren einstigen Musterstudenten zurückzugewinnen und Lore jenen feurigen Verehrer, den sie sich in der leer und öde gewordenen Villa am See wünscht. Kerstin Hensel tut dies, ohne je in Oberflächlichkeiten abzurutschen, stets mit dem Auge der exzellenten Beobachterin und witzigen Erzählerin. Kerstin Hensel beschreibt Beziehungen, enttarnt das feine Geflecht, das sich je nach Wetterlage zu drehen vermag oder gar kippen kann.
Grossartig und gekonnt, ohne je mit einem Satz dem Palaver zu verfallen, überraschend konstruiert und mit einer Leichtigkeit erzählt, die ihresgleichen sucht. Viel mehr als bloss Unterhaltung!
Interview mit Kerstin Hensel:
Wenn Sie beschreiben, wie Karline, die Malerin, den Pinsel führt, dann ist es, als nähmen Sie mich bei der Hand, und liessen mich malen. Ich rieche die Farbe, spüre den Zug. Malen Sie selbst oder ist es tatsächlich möglich, sich durch Imagination so sehr in ein „fremdes Tun“ hineinzuversetzen?
Ich male selbst nicht, habe auch nicht die geringste Begabung dafür. Ich denke, ein Schriftsteller muss in der Lage sein, sich in eine andere (auch ihm fremde) Welt hineinzuversetzen, so dass diese für den Leser sinnlich nachvollziehbar ist. Dazu gehört: Neugierde, Lust, Begeisterung, Erfahrung und natürlich die Beherrschung des Schreib-Handwerkes. Der Rest ist Geheimnis.
Karline Regenbein ist eine ganz eigenwillige Malerin, die sich nicht um den Mainstream kümmert. Gab es eine Künstlerin, einen Künstler, die oder der ihnen als Inspiration diente?
Das ganze Leben dient mir als «Inspiration». Alle meine Figuren sind gleichermassen erfunden, wie auch der Realität verhaftet. D.h. keine Figur ist «authentisch» oder gar entschlüsselbar, dennoch – hoffe ich – sind sie dem Leser bekannt.
Eigentlich ist ihre Novelle auch ein Wendenovelle, in der zwar Deutschlands Wende nur an den veränderten Lebensumständen der Protagonisten abzulesen ist, die aber grosse Wenden schildert, Wendungen, die überraschen und nie ins Klischierte abrutschen. Das gibt der Novelle seine erstaunliche Leichtigkeit. War da nie die Versuchung, ins Epische abzutauchen?
Auch eine Novelle gehört zur Epik, d.h. es wird erzählt, nur nicht so allumfassend bzw. kleinteilig wie es Romanen vorbehalten ist. Jeder Satz ist bei mir harte Arbeit. Der Leser darf dem Text diese harte Arbeit nur nicht anmerken. (Sie sagen es: Leichtigkeit!) 😉
In einem Gespräch zwischen dem Galeristen Wettengel und der Malerin Karline Regenbein verabschiedet sich dieser mit dem Satz „Bleiben Sie bei sich.“. Ein Satz, den die Malerin nicht verstehen kann. Ein Satz, der doch eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was der Malerin fast die ganze Novelle lang nicht gelingt; der Ausbruch. Ist das eigene Selbst nicht das grösste Gefängnis?
Gute Frage. Das eigene ICH kann sehr wohl ein Gefängnis sein, wenn es sich nur aus sich selbst nährt. Das gilt nicht nur für Künstler. Wenn das ICH an Erfahrungen, Gefühlen, Wissen u.s.w. reich ist, kann es strahlen und viel von sich hermachen. Ist das jedoch nicht der Fall, gerät es zur billigen/tragischen/narzistischen Ego-Show, aus der man schwer herausfindet. Andererseits: wer nicht «bei sich bleiben» kann, Angst vor dem ICH, den eigenen Abgründen und Fähigkeiten hat; wer sich nur dem Zeitgeist und dem Erfolg andient, endet ebenfalls im Leeren (in der Eitelkeit). Die Figur Regenbein reflektiert allerdings nicht auf dieser Ebene, sondern stellt ihre Lebensfragen in ihrer Kunst.
Jede der Geschichten der vier Protagonistinnen wäre Stoff für einen Roman gewesen. Vieles deuten Sie nur an, zeichnen durchscheinend und trotzdem scheint sich das Bild in Cinemascope vor mir zu entfalten. Gibt es Maximen, Regeln, Eigenheiten Ihres Schreibens, denen sie sich strickt unterwerfen?
Der «dichte» Text, d.h. die durch blosse Andeutung entstehenden Bilder (wie im guten Kino, ja!) muss Raum lassen für Fantasie und Assoziation, die jeder Leser mit eigener Erfahrung füllen kann. Allerdings ist auch dieses Mittel eine Frage des Masses, also der Fähigkeit, die Spannung genau auszutarieren.
Kerstin Hensel wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren. Sie studierte am Institut für Literatur in Leipzig und unterrichtet heute an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Bei Luchterhand sind zuletzt erschienen: die Liebesnovellen «Federspiel» der Band «Das verspielte Papier – über starke, schwache und vollkommen misslungene Gedichte» sowie der Lyrikband «Schleuderfigur». Kerstin Hensel lebt in Berlin.
Beitragsbild © Susanne Schleyer / autorenarchiv.de



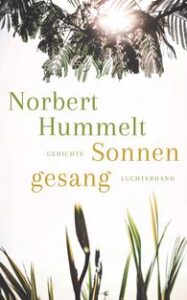


 grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.
grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.
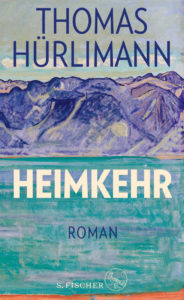 Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!
Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!

 Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.
Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.
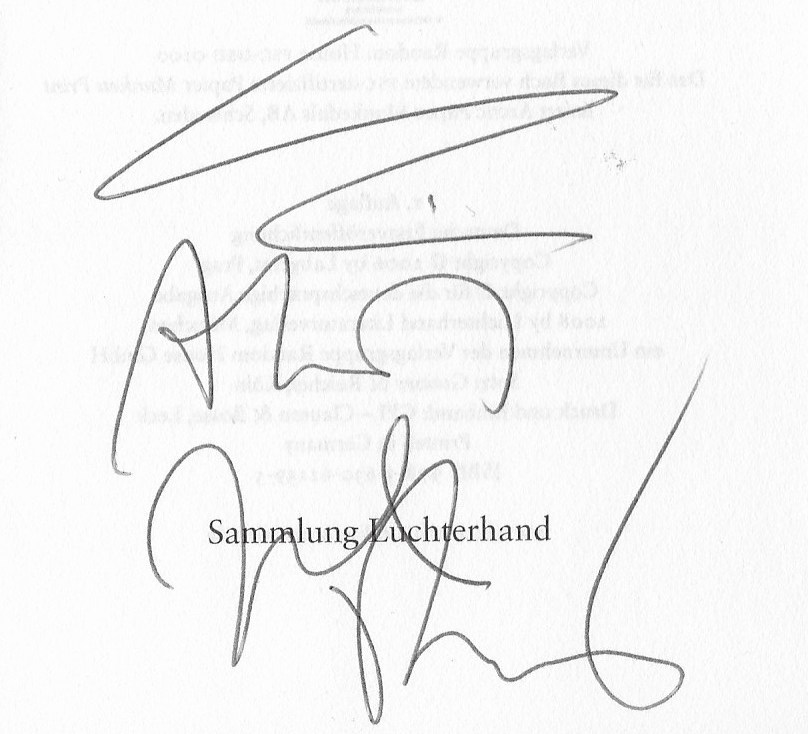

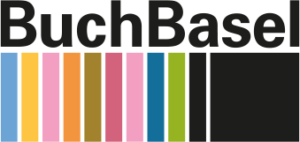 Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam.
Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam. Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.
Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

 Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»
Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»

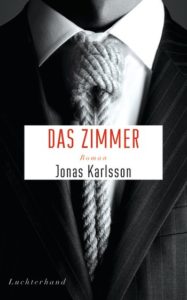 gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken.
gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken. Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht.
Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht. Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.
Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.
 wenigsten immer stärker werdende Erinnerungen, das nie Ausgesprochene, all die Versäumnisse, das Unterlassene. Er zieht Bilanz, wenn auch bis zuletzt gefangen von sich selbst. „Es kam ihm an manchen Abenden so vor, als schritte er auf einer von Toten gesäumten Strasse der nahen Dunkelheit entgegen.“ „Die Kraft lief wie aus einem undichten Gefäss heraus.“ Mehr als eine Metapher! Theo verliebte sich noch vor seinem Einsatz in der deutschen Wehrmacht in Wilma, die er nach dem Krieg heiratete, eine Wilma aber, die genau wie er nicht mehr die war, die er einst vor dem grossen Krieg kennenlernte. Doch Wilma starb früh an Krebs, liess ihn zurück mit seiner Tochter Frieda, die schnell mehr war, als bloss Tochter. Und als Berta in Theos Leben auftauchte, entbrannte ein Krieg zwischen den beiden Frauen, bis „Geh, du gefährdest meine Ehe!“ der letzte Ausweg zu sein schien. Aber dem war nicht genug. Frieda begnügte sich schon als Jugendliche nicht mit den flüchtigen Antworten auf ihre Fragen um seine Wehrmachtseinsätze. Theo stellt sich bis ins hohe Alter nicht dem Drängen seiner Tochter, selbst mit dem kümmerlichen Versuch am Schluss seines Lebens, als er ihr sein Kriegstagebuch übergibt, denn dieses ist der Preis dafür, dass Friede sich aufmachen soll in die Ukraine, um Ludmilla zurückzuholen. Ludmilla, eine illegal eingestellte Pflegerin, jene Frau, die als einzige das Herz Theos zu erreichen schien, jene mit der er als einzige frei reden kann, jene Frau, die Berta wegschickte, als Ludmilla Theos letzter Anker war.
wenigsten immer stärker werdende Erinnerungen, das nie Ausgesprochene, all die Versäumnisse, das Unterlassene. Er zieht Bilanz, wenn auch bis zuletzt gefangen von sich selbst. „Es kam ihm an manchen Abenden so vor, als schritte er auf einer von Toten gesäumten Strasse der nahen Dunkelheit entgegen.“ „Die Kraft lief wie aus einem undichten Gefäss heraus.“ Mehr als eine Metapher! Theo verliebte sich noch vor seinem Einsatz in der deutschen Wehrmacht in Wilma, die er nach dem Krieg heiratete, eine Wilma aber, die genau wie er nicht mehr die war, die er einst vor dem grossen Krieg kennenlernte. Doch Wilma starb früh an Krebs, liess ihn zurück mit seiner Tochter Frieda, die schnell mehr war, als bloss Tochter. Und als Berta in Theos Leben auftauchte, entbrannte ein Krieg zwischen den beiden Frauen, bis „Geh, du gefährdest meine Ehe!“ der letzte Ausweg zu sein schien. Aber dem war nicht genug. Frieda begnügte sich schon als Jugendliche nicht mit den flüchtigen Antworten auf ihre Fragen um seine Wehrmachtseinsätze. Theo stellt sich bis ins hohe Alter nicht dem Drängen seiner Tochter, selbst mit dem kümmerlichen Versuch am Schluss seines Lebens, als er ihr sein Kriegstagebuch übergibt, denn dieses ist der Preis dafür, dass Friede sich aufmachen soll in die Ukraine, um Ludmilla zurückzuholen. Ludmilla, eine illegal eingestellte Pflegerin, jene Frau, die als einzige das Herz Theos zu erreichen schien, jene mit der er als einzige frei reden kann, jene Frau, die Berta wegschickte, als Ludmilla Theos letzter Anker war.