Karla wird an Krebs sterben. Und Fred, ehrenamtlicher Sterbebegleiter, ist wild entschlossen, wenigstens damit seinem Leben einen Sinn zu geben. Freds Sohn Phil kommt ganz gut ohne ihn zurecht. Und vom weiblichen Geschlecht sonst ist kaum mehr etwas für Fred zu erhoffen.
«Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster» erzählt von einem ungleichseitigen Dreieck um die todkranke Karla. Karla hat Krebs und vielleicht noch ein paar Monate zu leben. Karla möchte ihre Ruhe haben. Was unbedingt sein muss, akzeptiert sie. Aber als sich dieser Mann nach telefonischer Voranmeldung an ihrer Wohnungstür in ihre Ruhe klingelt, wird diese Sehnsucht nach Ruhe gestört. Der Unruhestifter lässt sich auch durch absichtliche Unfreundlichkeiten nicht abschütteln, erst recht nicht. Der Mann an der Tür ist Fred. Fred ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter und nimmt seine Aufgabe ernst. Er weiss, dass Vertrauen gewonnen werden muss. Fred hat mit dem Leben noch einige Rechnungen offen. Seine Ehe ist gescheitert, seine Ex in die Esoterik abgedriftet. Er als alleinerziehender Vater schmerzhaft weit weg von seinem Sohn entfernt. Auch im Büro reisst ihn nichts mehr aus seinem Trott. Jeden zweiten Mittwoch trifft sich Fred mit andern Berufenen zum Supervisionstreffen der Ehrenamtlichen im Hospiz. Dort holt er Anlauf und später Beistand für seine erste Mission. Eine Aufgabe, die auch durch Einfühungskurse und Handbücher nicht einfacher wird; Sterbebegleitung. Phil ist Freds dreizehnjähriger Sohn. Auch er einer, der sich in seiner Ruhe durch den Vater gestört fühlt. Phil schreibt lieber Gedichte, die er auf Internetforen veröffentlicht, als auf Plätzen einem Ball hinterherzurennen. Phil versteht seinen Vater kaum. Ein Vater, der ein Verlierer zu sein scheint. Einer, der sich als ehrenamtlicher Sterbebegleiter in eine Mission verrennt. Und Gudrun? Gudrun, pensioniert, lebt allein und ist als Karlas Schwester, der einzig übrig gebliebene Rest einer Familie, von der die todkranke Karla nichts, gar nichts mehr wissen will. Bis Fred alle aus ihrer Ruhe reisst.
 Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte.
Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte.
Susann Pásztor erzählt kapitelweise aus der Sicht der vier Protagonisten, macht mich zum Verbündeten, zum Hoffenden, zum Zweifelnden. Zudem würzt die Autorin mit Nebenschauplätzen, die nicht verzetteln, sondern das Kerngeschehen in ein anderes Licht setzen. So wie Phils Wörterkrankenhaus für Wörter, die unheilbar erkrankt sind oder endgültig aus dem Verkehr gezogen werden müssten. Obwohl erst dreizehn entwicklt Phil ein Sensorium, das ihn dort hören lässt, wo andere überhören. Oder das durch Freds Übereifer gestörte Leben von Karlas einziger Schwester Gudrun, die eigentlich eine Kreuzfahrt geniessen will. Sie wird zur Kreuzfahrerin in eine Vergangenheit, die zugeschüttet ist. Oder Karlas Leben selbst, das nur andeutungsweise erzählt wird. Aber an den kursiv gesetzten Listen, die den Kapiteln dazwischengestellt sind, bleibe ich hängen. Sie lassen mich spekulieren, tragen mich weiter.
Und nicht zuletzt ist «Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster» ein Roman über das Sterben. Soll man sich ergeben oder trotz Krankheit gestalten? Wann wird Hilfe und Beistand zur Belastung? Wo und wann wird angebotene Hilfe zum Selbstzweck? Muss man Ordnung machen? Susann Pásztors Roman lebt von den Erfahrungen der Autorin, von den Tiefen und Untiefen jenes letzten Lebensabschnitts.
Ein Interview
Vor der Lektüre Ihres Romans wusste ich nicht einmal, dass es ehrenamtliche Sterbebegleitung gibt. So wie Sie Sterbebegleitung beschreiben, kann der Eindruck entstehen, manche dieser Ehrenamtlichen seien ziemlich überfordert, könnten viel mehr zur Belastung einer eh schon schwierigen Zeit werden, als Entlastung.
Wenn ich ein Sachbuch geschrieben hätte, könnte ich Ihre Bedenken verstehen. Aber es ist ein Roman! Und mal abgesehen davon: Ich denke, dass jede Aufgabe, jede Interaktion mit sterbenden Menschen Momente der Überforderung bereithält, ebenso wie Momente des Glücks, der Hilflosigkeit, der Intimität. Der überwiegende Teil der Sterbebegleiter kann damit umgehen; die wenigen, die das nicht gut aushalten, hören bald wieder auf. Hier in Berlin gibt es viele, bei denen niemand am Bett säße, wenn es die Ehrenamtlichen nicht gäbe. Selbst wenn sie Fehler machen, sind sie alles andere als eine zusätzliche Belastung.
Fred sucht sich eine Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Eine Aufgabe, die mit dem Tod endet. Darf Sterbebegleitung zum Selbstzweck werden? Man sucht sich eine Aufgabe, um sich selbst zu helfen. Fred ist geschieden, überfordert im Zusammenleben mit seinem Sohn Phil, wenig ausgefüllt von seiner Arbeit, ziemlich isoliert.
Das ist etwas, das ich nie verstanden habe: Warum soll man keine Aufgabe übernehmen, mit der man auch sich selbst helfen kann? Jeder Mensch, der Arzt oder Feuerwehrmann oder Therapeut wird, bringt irgendetwas aus seiner Biografie mit, das man auch gegen ihn verwenden könnte. Ich finde nicht, dass es bei so einer Wahl richtige oder falsche, ehrenwerte oder schlechte Motive gibt. Entscheidend ist, wie offen man ist, wie neugierig und wie bereit, sich zu hinterfragen und dazuzulernen und an seiner Aufgabe zu wachsen.
Freds zwölfjähriger Sohn Phil ist ein besonderer Junge. Einer von der stillen Sorte. Einer der Gedichte schreibt und kranke Wörter sammelt. Nicht Fred sein Vater gewinnt Nähe zur sterbenden Karla, sondern sein Sohn Phil. Unspektakulär durch eine Arbeit in Karlas Küche. Braucht es Sterbebegleitung? Braucht es nicht viel mehr soziale Formen, in denen Sterben nicht zum Ausnahmezustand wird? Liegt nicht der Schlüssel zu solchen Menschen in Phils Art, dem Leben und Sterben zu begegnen; ganz fein, ganz still, ganz «nebenbei“?
Oh ja, solche sozialen Modelle sind schön und wünschenswert. Es gibt sie nur nicht, und wenn wir sie haben wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Einer der Wege dorthin ist, dass die Hospizarbeit – und damit auch die Möglichkeit einer Sterbebegleitung – mehr und mehr ins Bewusstsein der Menschen dringt und immer selbstverständlicher zum Leben dazugehört. Viele, so wie Sie, wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Andere organisieren Protestdemos, wenn sie erfahren, dass in ihrer Nachbarschaft ein Hospiz gebaut werden soll. Wir müssen noch so viel lernen. Von daher: Ja, es braucht Sterbebegleitung, und zwar dringend.
Sterbebegleiter Fred will in seinem Übereifer die sterbende Karla mit ihrer einzigen Schwester zusammenbringen. Er will eine Versöhnung provozieren. Sie selbst sind auch Sterbebegleiterin. Braucht es Versöhnung vor dem Tod? Sind wir nicht einfach zu harmoniesüchtig, selbst wenn es um die letzte Strecke vor dem Tod geht?
Ich halte das mit der Versöhnung am Sterbebett für einen romantischen Mythos, der von verzweifelten Hinterbliebenen erfunden wurde. Oder von Schriftstellern. Das Wichtigste ist, glaube ich, mit sich selbst ins Reine zu kommen und seinen inneren Frieden zu finden. Falls das eine Versöhnung erfordert: Man kann auch innerlich um Verzeihung bitten oder verzeihen, dazu braucht es die große dramatische Geste nicht. Das gilt übrigens auch für die Hinterbliebenen.
Ich bin sicher, dass es gute Romane braucht, die Themen ins Gespräch bringen, über die man sonst nicht spricht. Ich bin sicher, dass Ihr Roman genau dies tut. Ich lese und diskutiere mit in zwei Lesekreisen. Ihr Buch scheint mir wie geschaffen dafür? Trotzdem würde ich mich nicht wundern, wenn gerade ältere Menschen bei diesem Thema » blocken». Will man sich wirklich mit dem Sterben beschäftigen?
Ich weiß es nicht. Ich kenne ja auch nicht das Durchschnittsalter der Leser dieses Buchs. Zu den Lesungen kommen jedenfalls erstaunlich viele ältere Menschen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es in allen Altersgruppen etwa gleich viele „Blocker“ gibt. Junge und Mittlere blocken, weil sie Angst vor dem Verlust ihrer Eltern und Großeltern haben, Alte blocken, weil sie wissen, dass sie selbst bald dran sind.
Ich danke Susann Pásztor für das kleine Mail-Interview.
 Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
Titelfoto: Sandra Kottonau
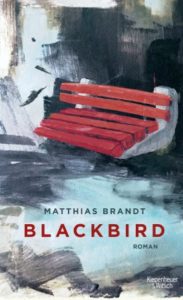 kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren.
kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren.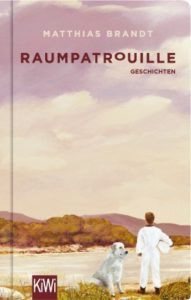 Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».
Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».


 Selbst als Nina schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt, selbst als alles an dem kleinen Wicht die Verwandtschaft verrät, selbst als Nina mit dem Kind schwermütig in ihr enges Zuhause einzieht, selbst als Max offensichtlich genug in der Schule seine Fesseln ablegt und beweist, dass er alles andere als ein Nichtsnutz und Krüppel ist, dreht sich die Welt der Grossmutter in ihren Bahnen weiter. Sie, die stets behauptet, früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen zu sein, schafft es gar, eine Tanzschule zu eröffnen, die von hoffnungsvollen Flüchtlingsfamilien, die überall Türen sehen, überrannt wird.
Selbst als Nina schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt, selbst als alles an dem kleinen Wicht die Verwandtschaft verrät, selbst als Nina mit dem Kind schwermütig in ihr enges Zuhause einzieht, selbst als Max offensichtlich genug in der Schule seine Fesseln ablegt und beweist, dass er alles andere als ein Nichtsnutz und Krüppel ist, dreht sich die Welt der Grossmutter in ihren Bahnen weiter. Sie, die stets behauptet, früher einmal eine gefeierte Tänzerin gewesen zu sein, schafft es gar, eine Tanzschule zu eröffnen, die von hoffnungsvollen Flüchtlingsfamilien, die überall Türen sehen, überrannt wird.


 zurechtzukommen. Lypynskyj befasste sich politisch und historisch mit der zwischen Polen und Russland zerrissenen Ukraine und forderte wie besessen ihre staatliche Unabhängigkeit. Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und – wie er – auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der sowjetischen Entwurzelung zu trotzen. Ein literarisch beeindruckender Roman, der zeigt, was es heisst, wenn die eigene Identität aus Angst, Gehorsamkeit und Vergessen besteht.
zurechtzukommen. Lypynskyj befasste sich politisch und historisch mit der zwischen Polen und Russland zerrissenen Ukraine und forderte wie besessen ihre staatliche Unabhängigkeit. Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und – wie er – auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der sowjetischen Entwurzelung zu trotzen. Ein literarisch beeindruckender Roman, der zeigt, was es heisst, wenn die eigene Identität aus Angst, Gehorsamkeit und Vergessen besteht.
 spielerisch und doch souverän Gedichte um gewichtige Themen: um die Präsenz des Anderen im Selbst, um Anwesenheit und Abwesenheit, um Negativität und Transzendenz. Mit seinen bildgewaltigen, selbstverlorenen und dabei tief nachdenklichen Gedichten sucht Christian Uetz in der Sprache nach der verborgenen Präsenz dieser Engel der Illusion, um ihr Scheinen erfahrbar zu machen. Was seine Texte so hervorbringen, sind Ekstasen der Begierde und die Trunkenheit der Vernunft. Es ist der Wahnsinn des Tages. Ihr Fluchtpunkt bleibt dabei stets eine mitreissende Affirmation des Lebens und der Sinnlichkeit, ein Lob der Sprache als derjenigen Kraft, welche die Illusion als Wahrheit, das Jenseits als Teil des Diesseits erkennbar macht.
spielerisch und doch souverän Gedichte um gewichtige Themen: um die Präsenz des Anderen im Selbst, um Anwesenheit und Abwesenheit, um Negativität und Transzendenz. Mit seinen bildgewaltigen, selbstverlorenen und dabei tief nachdenklichen Gedichten sucht Christian Uetz in der Sprache nach der verborgenen Präsenz dieser Engel der Illusion, um ihr Scheinen erfahrbar zu machen. Was seine Texte so hervorbringen, sind Ekstasen der Begierde und die Trunkenheit der Vernunft. Es ist der Wahnsinn des Tages. Ihr Fluchtpunkt bleibt dabei stets eine mitreissende Affirmation des Lebens und der Sinnlichkeit, ein Lob der Sprache als derjenigen Kraft, welche die Illusion als Wahrheit, das Jenseits als Teil des Diesseits erkennbar macht.
 1999 veröffentlichte Claus Beck-Nielsen seinen ersten Roman und im Jahr darauf begann das, was mit der Figur Madame Nielsen 2013 sein «vorläufiges» Ende gefunden hat. Claus Beck-Nielsen löscht einen Teil seines Namens und will damit auch Erinnerungen löschen, lebt ohne Pass, ohne Geld und «ohne Gedächtnis» auf der Strasse am Bahnhof Kopenhagen. 2001 erklärt er Claus Beck-Nielsen für tot und reist mit Anzug und Krawatte als Klaus Nielsen nach Kuwait, in den Iran, den Irak und nach Afghanistan als Mitglied eines «nomadischen Parlaments». 2013 veröffentlicht sie unter dem Namen Madame Nielsen, elegant als Frau gekleidet, stets beängstigend dünn, ihren ersten Roman.
1999 veröffentlichte Claus Beck-Nielsen seinen ersten Roman und im Jahr darauf begann das, was mit der Figur Madame Nielsen 2013 sein «vorläufiges» Ende gefunden hat. Claus Beck-Nielsen löscht einen Teil seines Namens und will damit auch Erinnerungen löschen, lebt ohne Pass, ohne Geld und «ohne Gedächtnis» auf der Strasse am Bahnhof Kopenhagen. 2001 erklärt er Claus Beck-Nielsen für tot und reist mit Anzug und Krawatte als Klaus Nielsen nach Kuwait, in den Iran, den Irak und nach Afghanistan als Mitglied eines «nomadischen Parlaments». 2013 veröffentlicht sie unter dem Namen Madame Nielsen, elegant als Frau gekleidet, stets beängstigend dünn, ihren ersten Roman.

 Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet.
Es dauert nicht lange, bis sich in Aprils Leben Geister einstellen, Filmfiguren, die sich einmischen; Riff Raff, Faye Dunaway und Rosemarie aus «Rosemaries Baby», die unaufhörlich Fragen stellen, die ihr Leben nicht beantwortet. Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!
Angelika Klüssendorf, geboren 1958 in Ahrensburg, lebte von 1961 bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig; heute lebt sie in der Nähe von Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem die Erzählungen «Sehnsüchte» und «Anfall von Glück», den Roman «Alle leben so», die Erzählungsbände «Aus allen Himmeln» und «Amateure». Mit den beiden Romanen «Das Mädchen» und «April» schliesst «Jahre später eine Trilogie ab. Alle drei Romane sind unbedingt lesenswert!
 schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.
schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird. Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!
Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen! vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.
 der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen.
der in Amerika die Gemeinde Ikarien gründete, eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft, die nach ganz anderen Gesetzen funktionieren sollte, ein utopisches Projekt. Ploetz besuchte jene Gemeinde noch vor Ausbruch des ersten Weltkriegs, war aber enttäuscht darüber, dass das Experiment an den Schwächen der Menschen zu scheitern drohte. In ihm wuchs die Überzeugung, dass nur in einem optimierten Menschen jene Qualitäten brauchbar werden, die eine neue Ordnung sichern würde. Aus einem Idealisten wurde ein glühender Verfechter und Begründer der Rassengesetze und all ihrer fatalen Folgen. Zucht und Züchtigung als Optimierung. Nicht unerwartet erhält Uwe Timm nach der Lektüre seines Romans viele Briefe von Leserinnen und Lesern und ihren Familiengeheimnissen, die plötzlich aufbrechen. Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.
Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt „Vogelweide“, 2013, „Freitisch“, 2011, „Am Beispiel eines Lebens“, 2010, „Am Beispiel meines Bruders“, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, „Der Freund und der Fremde“, 2005, und „Halbschatten“, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis, 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille und den Schillerpreis 2018.
 Ich staune und bin tief berührt. Und einmal mehr verblüfft darüber, wie lange es dauerte, bis ich für solche Texte überhaupt zugänglich wurde. Es ist wohl nicht die Reife, die fehlte. Aber mit Sicherheit die Geduld, sich auf Lyrik einzulassen. Den Genuss der Sprache dem blossem Verstehenwollen vorzuziehen.
Ich staune und bin tief berührt. Und einmal mehr verblüfft darüber, wie lange es dauerte, bis ich für solche Texte überhaupt zugänglich wurde. Es ist wohl nicht die Reife, die fehlte. Aber mit Sicherheit die Geduld, sich auf Lyrik einzulassen. Den Genuss der Sprache dem blossem Verstehenwollen vorzuziehen. Joachim Sartorius liest neben vielen anderen Gästen am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Joachim Sartorius Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Jürg Halter, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf.
Joachim Sartorius liest neben vielen anderen Gästen am 3. Lyrikfestival NEONFISCHE 2018 im Aargauer Literaturhaus Lenzburg. Am Wochenende vom 3. und 4. März lesen und performen neben Joachim Sartorius Robert Schindel, Kathrin Schmidt, Ernst Halter, Raphael Urweider, Frédéric Wandelère, Klaus Merz, Meret Gut, Jürg Halter, Cornelia Travnicek, Tim Holland sowie die Übersetzerinnen Elisabeth Edl und Marion Graf. Joachim Sartorius, geboren 1946 in Fürth, wuchs in Tunis auf und lebt heute in Berlin und Syrakus. Er ist Lyriker und Übersetzer amerikanischer Dichtung. Er veröffentlichte sechs Gedichtbände, zuletzt 2008 „Hôtel des Étrangers“, zahlreiche Bücher, die in Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern entstanden, und die Reiseerzählungen. Sein lyrisches Werk wurde in vierzehn Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Joachim Sartorius, geboren 1946 in Fürth, wuchs in Tunis auf und lebt heute in Berlin und Syrakus. Er ist Lyriker und Übersetzer amerikanischer Dichtung. Er veröffentlichte sechs Gedichtbände, zuletzt 2008 „Hôtel des Étrangers“, zahlreiche Bücher, die in Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern entstanden, und die Reiseerzählungen. Sein lyrisches Werk wurde in vierzehn Sprachen übersetzt. Er ist Mitglied des PEN und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
 Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte.
Susann Pásztor, neben ihrer Berufung als Autorin und Übersetzerin selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin, gelingt es mit ihrem zugleich heiteren wie ernsten Roman ein Tor zu einem Thema zu öffnen, das nicht nur in der Literatur wenig Aufmerksamkeit findet. Zum einen erzählt Susann Pásztor vom Sterben einer Frau, der das langsame Sterben selbst schon vor dem Tod alles zu nehmen droht. Zum anderen von der durchaus ehrenvollen Aufgabe der Sterbebegleitung. Eine Aufgabe, die so ganz anders ist als alles, was wir uns sonst auferlegen. Wie soll man sich Sterbenden nähern, ohne das aus Ehrenhaftigkeit Aufdringlichkeit wird? Was tun, wenn die Signale einer Sterbebegleitung nicht ankommen, nicht so ankommen, wie sie gedacht waren? Wenn aus Übereifer Verletzungen entstehen? Wenn aus Beistand Notstand wird? Susann Pásztor beschreibt mit einem besonderen Gefühl für Feinheiten das Spannungsnetz einer solchen Extremsituation. Susann Pásztor lässt das Geschehen subtil entgleisen. Phil, Freds Sohn, soll für Karla in ihrer Küche all die Negative aus einer «Grateful-Dead-Vergangenheit» einscannen. Dabei gewinnt er unweigerlich jene Nähe, die sein Vater auch mit der Brechstange nicht zu erwirken vermag. Übermotiviert und euphorisiert nimmt Fred heimlich Kontakt zur einzigen Verwandten Karlas, zu Gudrun auf. Die Zusammenführung soll zur Weihnachtsüberraschung werden. Eine, die ihm gelingt, wenn auch gar nicht so, wie er sich das ausgemalt hatte. Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihr Debütroman »Ein fabelhafter Lügner« erschien 2010 und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 2013 folgte der Roman »Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts«. Sie hat die Ausbildung zur Sterbebegleiterin abgeschlossen und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
 Alterns auseinanderzusetzen hat, damit, dass er Namen vergisst, immer öfter das Opfer «einer diskreten Verbrennungsanlage im Gehirn» wird. Ist es die Suche und Sehnsucht nach dem Glück angesichts der unbestreitbaren Endlichkeit des Lebens? Oder ist er nicht einfach ein blinder Idiot? Sind es die Geheimnisse um Leyla, genauso wie die Geheimnisse um den misteriösen Bilderraub vor mehr als 100 Jahren, als ein einfacher Handwerker die Mona Lisa aus dem Louvre trug und das Gemälde längere Zeit verborgen blieb? Roland selbst ist davon überzeugt, dass die ganze Welt dort im Louvre einer Kopie des berühmten Lächelns huldigt. Ist dem Lächeln der Mona Lisa zu trauen? Roland lässt sich in das Abenteuer fallen, erst recht, nachdem die alten Männer im «Club der Unentwegten», sein «alter» Freundeskreis in seiner Heimatstadt Berlin, von ihren Abenteuern erzählen. Alte Männer, die alle irgendwie der Liebe, dem Verliebtsein und der Sehnsucht danach ihr Leben ausrichten. Unentwegt lieben, bereit, alles, was sie an Normalität umgibt, aufs Spiel zu setzen, vielleicht ein letztes Mal.
Alterns auseinanderzusetzen hat, damit, dass er Namen vergisst, immer öfter das Opfer «einer diskreten Verbrennungsanlage im Gehirn» wird. Ist es die Suche und Sehnsucht nach dem Glück angesichts der unbestreitbaren Endlichkeit des Lebens? Oder ist er nicht einfach ein blinder Idiot? Sind es die Geheimnisse um Leyla, genauso wie die Geheimnisse um den misteriösen Bilderraub vor mehr als 100 Jahren, als ein einfacher Handwerker die Mona Lisa aus dem Louvre trug und das Gemälde längere Zeit verborgen blieb? Roland selbst ist davon überzeugt, dass die ganze Welt dort im Louvre einer Kopie des berühmten Lächelns huldigt. Ist dem Lächeln der Mona Lisa zu trauen? Roland lässt sich in das Abenteuer fallen, erst recht, nachdem die alten Männer im «Club der Unentwegten», sein «alter» Freundeskreis in seiner Heimatstadt Berlin, von ihren Abenteuern erzählen. Alte Männer, die alle irgendwie der Liebe, dem Verliebtsein und der Sehnsucht danach ihr Leben ausrichten. Unentwegt lieben, bereit, alles, was sie an Normalität umgibt, aufs Spiel zu setzen, vielleicht ein letztes Mal. Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen zuletzt «Die Lieben meiner Mutter», 2013 und «An der Schönheit kann’s nicht liegen», 2015.
Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen zuletzt «Die Lieben meiner Mutter», 2013 und «An der Schönheit kann’s nicht liegen», 2015.