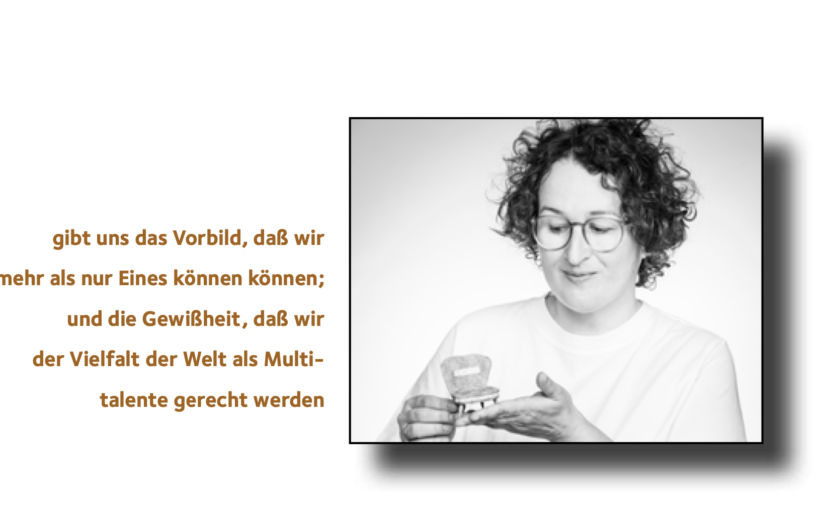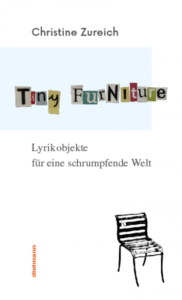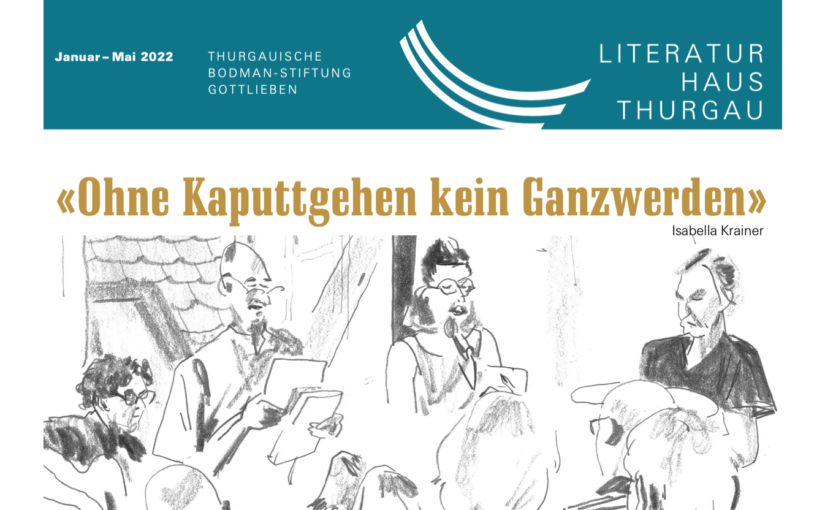Gerade im Sommer ergreift mich, wie tausende andere im deutschsprachigen Raum, das «Bullerbüsyndrom», eine plötzliche, süße Sehnsucht nach Schweden, die mehr über uns Betroffene aussagt, als über das real existierende Land. Berthold Franke prägte in seiner Zeit als Chef des Goethe-Instituts Stockholm den Begriff.

Gastbeitrag von Christine Zureich
Was bei „Bullerbysyndromet“ (BBS) hilft? Eine Reise und, ja, Bibliotherapie. Ich möchte Astrid Lindgren, die Hauptverursacherin des Syndroms empfehlen, „Ferien auf Saltkrokan“, das für Kinder geschriebene Buch verträgt sich mit dem Erwachsensein besser als „Wir Kinder aus Bullerbü“. Dann Tucholsky, natürlich: „Schloss Gripsholm“, die fast sommerleichte Liebesgeschichte um Peter und Lydia (und Billi). Neu in meiner Reiseapotheke gegen BBS dieses Jahr: Eva Brunners „Zweitwald“. Die zweite Gedichtsammlung der Lyrikerin ist im Frühjahr 2025 im Weissmann Verlag, Köln, erschienen.
Ob Eva Brunner je am „Bullerbysyndrom“ litt, weiß ich nicht. Ein rosiger Blick auf das Land würde sich längst geklärt haben: Brunner emigrierte vor einigen Jahren schon mit ihrer Familie aus Berlin nach Uppsala. Der vorliegende Band nun gibt in 11 Kapiteln plus Glossar ein poetisches Protokoll wieder dieses Ankommens (und Ringens) des lyrischen Ichs um das Zweitland, die Zweitsprache, den Zweitwald.
Der Titel jedenfalls lässt Sehnsucht nach mystischer Landschaft anklingen, Trollwald wie versprochen Moos, und im selben Atemzug zugleich ein wenig die Entzauberung, die mit der Reibung an der Realität und Gewöhnung einhergeht: Zweitwagen und Second Hand, auch dieser Aspekt schwingt mit. Und ja, da wird aus anfänglicher Auswanderer-Euphorie ein etwas temperierteres Gefühl: lågom heißt genau richtig / lågom klingt leise / sind Beherrschung und Ruhe zwanghaft?/ (…) / oder kann man in dieser Natur nicht anders? / (…) / något wird von der vorbeiziehenden Landschaft betäubt.
Das lyrische Ich notiert kulturell verankerte Unterschiede in der Selbst- und staatlichen Fürsorge: bloß nicht zu viel Stress und koppla av / genug (…) aber bitte keine Nüsse mit in Schulen nehmen ej / nötter
Zugleich wird verwiesen auf gewisse blinde Flecken der neuen Heimat hinsichtlich des eigenen sozialstaatlichen „Musterschülertums“:
das beste Land der Welt / ist konfliktscheu blendet aus / Jahrzehnte der Zwangssterilisation / der Unterdrückung der Samen / (…) / die eignen Raubzüge / kaum erwähnt man ist modern/auf Bergen bester Empfang / friedliche stugas auf Inseln / Unrecht kommt von Außen / ist nur im Krimi groß
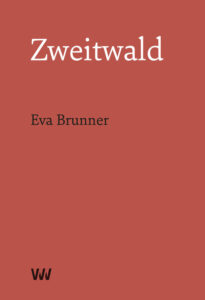
Aber auch die eigenen Haltungen und Ideale hinterfragt das lyrische Ich : wir sitzen im Raum der invandrare / (…) / was haben wir vorher gelernt und gesehen?/wer hatte die Wahl wer nicht? / erste Grüppchenbildung / (…)/ heute steure ich gegen entdecke/morgen ergebe ich mich
Neben den Herausforderungen aus dem invandrar-sein hat sich das lyrische Ich mit dem ganz gewöhnlichen Familienleben als permanente forbifahrt am Ideal herumzuschlagen: Kinder, die nicht die Liebe zu Ronja Räubertochter teilen, sondern Harry Potter vorziehen. Kinder die nur im Zoo nicht nölen. Kinder, mit denen es die neue Sprache zu lernen geht, zusammen mit einer weiteren Fremdsprache im Vokabellisten Ping-Pong. Ich versuche, die Sprache glatt zu streichen / hänge doch: Eva Brunner glättet einzelne schwedische Wörter in die Verse ein, so fein arbeitet sie da, dass aus Kontext und klanglicher Ähnlichkeit mit dem Deutschen – die Mannschaften sind verwandt – keine Übersetzung benötig wird, und wo doch, wird hinten im Glossar alles aufgelöst. Das ist klanglich schön und manchmal auch lustig, setzt einen leisen, effektiven Kontrapunkt gegen die stellenweise fast bullerbüenen Bilder, (die wir doch so sehr lieben und brauchen):
IV.
manche använder Saunamützen mit kaltem Wasser
all die Boote und Blumen mit Kopf und kropp
Himmel so tief wie das Meer blunda blau
wir sind süchtig nach Safran och semlor
kleine Bewegungen nobel lucia
Lass dein Haar herunter
Eva Brunner, 1980, seit Juli 2024 freie Autorin und Übersetzerin. 2015 Promotion in Amerikanistk, 2007 M.A. in Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Psychologie und Publizistik/Kommunikationswissenschaft. Seit 2018 lebt Eva Brunner in Uppsala/Schweden und ist dort Mitglied der Uppsala Autor:innengesellschaft, die ihr auch einen Schreibplatz im Literaturhaus stellt. Ihr Lyrikdebüt »Achtung, die Naht«, parasitenperesse, erschien 2019.
© Leif Santoso Knobbe