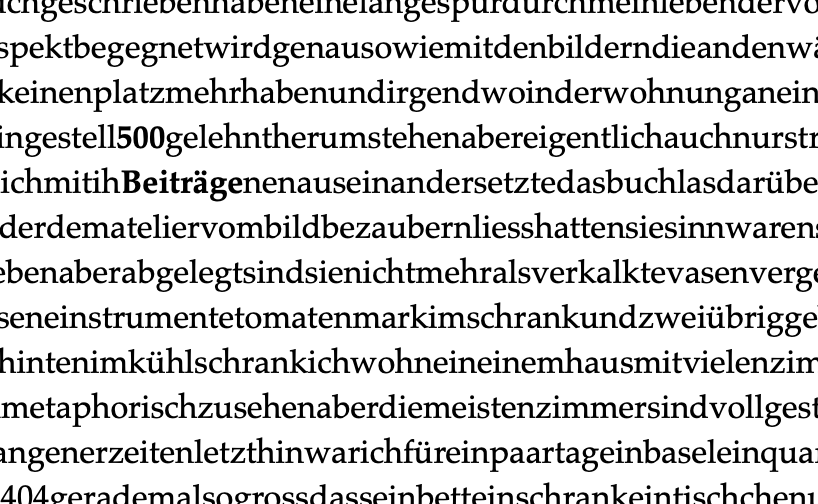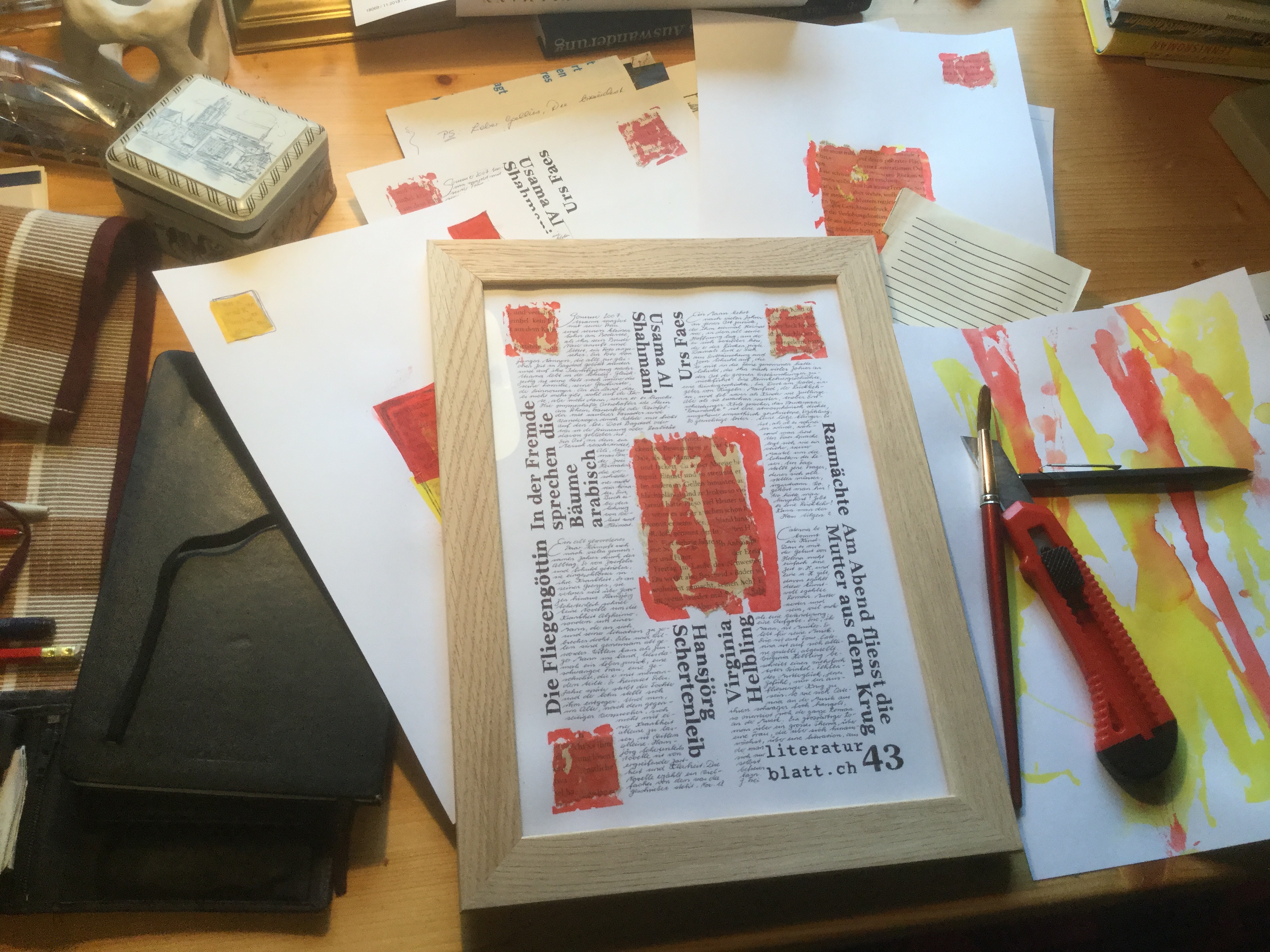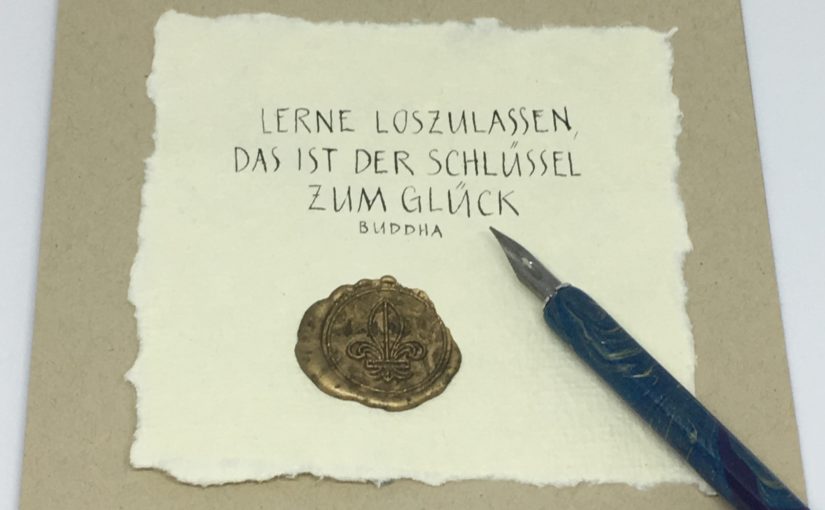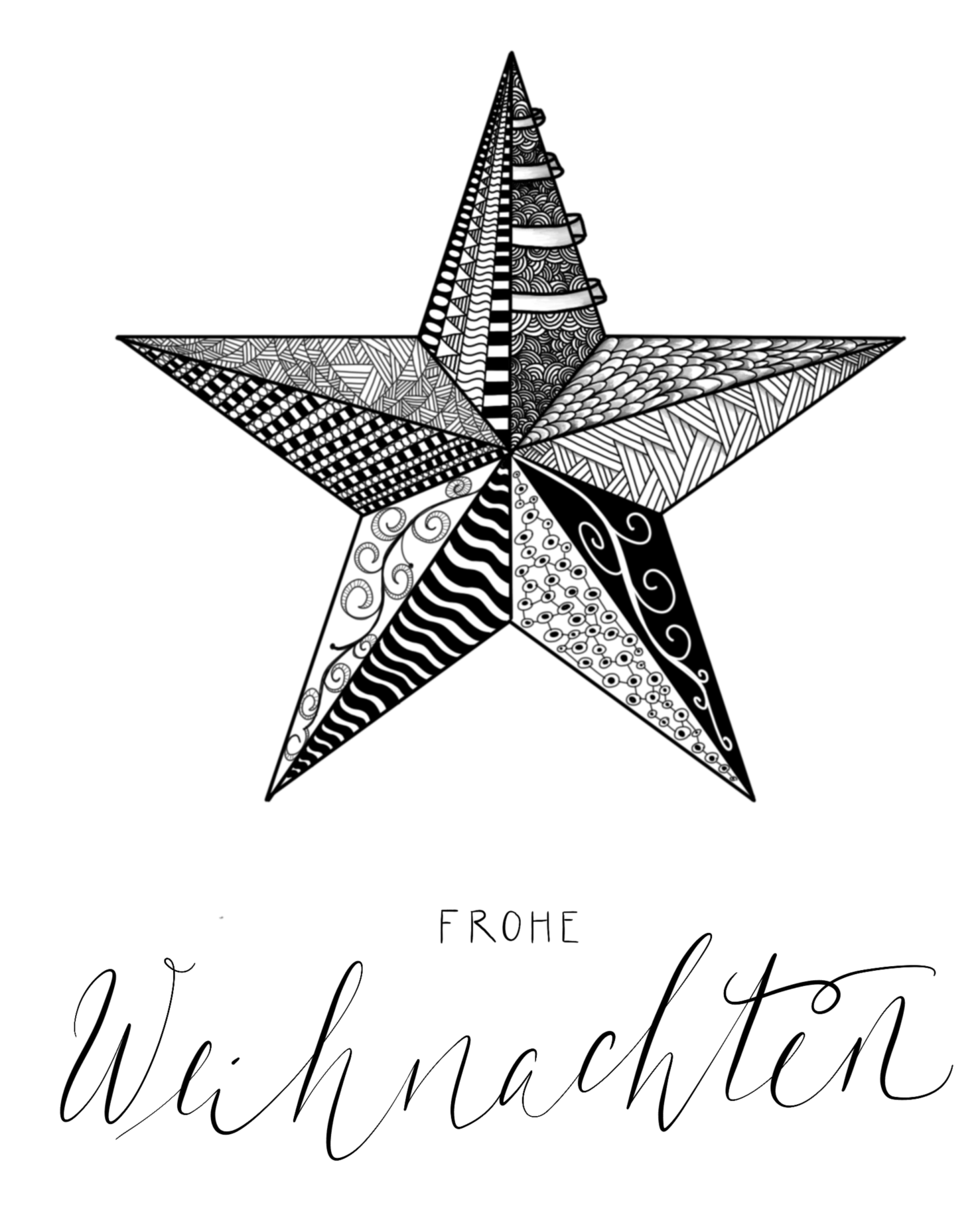It’s time that we began to laugh and cry and cry and laugh
Ich bin dreizehn Jahre alt, meine ältere Schwester liest Salut les Copains und hört Jacques Brel. Wir haben die Maiunruhen, den Prager Frühling und den Vietnamkrieg am Fernsehen gesehen. An diesem Morgen stehe ich an der Haltestelle und warte auf den Bus, mit dem ich in die Stadt zur Schule fahren werde. Das rote Beret trage ich nicht mehr, es verrutscht auf meinem glatten braunen Haar. Dolly hat blondes gewelltes Haar, und ich bewundere sie. Sie kennt sich aus, auch mit Männern. An diesem Morgen singt sie den Refrain eines englischen Liedes. Ich verstehe fast alles, obwohl ich in der Schule nicht Englisch, sondern Altgriechisch lerne, und summe mit. Bis sie inne hält: „Du weißt natürlich, dass es laugh heißt, lachen und nicht lieben?“
„Natürlich“, lüge ich.
Many loved before us, I know that we are not new
Ich bin fünfzehn Jahre alt, und meine ältere Schwester hat mir ihr Moped geliehen. Es ist Samstagabend, und ich fahre an das Sommerfest auf dem Hügel am Stadtrand. Es dauert nicht lange, bis ich Urs finde. Er hat blaue Augen und gewelltes Haar. Er ist auf dem Weg zu einem Konzert und überrascht, als ich frage, ob ich mitkommen dürfe. Das Konzert findet in einem Gemeindesaal statt. Die erste Band spielt schon, als wir ankommen, und es ist dunkel, aber ich sehe Dolly in einer Ecke in den Armen ihres Freundes. Wir hocken uns auf den Boden zwischen die anderen. Urs küsst mich. Ich überlege, was er mit seiner Zunge in meinem Mund sucht, aber ich weiß es nicht.
I will help you if I must, I will kill you if I can
Ich bin siebzehn Jahre alt, und meine ältere Schwester wohnt nicht mehr zu Hause. Es ist Herbst, und ich fühle mich gut, aber ich kann es nicht länger verbergen. Ich muss etwas tun. Es macht überhaupt nicht weh, und als in der Nacht das Wasser bricht, hänge ich das nasse Leintuch über den Stuhl und lege mich wieder schlafen. Ich schlafe so gut in diesem Jahr. Am übernächsten Morgen bestellt meine Mutter ein Taxi. Ich schreie während der Fahrt und im Treppenhaus vor der Arztpraxis. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die ihre Kinder allein im Urwald gebären. Eine Woche später gehe ich wieder in die Schule.
Just win me or lose me
Ich bin neunzehn Jahre alt, meine ältere Schwester ist nach Salzburg gezogen. Richard hat blaue Augen und blondes gewelltes Haar. Ich öffne den Mund, als er mich küsst. Richard ist aus gutem Haus und kennt sich aus. Ich erzähle ihm von dem Kind, aber er weiß, was er will. Nach dem Studium heiraten wir.
Waiting for the miracle to come
Es ist Sonntagnachmittag, und wir spazieren den Rhein entlang. Richard spricht über die Arbeit an seiner Dissertation. Ich denke an die Servietten, die ich noch bügeln muss, und die Kurzgeschichte über die toten Katzen, die ich gern schreiben würde. Wir setzen uns auf eine Bank. Richard erklärt mir, wer von seinen Verwandten in den Patrizierhäusern am gegenüberliegenden Ufer wohnt, und ich weiß, dass ich das nicht ein Leben lang aushalten werde.
And is this what you wanted, to live in a house that is haunted, by the ghost of you and me
Ich bin neunundzwanzig Jahre alt, und wir haben ein Haus in Irland gekauft. Es hat keine Heizung, kein Bad, die Fenster sind zerbrochen, aber es liegt am Hang eines Tales durch den ein Bach fließt. An einem Morgen im ersten Winter stehe ich am Ufer, als die Sonne aufgeht, und sehe den Tau in den Spinnweben zwischen den Schilfhalmen glitzern. Ich weiß, dass ich so lange hier bleiben werde, wie ich kann.
Give me back the Berlin wall
Im Sommer 1987 fahren wir zum ersten Mal nach Berlin. Die Grenzposten sehen so aus wie in Irland, nur dass die Soldaten ihre Gesichter nicht mit Tarnfarbe beschmiert haben. Während Richard Zeitungsredaktionen besucht, fahre ich mit der U-Bahn in den Osten und kaufe günstige Buchausgaben von Goethe, Fontane, Heinrich Mann. Unter den Linden muss ich an das Lied von Hildegard Knef denken.
And no one knows why the wine is flowing
Wir haben uns in dem Haus über dem Tal eingerichtet und mehr Land gekauft, nun gehört uns auch der Bach. Ich habe meinen ersten Roman veröffentlicht und beschlossen, weiterzuschreiben anstatt Kinder zu haben. Richard ist erfolgreich als Journalist; wenn es nötig ist, helfe ich ihm. Manchmal gehe ich gegen Abend an den Bach hinunter und schaue dem Wasser zu. In den kleinen Buchten am Ufer dreht es sich in Wirbeln. Das Tal ist ein Teil von mir, aber ich weiß es noch nicht.
Everybody knows that the war is over
Am 31. August 1994 gehe ich wie jeden Morgen mit den Hunden am Strand spazieren. Am Abend zuvor hat die IRA eine unbefristete Waffenruhe erklärt. Es wird noch vier Jahre dauern, bis das Karfreitagsabkommen unterzeichnet wird. Der Kormoran, der an diesem Morgen in der Mündung des Flusses sitzt, hat seine Flügel zum Trocknen ausgebreitet. Er sieht aus wie ein Wappentier.
Dance me to the end of love
Am Montagabend fahren wir in die Stadt für die Tanzstunden. Es ist kalt in dem großen Saal, wir sind allein mit der Lehrerin, und sie muss uns die Schritte immer wieder zeigen. Richard wird wütend, wenn er Fehler macht. Wir wissen beide, dass wir den Tango niemals lernen werden. Ich würde gern Rumba tanzen können. Es heißt, Rumba sei der Tanz der Liebe.
That’s how the light gets in
Ich arbeite an meinem vierten Roman. Es ist der hermetischste, den ich je schreiben werde, und ich weiß, dass ich am Ende eines Weges bin. Für drei Monate lebe ich in Santa Monica. Die Jacarandas blühen. Gegen Abend spaziere ich manchmal zum Meer hinunter, um den Sonnenuntergang zu sehen.
If you want a lover
Ich bin dreiundvierzig Jahre alt, als ich Dich wieder treffe. Ich weiß sofort, dass ich Dich liebe. Du sagst, es ist genauso wie damals. Ich bin glücklich, ich sehe es, als ich in den Spiegel schaue. Ich nehme mir vor, die zweite Chance nicht zu vertun.
There ain’t no cure
In unserer ersten Nacht klingelt Dein Telefon. Ein Notfall, Du musst ins Krankenhaus zurück. Vom Fenster des dunklen Zimmers aus sehe ich, wie Du auf dem Hotelparkplatz ins Auto steigst und den Motor startest. Bevor Du los fährst, blendest Du den Schweinwerfer für einen Augenblick auf. Die Zärtlichkeit des Lichts schnürt mir die Kehle zu.
It don’t matter how you worship as long as you’re down on your knees
Wir sehen uns heimlich, und oft muss ich auf Dich warten. Aber es ist besser, als nicht zu warten, und wenn Du da bist, ist es nicht mehr wichtig. Es fällt mir leicht, ein Doppelleben zu führen, und manchmal macht es auch Spaß. Ich schreibe über die Liebe.
The odds are there to beat
An einem Abendessen nach einer Lesung in Dhaka liest mir mein Tischnachbar aus der Hand. „There was an accident in your life“, sagt er. Ich weiß, wovon er spricht. „And there is another one to come.“ Die Gespräche am Tisch verstummen. Als ich am Tag darauf in einer Maschine der Bangla Airlines nach Kalkutta zurückfliege, überlege ich, ob ein Flugzeugabsturz ein accident ist. Aber natürlich stünde der nicht in meiner Hand.
If it be your will
Nach zehn Jahren erfährt Richard, dass ich ihn betrüge. Er sagt, er habe immer gewusst, dass ich eine Lügnerin sei. Der Scheidungstermin ist Ende Dezember. Die Verhandlung dauert nur ein paar Minuten, dann wünscht die Richterin uns Glück. Ich sehe Richard in seinem Regenmantel die Straße hinuntergehen und denke, dass er Dir dankbar sein sollte.
And thanks, for the trouble you took from her eyes, I thought it was there for good so I never tried
Ich gewöhne mich an das Alleinleben; an den Verlust des Tales werde ich mich nie gewöhnen. Ich richte mich in einem kleinen Haus auf einem Hügel ein, und jeden Morgen gehe ich mit dem Hund am Strand spazieren. Ich treffe Dich alle paar Wochen für zwei, drei Nächte, meist in einer fremden Stadt. Es ist nicht wichtig wo.
Everything depends upon, how near you sleep to me
Ich bin dreiundsechzig Jahre alt, Leonard Cohen ist vor zwei Jahren gestorben, meine Schwester lebt immer noch in Salzburg. Ich dachte stets, dass ich lieber ein interessantes als ein glückliches Leben hätte; es ist so schwer, über Glück zu schreiben. Heute scheint mir, dass wir unsere Möglichkeiten, über unser Leben zu entscheiden, maßlos überschätzen. Das Meiste passiert einfach – Liebe, Tod – und wir wissen nicht warum.
The story’s told, with facts and lies.
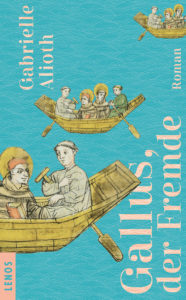 Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».
Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».
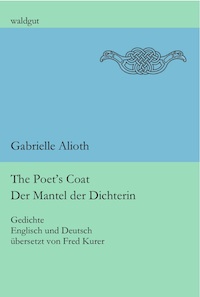 Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch
Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch
Webseite der Autorin
 Maxwells Mutter sucht ihr Glück als Tänzerin, bis das Knie ihre Karriere als Ballerina beendet und sie sich mit Auto und Kind auf die Suche nach dem verlorenen Glück macht. Eine getriebene Existenz auf der ewigen Suche, zusammen mit Maxwell, ihrem Sohn, die niemals Sicherheit oder ein Zuhause erfährt.
Maxwells Mutter sucht ihr Glück als Tänzerin, bis das Knie ihre Karriere als Ballerina beendet und sie sich mit Auto und Kind auf die Suche nach dem verlorenen Glück macht. Eine getriebene Existenz auf der ewigen Suche, zusammen mit Maxwell, ihrem Sohn, die niemals Sicherheit oder ein Zuhause erfährt.



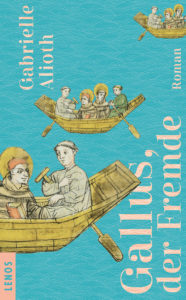 Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».
Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».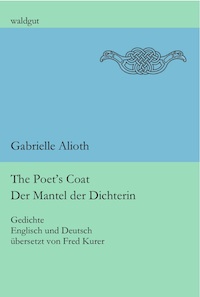 Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch
Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch
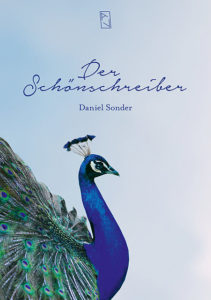 Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen.
Sonder: Schon in einer frühen Phase des gezielten Materialsammelns wurde deutlich, dass die inhaltlichen Ideen, die ich in dem Buch unterbringen wollte, sehr vielgestaltig sein würden. Gleichzeitig schwebte mir vor, mich unterschiedlicher Formen der Sprache zu bedienen. Vor diesem Hintergrund hielt ich es für notwendig, irgendwie etwas Durchgängiges, ein verbindendes, Zusammenhalt stiftendes Element einzuführen. Da lag dann der Gedanke an eine zentrale Figur, in deren einheitlichen Lebenswelt sich all das gebündelt findet, nahe. Damit war der Protagonist W. geboren und mit ihm der Entscheid für die Gattung Roman getroffen. Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.
Daniel Sonder studierte Psychologie und Philosophie in Zürich, war anschließend viele Jahre in der Sofwareentwicklung tätig aber das Schreiben habe ihn „mehr oder weniger im Verborgenen schon lange beschäftigt“. Nun tritt der Vater von drei erwachsenen Töchtern mit Wohnsitz in Meilen am Zürichsee mit seinem Roman „Der Schönschreiber“ zum ersten Mal auf die Bühne des Literaturbetriebes.
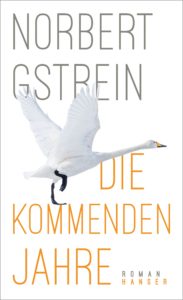 Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.
Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.

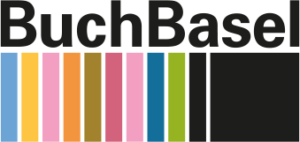 Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam.
Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam.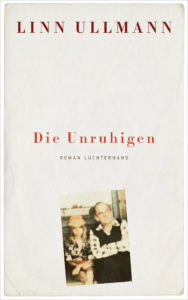 Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.
Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

 Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann.
Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann. Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).
Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).
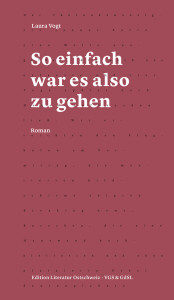 Laura Vogt, geboren 1989 in der Ostschweiz, absolvierte das Schweizerische Literaturinstitut in Biel. Davor studierte sie fünf Semester Kulturwissenschaften an der Universität Luzern und hielt sich längere Zeit in Uganda, Ägypten und Griechenland auf. Sie schreibt Prosa, lyrische und journalistische Texte und ist zudem als Schriftdolmetscherin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen» (VGS St. Gallen). 2012 war sie Siegerin beim Schreibwettbewerb des Thuner Literaturfestival Literaare, 2014 erhielt sie einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung und 2017 einen Werkbeitrag der Stadt St. Gallen.
Laura Vogt, geboren 1989 in der Ostschweiz, absolvierte das Schweizerische Literaturinstitut in Biel. Davor studierte sie fünf Semester Kulturwissenschaften an der Universität Luzern und hielt sich längere Zeit in Uganda, Ägypten und Griechenland auf. Sie schreibt Prosa, lyrische und journalistische Texte und ist zudem als Schriftdolmetscherin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen» (VGS St. Gallen). 2012 war sie Siegerin beim Schreibwettbewerb des Thuner Literaturfestival Literaare, 2014 erhielt sie einen Werkbeitrag der Ausserrhodischen Kulturstiftung und 2017 einen Werkbeitrag der Stadt St. Gallen.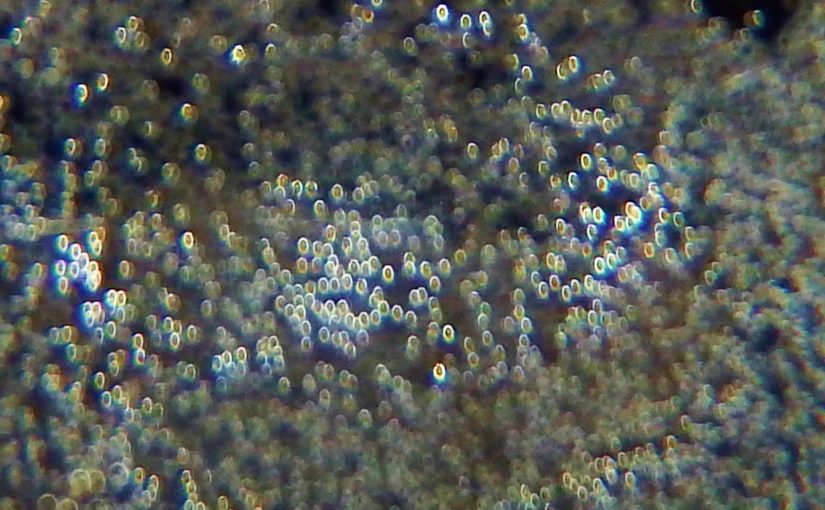
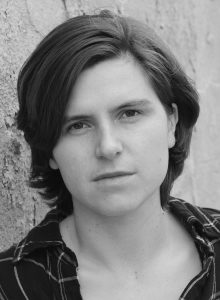 Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.
Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.