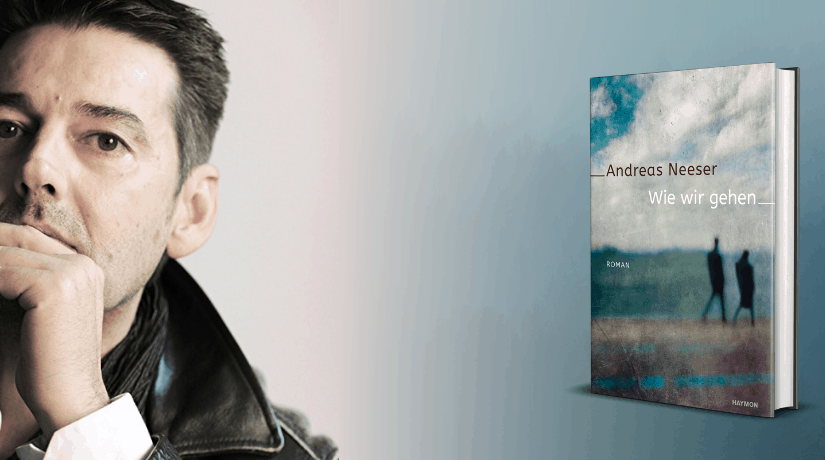Während eines Sommers kann sich alles ändern. Alles. Zumindest für einen Jungen zwischen Kindheit und Erwachsensein. Die festgelegte Ordnung, das ewige Ticken des Einerlei, die Selbstverständlichkeit, die man nie in Frage stellt, obwohl einem die Welt der Erwachsenen suspekt erscheint. Steffen Schroeder hat in seinem Roman die Hitze eines Sommers nacherzählt, die Hitze über einem kleinen Stück Glück, das verglüht.
Konrad teilt den Sommer mit Holger, einem geistig behinderten Jungen aus der Nachbarschaft, der in jenem Sommer zwar achtzehn wird, seinen um einige Jahre jüngeren Freund aber wie einen grossen Bruder sieht. Für ein paar Sommerwochen befreit von der Schule verbringen sie ihre Tage im Freibad Floriansmühle, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich ihr karges Taschengeld durch Pfandflaschengeld aufbessern können, weil Konrad nicht viel anzufangen weiss mit dem wichtigtuerischen Gehabe seiner Klassenkameraden und weil die Mädchen in seinem Alter auf einem andern Stern leben. Weil er mit den Jungs, die Fussball spielen nicht mithalten kann und weil ihm die ewigen Streitereien seiner Eltern auf den Wecker gehen.
Erstes Zeichen dafür, dass der Sommer nicht sein wird, wie all die andern bisher, ist das Versteck, das er und Holger im Unterholz verborgen finden, der tote Specht unter ihrem Kletterbaum und die Plastiktüten in ihrem Versteck, die verraten, dass sie nicht die einzigen sind, die das Versteck nicht weit vom Bach nutzen.
Anja taucht auf. Ein Mädchen, das so ganz anders ist wie alle, die er sonst kennt. Anders als Jasmine, die Schwester seines reichen Klassenkameraden, die in ihren rosa Klamotten aussieht wie aus einer Mädchenzeitschrift entstiegen. Anja hat kurze Haare, als wären sie selbst geschnitten, trägt Kordhosen, keine Jeans wie alle andern, kennt jedes Kraut, das wächst und gibt sich selbst im Freibad, als sie sich umzieht, unbekümmert, als ginge sie die Welt rundum nicht wirklich etwas an.
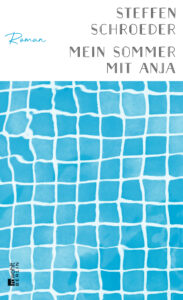
Konrad ist gleichermassen fasziniert wie Holger. Erst recht als klar wird, dass Anja vom nahen Heim ausgebrochen ist und klar macht, dass sie lieber sterben würde, als in den Bau zurückkehren zu müssen. Aus einer zaghaften Annäherung wird ein Dreigespann. Und als Anja immer mehr Nähe zulässt, Konrad bittet, ihr Geschichten zu erzählen, als sich die Tage nur noch um ihr Zusammensein zu drehen beginnen und Konrad in Kauf nimmt, von seinen Eltern Schelte zu kassieren, schleicht sich jenes Verliebtsein ein, jene zarte, erste Liebe, die alles andere zur Nebensache werden lässt. Sie sitzen am Fluss, nehmen Anja mit ins Freibad, sie hocken in ihrem Versteck oder stromern durch die Gegend.
Aber Konrad spürt, dass er durch Anja einer Welt begegnet, die mit der seinen nichts gemein hat. Was Anja erzählt, ist wenig. Der Sommer wird zu einer Blase ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Erst als Konrad und Anja im Wald bei wild gebauten Hütten von Stadtstreichern aufgestöbert werden, als in den Zeitungen von einem aus einem Heim ausgebüxten Mädchen geschrieben wird, als Konrad und Holger sehen, mit welcher Gier das Mädchen die von zuhause mitgebrachten Lebensmittel vertilgt, spürt Konrad, dass seine Welt mit der des Mädchens nicht viel gemein hat. Trotz all der Nähe, den zaghaften Berührungen, den flüchtigen Küssen.
Steffen Schroeder erzählt von einem heissen Sommer, in dem Konrad seine Unschuld verliert. Von einem Sommer, der ihn aus der Kindheit katapultiert. Von einem Sommer, der ihn mit einer offenen Wunde zurücklässt, in dem der Verrat über die Liebe siegt und das eigene Tun und Lassen zu einer Katastrophe werden kann. Konrads Ahnung, dass das Leben nicht bloss aus Wassereis, den Top Ten aus dem Radio und der Sehnsucht nach Nähe besteht, dass es ein Leben ausserhalb aller Konventionen gibt, an der Grenze zwischen Kindheit und Erwachsensein, bricht über den Jungen, wie Hagel, Blitz und Donnerschlag zugleich.
„Mein Sommer mit Anja“ ist die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies.
Interview mit Steffen Schroeder:
Konrad und Holger haben ein Geheimnis. Anja. Aber vielleicht macht das das Wesen von Geheimnissen aus. Der Unterschied zwischen jenen in der Kindheit und jenen als Erwachsener. Ein Geheimnis ist nicht einfach nur mehr etwas Verborgenes, sondern das, was den Träger eines Geheimnisses zum Schuldigen macht, wenn auch nur sich selbst gegenüber. Konrad erfährt existenziell, dass Geheimnisse tiefe Wunden reissen können. Ist Schreiben eine Form der Wundheilung?
Für mich auf jeden Fall. Ich habe schon als Kind Erlebtes in kleinen Geschichten verarbeitet oder in Tagebucheinträgen. Es gibt Texte, die schreibe ich nur für mich. Und andere, bei denen ich mich sehr freue, wenn ich sie mit möglichst vielen Menschen teilen darf.
In der Kindheit wächst man auf in der von den Eltern mehr oder weniger behüteten Familie. Die Pubertät ist nicht nur die Zeit der Verselbstständigung, der Loslösung, sondern auch die Zeit der Ernüchterung darüber, dass die Welt nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Wird die Ernüchterung nicht mit jedem Jahrzehnt schmerzhafter, so sehr, dass die Jugendlichen der Gegenwart allen Grund hätten, einer kollektiven Depression zu verfallen?
Das glaube ich nicht. Der Spruch „Früher war alles besser“ galt ja schon immer. Und ich stelle fest: So sehr mich dieser Ausspruch als Kind genervt hat – mit zunehmendem Alter muss man aufpassen, ihn nicht selbst zu verwenden. Letztens las ich einen Artikel, der mit einer Abhandlung über den kuriosen Umstand begann, dass heutzutage jeder überallhin reist. Der Witz war: Die so heutig wirkende Einleitung stammte von Theodor Fontane.
Und was die Depression angeht: Die Jugendlichen von heute haben unglaubliche Möglichkeiten und Freiheiten, wie es sie in diesem Ausmass noch nie zuvor gegeben hat: Man kann sich frei entscheiden, welchen Beruf man ausüben will, wo man leben will, ob und wen man heiraten will, welche Form der Sexualität man leben will und welches Geschlecht man gerne haben möchte. Die Kehrseite der Medaille: Wenn alles offen ist, muss man überall Entscheidungen treffen. Und das ist nicht immer einfach. Hinzu kommt die Angst: Jede Entscheidung, die ich treffe, kann die falsche sein. Und schliesst automatisch eine andere Option aus. So grossartig und verlockend diese Freiheit ist, ich stelle im Umfeld meiner grossen Söhne fest: Viele Jugendliche tun sich nach dem Abitur schwer, überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen, egal in welchem Bereich. Und verfallen in eine Depression. Das kann ich durchaus verstehen.
Übrigens fällt mir dazu ein: Ich habe mich ja bei meinem ersten Buch ausgiebig mit dem Gefängnis und seinen Insassen beschäftigt. Und genau dieses Verhalten kenne ich auch von Langzeithäftlingen, die nach vielen Jahren vor der Entlassung stehen. Die plötzlich in Aussicht stehende Freiheit, Freiheit auf allen Ebenen, überfordert sie. Und sie werden häufig depressiv. Ich glaube, Freiheit muss man lernen.
Holger, Konrads Freund, ist zurückgeblieben, Konrad der einzige, der ihm nicht die kalte Schulter zeigt, Holgers Mutter eine Frau mit langen schwarzen Haaren und dem Kämpferherz eines Indianers. Holger, seine Mutter, Anja – alles Figuren, die nichts mit der Biederkeit der späten Achtziger gemein haben. Kann man sich allein durch Erinnerung in jene Zeit zurückschreiben oder brauchten sie Hilfe; Bilder, Geschmäcker, Düfte, Musik, Filme?
Vielleicht kann man es, aber mir wäre es definitiv zu trocken. Und so habe ich mich all dieser Hilfsmittel bedient: Musik, Geschmackssinn und Gerüche funktionieren bei mir da besonders gut – mit diesen „Transportmitteln“ konnte ich mich schlagartig in die 80er Jahre versetzen und hatte viel Spass daran!
Sie sind Schauspieler und Schriftsteller. Geben Sie sich mit ihrem Roman die Hauptrolle in ihrem eigenen, inneren Film? Oder entspricht das Schreiben viel mehr der Sehnsucht nach einer gewissen Ordnung im Leben?
Das Schreiben ermöglicht mir Geschichten so zu erzählen, wie ich sie fühle. Das ist das Grossartige daran. Ich kann alles laufen lassen, so wie es in mir entsteht. Das ist eine grosse Freiheit, die ich gar nicht genug schätzen kann.
Als Schauspieler unterstehe ich ja immer einem Regisseur, der wiederum einem Intendanten untersteht, der wiederum auch von politischen Gegebenheiten abhängig ist. Oder ich folge den Anweisungen eines Fernsehregisseurs, der einen Produzenten zufriedenstellen muss, der es wiederum seinem Redakteur Recht machen will und dieser seinem Chefredakteur; die Quote muss am Ende stimmen und so weiter… und dann spielt das Geld natürlich noch eine Riesenrolle.
Da stellt sich oft nicht mehr die Frage, wie erzählen wir unsere Geschichte am schönsten? Sondern wie erzählen wir die effektvollste Geschichte, zum günstigsten Preis, mit breitestmöglicher Zielgruppe?
Wenn ich jedoch schreibe, kann ich alles einfach so entscheiden, wie es der Geschichte dienlich ist – und Punkt. Zumindest wenn man das Glück hat, bei so einem wunderbaren Verlag wie Rowohlt Berlin zu sein. Für mich ein riesiges Geschenk.
Das Schreiben eines Buches begleitet einem über Jahre. Es teilt Leben bis in die kleinsten, feinsten Sequenzen. Und selbst, wenn die Musik jener Zeit in ihrem Roman eine wichtige Rolle spielt, bleiben die Bilder über lange Strecken stumm. Was ist der Schriftstellerei und der Schauspielerei gemeinsam?
Letztendlich geht es doch immer ums Geschichten erzählen, ob als Schauspieler oder als Schriftsteller. Ich denke, da kommen diese beiden Berufe her. Vor langer, langer Zeit sind Minnesänger durch die Lande gereist und haben den Menschen ihre Geschichten erzählt und vorgetragen. Aus diesem Beruf sind Schriftsteller und Schauspieler hervorgegangen. Insofern liegt für mich beides ganz nah beieinander. Und auf einen Nenner gebracht: Egal ob ich spiele oder schreibe: Ich möchte gerne Menschen berühren. Darum geht es mir.

Steffen Schroeder wurde 1974 in München geboren. Nach seiner Schauspielausbildung war er zunächst Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, dann beim Berliner Ensemble. Er wirkte in Fernsehserien und Kinofilmen mit. 2017 erschien bei Rowohlt «Was alles in einem Menschen sein kann. Begegnung mit einem Mörder». Steffen Schroeder lebt mit seiner Familie in Potsdam.






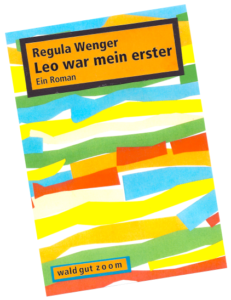 Einmal habe ich ein Buch einer Bekannten angefangen zu lesen: Es waren wunderbare, ausführliche Beschreibungen darin, die mich berührt haben, doch ich habe das Buch schnell wieder weggelegt. Ich wollte vermeiden, dass ich mich von dieser Art zu schreiben beeinflussen lasse. Ich bevorzuge einen kürzeren, knapperen Stil, wobei ich ausschliesslich kurze Sätze auch schnell langweilig finde – Rhythmus und Abwechslung sind mir wichtig.
Einmal habe ich ein Buch einer Bekannten angefangen zu lesen: Es waren wunderbare, ausführliche Beschreibungen darin, die mich berührt haben, doch ich habe das Buch schnell wieder weggelegt. Ich wollte vermeiden, dass ich mich von dieser Art zu schreiben beeinflussen lasse. Ich bevorzuge einen kürzeren, knapperen Stil, wobei ich ausschliesslich kurze Sätze auch schnell langweilig finde – Rhythmus und Abwechslung sind mir wichtig. Regula Wenger (1970), Autorin, Kolumnistin und Journalistin in Basel. Ausbildung unter anderem an der Schweizer Journalistenschule in Luzern sowie an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich (Literarisches Schreiben). Arbeitete als Journalistin auf mehreren Zeitungsredaktionen, als Redaktorin und Moderatorin bei einem Lokalradio sowie als Texterin bei einem Kommunikationsunternehmen. Heute ist sie freie Journalistin, Autorin und Kolumnistin in einem Basler Pressebüro. Mitgewinnerin des Schreibwettbewerbs «Geschichten aus der Vorstadt» von Szenart, der Gruppe für aktuelles Theaterschaffen in Aarau (2013). Ihr Roman «Leo war mein erster» ist im Waldgut Verlag (Frauenfeld 2014) erschienen.
Regula Wenger (1970), Autorin, Kolumnistin und Journalistin in Basel. Ausbildung unter anderem an der Schweizer Journalistenschule in Luzern sowie an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich (Literarisches Schreiben). Arbeitete als Journalistin auf mehreren Zeitungsredaktionen, als Redaktorin und Moderatorin bei einem Lokalradio sowie als Texterin bei einem Kommunikationsunternehmen. Heute ist sie freie Journalistin, Autorin und Kolumnistin in einem Basler Pressebüro. Mitgewinnerin des Schreibwettbewerbs «Geschichten aus der Vorstadt» von Szenart, der Gruppe für aktuelles Theaterschaffen in Aarau (2013). Ihr Roman «Leo war mein erster» ist im Waldgut Verlag (Frauenfeld 2014) erschienen.


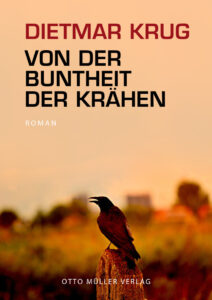 Dietmar Krug, selbst lange Zeit Mitarbeiter in Zeitungsredaktionen und Kolumnist, Meister der filigranen Beschreibungen, beschreibt die nach innen und aussen gerichteten Auseinandersetzungen der beiden Männer. Thomas stellt sich seinen Wahrheiten nicht, er, dem die Herzen der meisten Dorfbewohner offen stehen. Er schafft es auch nicht, das Grab seiner Mutter zu besuchen, das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Aber er beginnt in dem kleinen Haus, im Garten, den er mit den beiden Kaninchen eines Mädchens aus der Nachbarschaft, die er in Pflege nimmt, teilt, zu schreiben, zaghaft zuerst, dann immer tiefer, weil er weiss, dass im Schreiben der einzige Weg für ihn offen steht.
Dietmar Krug, selbst lange Zeit Mitarbeiter in Zeitungsredaktionen und Kolumnist, Meister der filigranen Beschreibungen, beschreibt die nach innen und aussen gerichteten Auseinandersetzungen der beiden Männer. Thomas stellt sich seinen Wahrheiten nicht, er, dem die Herzen der meisten Dorfbewohner offen stehen. Er schafft es auch nicht, das Grab seiner Mutter zu besuchen, das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Aber er beginnt in dem kleinen Haus, im Garten, den er mit den beiden Kaninchen eines Mädchens aus der Nachbarschaft, die er in Pflege nimmt, teilt, zu schreiben, zaghaft zuerst, dann immer tiefer, weil er weiss, dass im Schreiben der einzige Weg für ihn offen steht.

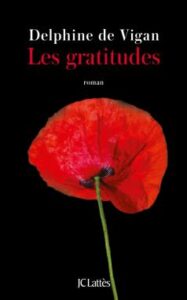
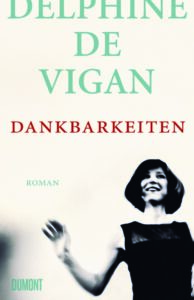 Die Stärken des Romans liegen in der Offenheit des Dreigespanns. Delphine de Vigan erzählt aus der Sicht der alten Frau Michka, die nicht nur vom Vergessen geplagt wird, sondern von zunehmender Angst, realer Angst, alles immer mehr im Vergessen zu verlieren und der Angst, die sich in Träumen, Alpträumen wie Gewitterstürme über ihr zusammenziehen. Und sie erzählt von den Besuchen von Marie und Jérôme, wie sehr die beiden vom langsamen Untergehen der alten Frau betroffen werden. Weil Michka nicht einfach verstummt, sondern sich bis zu ihrem letzten klaren Gedanken, auch wenn dieser immer schwerer zu formulieren ist, um das Leben anderer bemüht. Der Roman überzeugt, weil vieles nur angedeutet ist und meiner Lesart überlassen wird. Delphine de Vigan erzeugt ein Gefühl, zugegeben hart an den Grenzen zur Sentimentalität, ein Gefühl, es nicht versäumen zu wollen. Die Momente, die einem durch Krankheit, das Sterben und den Tod genommen werden können. Momente der Aus- und Versöhnung. Versäumnisse, die den inneren Frieden unmöglich machen.
Die Stärken des Romans liegen in der Offenheit des Dreigespanns. Delphine de Vigan erzählt aus der Sicht der alten Frau Michka, die nicht nur vom Vergessen geplagt wird, sondern von zunehmender Angst, realer Angst, alles immer mehr im Vergessen zu verlieren und der Angst, die sich in Träumen, Alpträumen wie Gewitterstürme über ihr zusammenziehen. Und sie erzählt von den Besuchen von Marie und Jérôme, wie sehr die beiden vom langsamen Untergehen der alten Frau betroffen werden. Weil Michka nicht einfach verstummt, sondern sich bis zu ihrem letzten klaren Gedanken, auch wenn dieser immer schwerer zu formulieren ist, um das Leben anderer bemüht. Der Roman überzeugt, weil vieles nur angedeutet ist und meiner Lesart überlassen wird. Delphine de Vigan erzeugt ein Gefühl, zugegeben hart an den Grenzen zur Sentimentalität, ein Gefühl, es nicht versäumen zu wollen. Die Momente, die einem durch Krankheit, das Sterben und den Tod genommen werden können. Momente der Aus- und Versöhnung. Versäumnisse, die den inneren Frieden unmöglich machen.









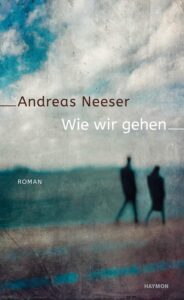 Andreas Neeser erzählt die Geschichte von Johannes, erzählt das, was viele mitnehmen, wenn sie gehen, sei es eine Scheidung oder der Tod. Erzählt von einem Leben als ungeliebter Sohn, verdingt an den reichen Onkel, der auf der anderen Talseite den grossen Hof bewirtschaftet. Von der Armut, die wie eine unheilbare Krankheit an der Familie klebt, sie nicht aus dem Würgegriff lässt. Wie Johannes, obwohl man ihn als Arbeitskraft schätzt, überzählig bleibt, keinen Platz findet, schon gar keine Liebe, auch dort nicht, wo sein Zuhause sein müsste.
Andreas Neeser erzählt die Geschichte von Johannes, erzählt das, was viele mitnehmen, wenn sie gehen, sei es eine Scheidung oder der Tod. Erzählt von einem Leben als ungeliebter Sohn, verdingt an den reichen Onkel, der auf der anderen Talseite den grossen Hof bewirtschaftet. Von der Armut, die wie eine unheilbare Krankheit an der Familie klebt, sie nicht aus dem Würgegriff lässt. Wie Johannes, obwohl man ihn als Arbeitskraft schätzt, überzählig bleibt, keinen Platz findet, schon gar keine Liebe, auch dort nicht, wo sein Zuhause sein müsste.