Noch ist Gate A84 unbesetzt. An den Säulen bei den Durchgangsschranken zum Fingerdock rot leuchtende Querbalken: kein Zutritt. Da ist niemand an den Bildschirmen hinter dem Desk. Die Anzeigetafeln schwarz.
Im Wartebereich olivgrüne Kunststoffsitze, mit Stangen verbunden, dazwischen grosszügige Ablagefläche für Handgepäck. Ein Mann liegt auf der Seite mit angewinkelten Beinen, die Arme verschränkt. Sein Gesicht verdeckt eine weisse Kapuze. Eine Frau mit Kopfhörern. Ihr Gesicht ist ausdruckslos. An der braunen Wand eine Werbefläche, eingeblendet ein Gemälde. Junge im Harlekinkostüm. Mann mit schmalen Lippen, zurückversetztem Kinn, Augen bloss angedeutet. «Picassos blaue und rosa Periode in der Fondation Beyeler. Das Kulturhighlight 2019.» Auf den Bodenplatten fahles Morgenlicht. Weit hinten im Terminal wird an einer Bar mit Geschirr hantiert. Tassen, die ausgeräumt, Unterteller, die bereit gestellt, Kaffeelöffel, die verteilt werden.
Eine Flughafenangestellte schiebt einen Putzwagen vor sich her. Sie trägt ein graues Poloshirt, «Zürich Flughafen». Am Putzwagen hängt Toilettenpapier. In der Nähe des Desks passiert sie eine transparente Erdkugel auf einem schlanken, hüfthohen Sockel. Sie schlurft zu ihr zurück. Mit einem Lappen wischt sie über das Plexiglas, über den Einwurfschlitz und die sich gelb abhebenden Kontinente. Im Innern des Planeten befindet sich Geld. Es bedeckt den Südpol. Viele bronzefarbene Münzen, wenige speckige Banknoten. Allerlei Währungen. Restgeld, das nicht gewechselt werden kann. Die Erdkugel schmückt ein Banner aus Kunststoff: «For a Living Planet». Ein Pandabär flankiert die Werbung für eine Umweltorganisation.
Fünf junge Männer. Farbige Turnschuhe, schwarze Jeans und Kapuzenpullis. Ihre Rollkoffer glänzen. Sie lachen laut und heiser. Zum Überbrücken der Wartezeit besuchen sie den Duty-Free-Kiosk in der Nähe des Gates. Ein Paar setzt sich in den Wartebereich. Sie blättert schon bald in einer Zeitschrift, er scrollt auf dem Smartphone. Weitere Passagiere tauchen auf. Ein älterer Herr. Ein Rentnerpaar. Zwei Frauen mit prallvollen Rucksäcken, sie halten sich an der Hand. Zwillingsschwestern im gleichen Sommermantel, einmal olivgrün, einmal hellblau. Es gibt noch keine Angaben zum Flug, sie setzen sich dennoch. Andere warten ja auch und Gate A84 ist auf der Boarding Card vermerkt. Sie richten sich ein. Verschränken Arme, schlagen Beine übereinander. Lächeln sich kurz zu. Schauen sich um. Gleichgültig. Verstohlen.
Ein kleines Mädchen rennt zur Fensterfront. Es legt seine blassen Hände an die getönte Scheibe und drückt die Schnauze seines Stofftigers ans Glas. Die Mutter geht neben ihm in die Knie und zeigt auf den angedockten Jet. Das Flugzeug leuchtet vom Cockpit bis hinter die Kabinentür in knalligem Rot. Im Rot eine überdimensionierte, sternförmige Blüte. Ein Edelweiss, dessen ungleich lange Blätter sich nach allen Himmelsrichtungen recken. Das Fingerdock, verhakt im Flughafengebäude, die hohle Öffnung wie ein Mund über die Kabinentür gestülpt. Raupenartig, faltig.
Die Mutter nimmt das Mädchen an der Hand. Am Desk stellt es sich auf die Zehenspitzen. Bei den Durchgangsschranken berührt es die rot leuchtenden Querbalken. Es will zur Erdkugel. Die Mutter lässt es gehen.
Es nähert sich ihr langsam, umrundete sie und betrachtet die schlangenförmigen Linien, Einbuchtungen, die Zacken, die Konturen der gelben Kontinente, das Geld in der Kugel, ein Schatz. Ein Berg von einem Schatz, der weiterwächst, wenn man durch den Einwurfschlitz ein Geldstück schiebt und es fallen lässt. Der Vater, nun bei ihm, kramt in der Hosentasche. Zählt Fünfrappenstücke in seine offene Hand. «Mit dir», sagt das Mädchen und blickt ihn aus dunklen Augen an. Er hält es hoch. Es langt zum Einwurfschlitz. Die erste Münze fällt. Ein metallenes Klimpern. Vorsichtig schiebt es die anderen hinterher.
Sie gehen zum Wartebereich. Das Mädchen betrachtet die Menschen. «Wo fliegst du hin?», fragt es die Frau mit den Kopfhörern. Es wiederholt die Frage. «Auf die gleiche Insel wie du», sagt diese. Das Mädchen sucht die Eltern.
Über dem Desk von Gate A84 wird die Anzeigetafeln eingeschaltet. Auf der einen steht: «Fuerteventura WK212/Edelweiss Airline, 10:50, Gate A84, 21 Grad». Auf der anderen: «Einsteigezeit 10:05» und «Self Boarding/Automatisches Einsteigen, bitte Barcode auflegen». Nun werden Boarding Cards in Handtaschen gesucht, Blicke auf Uhren geworfen, Haarsträhnen in Form gebracht, auf die Anzeige hingewiesen, auf die Temperatur am Reiseziel. Es wird abgewogen, ob der Gang zur Toilette noch drin liegt. Das Warten wird konkret. Es verbindet alle für einen kurzen Moment. Niemand will nach Philadelphia oder Warschau. Niemand am Abend zurück nach Hause. Alle haben das gleiche Ziel. Es gibt so lange keine Diskretion, bis sie sich in der Flugzeugkabine installiert, sich wieder ihren Gedanken und ihren push-Nachrichten zugewandt haben und ihre Privatsphäre sie wieder stumm umgibt.
Aus dem Fingerdock taucht Bodenpersonal auf. Über der Uniform tragen sie gelbe Leuchtwesten. Sie lösen die Kordel, die zwischen Terminal und Fingerdock eine Schranke markiert. Am Desk überprüfen sie die Funktionsfähigkeit der Bildschirme, eine Passagierliste. Die wenigen Handgriffe bewirken, dass sich die Menschen erheben, ihr Handgepäck fassen und sich zum Desk begeben. Es bildet sich eine Schlange. Es wird geredet, die Stimmung ist spürbar aufgeräumter. «Die lassen uns allein», wird gefrotzelt, als das Personal die Kordel wieder einhängt und im Fingerdock verschwindet, das Check-in erneut leer bleibt. Ein Gong ertönt. Eine weiche Männerstimme. Der Flug nach Riga wird ausgerufen.
Das Mädchen lässt den Stofftiger teilhaben am kurzen Gespräch der Eltern mit dem älteren Herrn, der zur Anzeigetafel zeigt. Er macht darauf aufmerksam, dass die Inseltemperatur nun 22 Grad beträgt, prächtige Urlaubsaussichten. Die Eltern pflichten ihm bei und das tut auch der Tiger, er wackelt mit dem Kopf. Die Mutter streicht dem Mädchen über das Haar. Es dreht sich brüsk ab. Rennt zur Erdkugel. Drückt des Tigers Nase ans Plexiglas und seine Pfoten an die Arabische Halbinsel. Verlässt ihn die Kraft und baumelt er vor dem Planeten in der Luft, weil das Mädchen Blickkontakt zu den Eltern sucht, verleiht es ihm umgehend neue Tigerkräfte, presst die Nase nun aber wirklich fest an die Erde. Der Stofftiger kann nicht anders, als sie zu riechen, die Welt, und seine Knopfaugen schauen durch das Glas ins Erdinnere, das hohl ist, abgesehen vom geldbedeckten Boden. Seine Augen blicken durch die Erde hindurch, der Tigerblick durchbohrt ein gelb schimmerndes Nordamerika und verliert sich in den verschwommenen Menschensilhouetten, die hinter der Erdkugel vor dem Desk am Gate Schlange stehen. Das Mädchen küsst den Tiger auf den Kopf.
Zwei Angestellte in Uniform steuern auf Gate A84 zu. Die Absätze ihrer Schuhe klacken und übertönen Gesprächsfetzen und das Geratter von Gepäckwagen, die ineinandergeschoben werden. Hinter dem Check-in-Schalter richten sie sich ein. Sie unterhalten sich. Gehen Papiere durch. Fahren die Computer hoch. Eine löst die Kordel beim Fingerdock. Die Querbalken an den Säulen wechseln auf Grün, ein Punkt, der hin und her springt. Der Durchgang zum Fingerdock und zum Jet ist freigegeben. Die andere greift nach einem Mikrofon, ihr Blick streift die Wartenden. Sie liest: «Flug WK212/Edelweiss nach Fuerteventura um 10:50, Gate A84. Das Boarding ist eröffnet.»
Mit einer Begrüssung und einem Lächeln wird die Boarding Card des ersten Fluggastes geprüft. Ein Mittdreissiger, Jeans, Sakko, frische Rasur, mit abgenutztem Rollköfferchen. Er nickt wortlos und verschwindet im Fingerdock, als gehörte er nicht zu denen, die auf den gleichen Flug wollen. Eine Frau zieht den Barcode über den Scanner an der Durchgangsschranke und trägt ihre Ledertasche und eine Prise Selbstverliebtheit auf hohen Absätzen zum Flugzeug. Die jungen Männer sind an der Reihe. Eine Mütze ist im Duty-Free liegen geblieben, sie diskutieren, warten oder einsteigen. Absolut desolat, grinsen sie, der Herr Kollege ohne Mütze. Sie scheren aus der Schlange aus, machen den Eltern des Mädchens Platz. Diese wiederum lassen die Zwillingsschwestern vor, der Vater ruft seine kleine Tochter vergeblich.
Das Mädchen, das Stofftier und die Erdkugel. Es steht vor der Erde. Es und der Tiger spiegeln sich im Plexiglas. Sein verzogenes Gesicht, Mund, Nase, die braunen Augen, krauses Haar. Es weiss, dass die Eltern nahe sind und doch auf Distanz und die Erde ist zu schön, um sie zurück zu lassen. Es umklammert den Tiger, sieht, wie die Mutter den Rucksack schultert und auf es zukommt. Sie redet auf das Kind ein, es lehnt seine Stirn an die Kugel, an Queensland. Sein Schopf reicht bis zum Äquator. Die Mutter hebt das Mädchen hoch, was es geschehen lässt, es hat damit gerechnet, es gibt kein Entrinnen. Dann lacht es und in dem Moment fällt ihm der Tiger hinunter. Er landet rücklings auf dem Kunststoffsockel der Erdkugel, die Knopfaugen starr. Dem Mädchen entfährt ein spitzer Schrei. Die Mutter versucht, nach dem Stofftier zu langen, geht in die Hocke, ergreift ein ausgeleiertes Bein und will sich unverzüglich wiederaufrichten, als es geschieht.
Niemand mag Augenblicke dieser Art, wo sich während einem Bruchteil einer Sekunde abzeichnet, was passieren wird, als sie beim Aufstehen realisiert, dass sie an die Erdkugel stösst, als sie deren beachtliches Volumen spürt und sie weiss, dass die Kugel nicht wirklich verankert ist, unter dem Sockel ein Antirutschfilz zwar, aber nicht konzipiert für einen heftigen Stoss, dass sie nachgibt. Die Erdkugel fällt. Am Äquator kann sie aufgeklappt werden. Ein vorstehendes Kunststoffteilchen ist mit einem Schloss versehen. Auf dieses Teilchen knallt sie mit ihrem ganzen Gewicht. Das Banner rutscht aus der Halterung, das Material bricht, die Plexiglaskugel springt auf und die Erde entleert sich. Münzen schlittern klickernd über die Bodenplatten, als wollten sie nichts wie weg. Sie verteilen sich über die ganze Fläche, einzelne kullern zwischen Beinen hindurch, hochkant hinüber zum Wartebereich unter die Sitze. Fast alle bleiben jedoch bei der Erdkugel liegen, ein Lawinenkegel aus Geld. Die Erde liegt da, mit geöffnetem Schlund. Einen kurzen Moment lang ist es sehr still.
«Mist», ruft die Mutter. Ihr Mann eilt zu ihr hin. Alle schauen. Starren. Die Erdkugel. Das Geld. Das Mädchen mit aufgerissenen Augen, Entsetzen. Seine Augen, die sich mit Tränen füllen. Nicht mit Tränen der Wut, des Schmerzes oder des Trotzes. Es sind Tränen aufrichtiger Trauer, Tränen des Verlustes über etwas Intaktes, das es auf Anhieb gemocht hat und ihm jetzt abhandengekommen ist.
Alle sehen, wie betroffen das Kind auf den Unfall reagiert und seine Betroffenheit überträgt sich. Die Dame am Desk, in professionellem Tonfall, beschwichtigt, nur keine Aufregung, sie ordere den Flughafendienst. Der Vater versucht die Erdkugel aufzurichten, die Frau im olivgrünen Sommermantel packt mit an. Die Erde steht wieder auf dem Sockel, das heisst, die Südhalbkugel. Die Nordhalbkugel, nur durch das Scharnier mit dem unteren Teil verbunden, hängt nach hinten ins Leere. Die Mutter hebt sie vorsichtig an und senkt sie auf die Südhalbkugel. Das Scharnier muss sich verbogen haben. Die Hälften sind nicht mehr passgenau, der Norden ist um zwei, drei Millimeter verrückt. Vergeblich versucht sie es zu richten. Das Mädchen, in der einen Hand hält es den Tiger, mit der anderen umklammert es den Bändel von Mutters Rucksack, weint haltlos. Diese bespricht sich mit ihrem Mann. Sie würden aufräumen, natürlich würden sie aufräumen. Es bleibe genügend Zeit und es sei ihr Missgeschick gewesen, sie habe das Ganze hier verursacht. Das Mädchen beruhigt sich. Schnieft. Sein Blick, noch verschwommen, wandert langsam über die Erdoberfläche, als suchte es ein bestimmtes Land, einen Gebirgszug, der sich abhebt. Am Himalaya bleibt sein Blick an der Stelle hängen, wo die Erdkugel aufgeschlagen ist. Die sonst gelb schimmernden Gipfel sind eingestossen und grösstenteils abgesplittert. Doch dann entdeckt es den Riss im Plexiglas, gleich östlich des Indischen Subkontinents. Der Riss ist hart, weiss, vom Nördlichen Eismeer über Sibirien zieht er sich hinab, entzweit die Wüste Gobi und das Chinesische Tiefland, schrammt an Taiwan vorbei, stösst schwungvoll Richtung Südosten, spaltet den Nordwesten Papua-Neuguineas, büsst an Spaltkraft ein und verliert sich im Golf von Port Moresby.
«Sie ist kaputt», sagt das Mädchen. Es schluchzt.
Es werde sofort jemand hier sein, versichert die Angestellte vom Check-in, jetzt bei ihnen, sie müssten sich keine Sorge machen. Das Mädchen sieht mit verweintem Gesicht zu ihr auf. «Sie ist kaputt», wiederholt es. «Wir kriegen das hin», antwortet die Frau und verschwindet hinter dem Desk. Sie lächelt dem Zwilling im hellblauen Mantel zu, die sich bei ihrer Kollegin nach einem besseren Sitzplatz erkundigt. Sie spricht ins Mikrofon. Es knistert. «Edelweiss Airline WK212 nach Fuerteventura vom Ausgang A84, der Einsteigevorgang ist eröffnet.»
Das Mädchen kniet sich hin und vergräbt seine Hände im Geld. Die Mutter stellt den Rucksack ab. Ihr Mann meint, vielleicht sollten sie das besser sein lassen, es komme ja jemand. «Geht schon», meint sie und füllt ihre Hände mit Münzen. Er presst die Lippen zusammen. Eine Träne kullert dem Mädchen über die Wange. «Siehst du», sagt sie vorwurfsvoll. Er versucht seine kleine Tochter zu trösten. Unschlüssig steht die Mutter vor der Erdkugel. Jedes Geldstück einzeln einzuwerfen dauert zu lange. Sie legt die Münzen zurück auf den Haufen. Mit Hilfe der Frau im olivgrünen Mantel klappt sie die obere, lädierte Hälfte wieder nach hinten. Die Frau hält die Hälfte fest, zur Sicherung, sie könnte abbrechen. So lässt sich die Erde besser füllen. Das Mädchen schnupft. Es fängt an, im Geldhaufen zu wühlen, hebt eine erste Handvoll über die Kante ins Innere, darum bemüht, dass keine Münze hinunterfällt. Die Ladungen werden grösser. Münzen prasseln zu Boden.
Die Angestellten flüstern. Der Flughafendienst ist noch nicht eingetroffen. Sie telefonieren. Auch in der Schlange wird leiser gesprochen, der Zwischenfall hat den Lärmpegel gedämpft. Gerade eben noch war die Erdkugel nur Teil der Infrastruktur des Terminals. Nun ist sie plötzlich Mittelpunkt des Geschehens. Noch scheint in vielen Köpfen der verstörende Anblick, die Erde im Fall, wie ein Film abzulaufen. Vereinzelt schauen die Wartenden zum Desk, um herauszufinden ob es vorwärtsgeht oder das Boarding verzögert wird. Die Angestellten versuchen, das Malheur zu beheben. Die Menschen schauen aber vor allem der Familie zu, wie sie mit dem Missgeschick klarzukommen versucht, wie sich die anfänglich stressige Situation in ein stilles Einverständnis verwandelt, zusammen aufzuräumen. Mit leiser Neugier wird zudem die Frau im olivgrünen Mantel beobachtet, die ihre Hilfe anbietet. Wird sie daran festhalten, wenn ihre Schwester am Desk grünes Licht zum Einsteigen bekommt?
Die Frau blickt um sich. Erfasst das ganze Ausmass des Malheurs. Sie muss gespürt haben, wie die Kinderaugen sie durchbohren, wie das Mädchen abwartet, was sie nun tun wird. Sie wendet sich ihm zu und lächelt. Das Mädchen lächelt zurück. Die Frau zuckt die Schultern und beginnt Geldstücke aufzuklauben. Das Mädchen verfolgt jede ihrer Bewegungen. Dann dreht es sich zu den Wartenden. Schaut sie an. Sein Blick ist dunkel und alt, ein Funken Menschheitsgeschichte liegt in ihm, vom Kind, vom Menschen, dem nichts wichtiger ist, als dass er verstanden wird und sich auf andere verlassen kann.
Das Rentnerpaar reagiert zuerst. Löst sich aus der Schlange und geht zum Mädchen hin. Die beiden helfen ihm die Erdkugel füllen. Die Verliebten, auch sie helfen mit. Weitere schliessen sich an. Sie finden bei den Säulen Münzen, unter der Durchgangsschranke, gleich vor dem Check-in. Selbst an der Fensterfront glänzt Geld im hellen Licht. Die Menschen wirken wie Spatzen, die Brosamen picken. Wie Erntehelfer auf einem Kartoffelacker. Wie Kinder an einer Hochzeitsfeier, beim Auflesen der Bonbons auf dem Weg ins Glück. Der ältere Herr wendet einen Dinar, vergleicht ihn mit einer Münze, die er keiner Währung zuordnen kann. Touristen entdecken einen Rubel und eine Öre unter ihren Rucksäcken, überreichen sie dem Mädchen. Es sammelt die Münzen ein. Rennt, marschiert, hüpft von Mensch zu Mensch. Das Einfüllen erledigt das Rentnerpaar. Noch zieren sich die jungen Männer, Geld einzusammeln wie die Bedürftigen, wer wird zuerst? Bis der Schlaksige zum Wartebereich schreitet, im Rücken das Gelächter der Kollegen. Er sucht unter den Sitzen und wird fündig. Das Mädchen strahlt. Eine Atmosphäre von Heiterkeit und auch ein gewisser Eifer macht sich breit.
Die eine Dame am Desk versucht die Fluggäste davon zu überzeugen, dass der Flughafendienst ganz bestimmt bald eintreffen wird. Ob sie nicht doch einsteigen möchten – aber nein, niemand scheint in Eile zu sein. Viel eher sind alle davon angetan, Ordnung zu schaffen. «Alles eine Frage der Priorisierung», meint der ältere Herr.
Bald einmal, es sind etliche Minuten vergangen, ist das Geld dort, wo es hingehört, in der Erde. Die Mutter streckt dem Mädchen die Hand hin. «Wir müssen. Es ist aufgeräumt», sagt sie. Der ältere Herr zwinkert ihm zu. Das Mädchen zögert. Denkt nach. Und dann geht alles sehr schnell.
Das Mädchen stellt sich auf die Zehenspitzen, taucht kurzentschlossen seine dünnen Arme ins Geld und wühlt darin, dass es klimpert, und das Mädchen schöpft so viel es fassen kann, hebt es über den Rand und schleudert es in Richtung der Zuschauenden. Aus einer Dringlichkeit wird ein Spiel. Das Lachen des Mädchens ist gelöst. Es braucht freie Hände, die mithelfen, es braucht alle Hände. Es wird geklatscht, einer der jungen Männer krempelt demonstrativ die Ärmel hoch und alle machen mit. Nochmals Geld einsammeln. Die Erde füttern.
Passagiere, die eben erst eintreffen, sind irritiert, denn trotz der Menschenansammlung wird nicht angestanden. Die Angestellten kümmern sich aufmerksam um die Neuankömmlinge, was aber nicht ausreicht, um das Einsteigen zügig voranzubringen. Sie könnten umgehend boarden, aber das eifrige Treiben lenkt sie ab, die merkwürdig aufgekratzte Stimmung wirkt ansteckend. Einzelne reihen sich gar ein in den Schwarm von Sammlern.
Vielleicht ist es eine Art kollektive Gewissheit, dass Flug WK212 ohne Passagiere nie startklar sein wird. Es sind schliesslich Menschen, die Crew im Tower, die über den Zeitpunkt des Starts wird entscheiden müssen. Vielleicht ist es die Heiterkeit, das Spiel. Der ältere Herr beginnt einen Schlager zu summen, vom Meer, der Sonne und einem glühenden Herzen, das Rentnerpaar stimmt mit ein, der Vater des Mädchens lacht, sagt dann zu seiner Tochter, die Münzen in die Luft wirf, einen Geldregen herunter prasseln lässt, es reiche.
Eine der Damen macht eine weitere Durchsage. «Edelweiss Airline WK212 nach Fuerteventura vom Ausgang A84: wir bitten Sie dringendst, sich zum Einsteigen bereit zu machen». Die andere redet auf die Eltern ein, eine weitere Verzögerung läge nicht drin. Der Vater beschwichtigt, ihre Tochter sei am Durchstarten, gewissen Prozessen müsse man Raum geben. Seine Frau stimmt in sein Lachen ein, sämtliche Anspannung fällt von ihr ab, bald lacht sie unter Tränen, bis sie plötzlich wieder ernst wird, sehr ernst, sie lasse sich nicht vorschreiben, wann sie wo zu sein habe. Mit Nachdruck bittet sie die Dame um Verständnis. Sie wendet sich an ihre Tochter, fährt ihr über den Haarschopf, der sich ihr aber entzieht, schon ist das Mädchen weg.
Die Verliebten schichten auf einem Sitz Münzen aufeinander. Fasziniert schaut das Mädchen zu. Dann rennt es zur Erdkugel, zu seiner Aufgabe, verteilt von neuem Geld, macht selber kleine Haufen, es ist sich der Hilfe dutzender Hände gewiss, die aufklauben, anhäufen, etwa die jungen Männer, die ihm zurufen, sobald eine Handvoll Geld transportbereit ist. Sofort ist es zur Stelle. Es tauscht den Tiger gegen Geld. Er passe gut auf ihn auf, versichert ihm der eine und nimmt ihm das Stofftier ab. Zusammen gehen sie zur Erdkugel. Das Mädchen langt über den Äquator und wirf das Geld in die Erde.
«Achtung: alle Passagiere abfliegend nach Fuerteventura sind gebeten, sich zum Ausgang A84 zu begeben. Ich wiederhole: alle Passagiere abfliegend nach Fuerteventura sind gebeten, sich zum Ausgang A84 zu begeben», ertönt nun die Stimme vom Desk.
Letzte Passagiere treffen ein. Die Damen winken sie energisch zu sich, bemüht zu verhindern, dass auch sie stehen blieben, schlimmer noch, dass auch sie mitmachen bei diesem ganzen Zirkus. Zwar abgelenkt von den sich ungewohnt verhaltenden Menschen zücken diese ihre Boarding Cards und lassen sich durch die Absperrung schleusen. Dahinter aber ein Blick zurück, sich vergewissernd, dass wahr ist, was sich am Gate A84 abspielt. Sie verschwinden im Fingerdock.
Die Stimme aus dem Lautsprecher insistiert: «Passagiere am Gate A84 sind gebeten, sich sofort zum Einsteigen zu begeben. Ich wiederhole, Passagiere am Gate A84 sind gebeten, sich sofort zum Einsteigen zu begeben».
Die Durchsage verfehlt ihre Wirkung. Die allermeisten Passagiere haben Flug WK212 vergessen. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem Geld, der Erde. Sie sind sehr vertieft. Die Damen erklären einem Steward von Edelweiss, was geschehen ist. Er gibt Anweisungen. Noch eine Durchsage. «Achtung, dies ist der letzte Aufruf für Passagiere fliegend nach Fuerteventura. Ausgang A84 schliesst in wenigen Minuten».
Der ältere Mann nickt den Damen freundlich zu, als er am Desk vorbeigeht. Er hat bei der Fensterfront das Banner geholt. Er bringt es dem Mädchen, das bei der Frau im olivgrünen Mantel steht, die noch immer die nach hinten geklappte Nordhalbkugel stützt. Sie liegt auf ihren Händen wie eine kostbare Gabe, ein Täufling, eine Krone auf weinrotem Samtkissen. Die jungen Männer schütten ihr Sammelgut in die Erde. Schnell getan. Nun Betätscheln des Stofftieres im Arm des Kollegen, ein denkwürdiger Anblick. Schon ist ein Handy in Position. Mit einem Stofftier mag dieser nicht fotografiert werden. Er dreht sich zur Seite. Will dem Mädchen den Tiger zurückgeben, als sie ihn schubsen. Eine boshafte, kleine Provokation. Der junge Mann holt aus, zur Revanche, die anderen sind schneller. Er bekommt einen Stoss in die Brust, stolpert rückwärts, kracht in die Südhalbkugel, die Frau kreischt, lässt die Nordhalbkugel los, das Scharnier reisst ab, die Erdhälften schnellen durch die Luft, ohrenbetäubendes Klirren beim Aufprall. Während die Südhalbkugel liegen bleibt, ein Spinnennetz feinster Risse das Plexiglas überzieht, schlittert der Norden mehrere Meter weit. Überall glänzt Geld. Ein Aufschrei. Bestürzung. Nun ist die Erdkugel definitiv kaputt.
Dann aber setzt ein Raunen ein. Etwas Befremdliches erregt die Aufmerksamkeit der Menschen. Die Kontinente, vor allem die Landmasse der Nordhalbkugel, fangen an zu leuchten, zaghaft zuerst, dann unübersehbar. Das fahle Gelb wird voller, kräftiger, wird zu einem pochenden Gelb. Spätestens jetzt bemerken es alle. Eine optische Täuschung? Sogleich verliert das Gelb wieder an Intensität, erbleicht, scheint sich abzuschwächen, um, sobald am Tiefpunkt angelangt, wieder zu erstarken. All dies erinnert an das Hinterteil eines Glühwürmchens in dunkler Nacht. Harmlos. Lockend. Der Fingerzeig einer höheren Macht? Ein Vorzeichen ganz bestimmt. Für das, was folgt, für das Unvorstellbare, das an diesem Morgen geschieht. Was passiert, ist vergleichbar mit einem unsichtbaren Dirigenten, der sein Zeichen zum Einsatz gibt. Das Zeichen zum finalen Paukenschlag.
Es kommt aus dem Nichts, das Erstarren. An Gate A84 erstarren alle Menschen in ihren Bewegungen. Der ältere Herr beginnt zu lächeln. Den Arm noch ausgestreckt, das Banner dem Mädchen überreichend, in der Luft bleibt sein Arm hängen. Die Mutter des Mädchens will etwas sagen. Den Mund leicht geöffnet, ihr Mund bleibt seltsam verzerrt. Eine der Frauen senkt den Kopf. Als verneigte sie sich. Der Scheitel auf ihrem Kopf ein weisser Strich. Jemand kratzt sich am Hals, jemand bückt sich, jemand reibt sich im Auge. Die kleinsten Bewegungen, sämtliche Regungen werden festgezurrt im Augenblick, auch die Laute, alle Geräusche. Sie sind weg. Verschluckt. Nur draussen hört man die Triebwerke eines Flugzeugs aufheulen.
Der Blick des Mädchens – soeben noch Stolz darin, Freude, das Banner halten zu dürfen – der Blick des Mädchens ist dunkel und matt. Erloschen.
 Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.
Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.
Website der Autorin















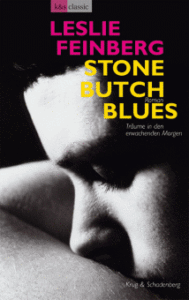

 „Was uns betrifft“ betrifft mich, betrifft jeden, der Laura Vogts Roman liest. Vielleicht, weil das Buch von den Urängsten einer jungen Frau erzählt, einer werdenden und gewordenen Mutter. Vielleicht weil der Roman nichts beschönigt und Fragen stellt. Vielleicht weil Ihr Roman derart ehrlich ist, nicht verklärt und idealisiert. Vielleicht aber auch, weil Laura Vogt einen Roman geschrieben hat, den sie nie hätte schreiben können, wäre sie nicht selbst Mutter geworden.
„Was uns betrifft“ betrifft mich, betrifft jeden, der Laura Vogts Roman liest. Vielleicht, weil das Buch von den Urängsten einer jungen Frau erzählt, einer werdenden und gewordenen Mutter. Vielleicht weil der Roman nichts beschönigt und Fragen stellt. Vielleicht weil Ihr Roman derart ehrlich ist, nicht verklärt und idealisiert. Vielleicht aber auch, weil Laura Vogt einen Roman geschrieben hat, den sie nie hätte schreiben können, wäre sie nicht selbst Mutter geworden.  Schon die erste Szene im ersten Teil ihres Romans fährt einem in den Unterleib. Rahel, die junge Protagonistin sitzt in einer Lesung und mir wird geschildert, wie sich in ihrem Unterleib ein männliches Spermium mit der Eizelle Rahels vereint. Als hätte man dem Erzählmotor schon zu Beginn eine Einspritzung verpasst. Ein Einstieg, der einem als Bild unauslöschlich hängen bleibt.
Schon die erste Szene im ersten Teil ihres Romans fährt einem in den Unterleib. Rahel, die junge Protagonistin sitzt in einer Lesung und mir wird geschildert, wie sich in ihrem Unterleib ein männliches Spermium mit der Eizelle Rahels vereint. Als hätte man dem Erzählmotor schon zu Beginn eine Einspritzung verpasst. Ein Einstieg, der einem als Bild unauslöschlich hängen bleibt. Es sind drei Frauen im Roman der jungen Ostschweizerin; Verena, die an Krebs erkrankte Mutter, Rahel die Protagonistin und Fenna ihre Schwester. In keinem der drei Frauenleben scheinen Männer eine wirklich gute Rolle zu spielen. Martin, Rahels Freund setzt sich ab. Verena trennt sich von Erik, Rahels Vater, schon früh. Und Fenna kämpft sich an Luc ab. Als ob unter allem die Einsicht stünde, dass Beziehungen zwischen Menschen permanentes Wagnis sind und bleiben. Vielleicht sogar die Mahnung, endlich von den festgefahrenen Vorstellungen von „Familie“ Abstand zu nehmen.
Es sind drei Frauen im Roman der jungen Ostschweizerin; Verena, die an Krebs erkrankte Mutter, Rahel die Protagonistin und Fenna ihre Schwester. In keinem der drei Frauenleben scheinen Männer eine wirklich gute Rolle zu spielen. Martin, Rahels Freund setzt sich ab. Verena trennt sich von Erik, Rahels Vater, schon früh. Und Fenna kämpft sich an Luc ab. Als ob unter allem die Einsicht stünde, dass Beziehungen zwischen Menschen permanentes Wagnis sind und bleiben. Vielleicht sogar die Mahnung, endlich von den festgefahrenen Vorstellungen von „Familie“ Abstand zu nehmen.






 Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.
Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.
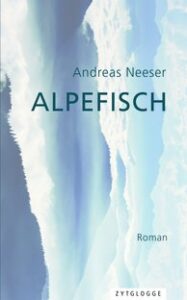
 Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.
Andreas Neeser, geboren 1964, studierte Germanistik, Anglistik und Literaturkritik an der Universität Zürich. Von 2003 bis 2011 Aufbau und Leitung des Aargauer Literaturhauses Lenzburg. Seit 2012 lebt er als Schriftsteller in Suhr. Für sein formal und inhaltlich vielfältiges Werk wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bedacht.
 Ein Haus auf dem Land, ein Mann, ein Kind – ist es das, was Rahel sucht, als sie hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren.
Ein Haus auf dem Land, ein Mann, ein Kind – ist es das, was Rahel sucht, als sie hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren.



 Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.
Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.
 Laura Vogt, 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.
Laura Vogt, 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.



