Manchmal werde ich für meine Weigerung, Krimis zu lesen, bestraft. Obwohl man mit der Gattungsbezeichnung „Krimi“ im Fall von Max Annas Büchern wohl nicht gerecht wird. „Der Hochsitz“ ist eine Gesellschaftsanalyse der späten Siebziger, stierem Spiessbürgertum und der allgegenwärtigen Angst vor dem Bösen, die nicht nur bei den Nachbarn oder weit weg stattfinden kann.
Frühlingsferien 1978 in einem kleinen Nest in der Eifel, nahe an der Grenze zu Luxemburg. Sanne und Ulrich sind elf und haben Zeit, unendlich viel Zeit. Wenn sie nicht auf „ihrem Hochsitz“ über ihrem Dorf sitzen, dann streifen sie durch den Ort, auch mal in den kleinen Laden von Trines, die sie Hanukas klauen lässt, in denen immer ein Bildchen von der kommenden Fussballweltmeisterschaft in Argentinien steckt. Die Jungs im Dorf bekommen sogar mehr Taschengeld, um ihre Alben mit den Fussballern zu füllen. Sanne und Ulrike klauen sie und kleben sie oben auf ihrem Hochsitz in ein getarntes Heft. Voll wird es nicht werden, schon gar nicht in diesen Frühlingsferien. Und weil es neben Ronnie Worm, Rudi Kargos, Harald Konopka, Hansi Müller, Rainer Bonhof und Karl-Heinz Rummenigge noch Platz hat, kleben sie auf die leeren Stellen die ausgeschnittenen Gesichter vom RAF-Fahndungsplakat, das sie ebenfalls geklaut haben. Aber es sind nicht nur die Gesichter der Fussballer und Terroristen, die in diesem Frühling die sonst tote Zeit füllen.
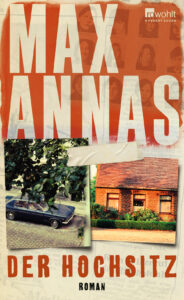
Im Nachbarort passiert ein Banküberfall und eines Nachts, Ulrike übernachtet bei Sanne, beobachten die beiden Mädchen in einer durchquatschten Nacht auf der Strasse vor dem Haus, wie ein Mann von seinem Motorrad kippt und eine Gestalt in Mantel und Hut mit einem Gewehr den am Boden liegenden exekutiert. Aber Sanne und Ulrike bleiben auf dem hocken, was sie gesehen haben und erzählen wollen, denn niemand glaubt ihnen, nicht einmal die Mütter, die Väter schon gar nicht. Wer glaubt schon kleinen Mädchen. Zudem fährt seit ein Paar Tagen ein übergrosser Cadillac durch die Dörfer an der Grenze. Betont langsam und immer wieder an Orten Pause machend, an dem das unpassende Gefährt gesehen werden muss. Ein Mann, der im Fond sitzt, lässt sich von Hof zu Hof chauffieren und bietet den Besitzern für Haus und Grund Summen, die träumen lassen, die einen von einer rosigen Zukunft, die anderen über die Gründe, warum der Mann noch nicht auftauchte oder dem einen viel mehr bieten sollte als ihnen.
Es kocht im Dorf, in dem sonst nie etwas passiert. In dem jede und jeder jede und jeden kennt, ausser die Hinzugezogenen. In einem Dorf, in dem alle fast allen alles zutrauen. Der verrückten Gaby Teichert, die schon seit Jahren allein im Haus am Bach lebt und immer wieder mal nur in Mantel und Schlapfen an den Füssen zum Bach geht, um sich platt Gesicht voran ins kniehohe Wasser zu schmeissen. Vor Jahren fuhr ihr einziger Sohn ohne zu bremsen gegen einen Baum und der Mann weg. Aber ganz bestimmt die Peters vom Petershof. Die drei Brüder, von denen der jüngste Peter heisst, die aber auf dem Hof schon lange nichts mehr auf die Reihe bringen, es zuerst mit Zigarettenschmuggel versuchten, um dann später härteres Zeug über die Grenze zu bringen. Und als man wegen des Banküberfalls den langhaarigen Lehrling, der noch nicht lange frisch im Dorf wohnt und den jungen Frauen den Kopf verdreht, festnimmt, wo doch Sanne und Ulrike in einer Scheune ganz deutlich sahen, dass dieser sich mit ganz anderen Dingen leidenschaftlich beschäftigte, ist für die beiden Mädchen klar, dass die den Geheimnissen im Dorf auf die Spur kommen wollen. Auf ihre Art und Weise. Denn elfjährige Mädchen sieht man nicht.
Max Annas ist einer, der in seiner Hexerküche sitzt und mit List und grenzenlosem Vergnügen an den vielen kleinen Feuern werkelt, über denen die giftig explosiven Tinkturen köcheln, von denen ich als stiller Betrachter nie weiss, wann ihre schlummernde Gewalt ausbricht. Max Annas experimentiert mit den Untiefen menschlichen Seins in einem Dorf „am Ende der Welt“. In diesem kleinen Dorf in der Eifel, in dem jedes fremde Auto wie ein Eindringling wahrgenommen wird, hat Max Annas Lunten ausgelegt, verschlungen und versteckt, die alle gleichzeitig brennen, von denen ich als Leser genau weiss, dass irgendwo Dynamitstangen liegen, die zu explodieren drohen. „Der Hochsitz“ ist ein literarischer Flickenteppich, der sich vor meinen Augen zusammenwebt, der mich atemlos und fasziniert lesen lässt, weil der Roman viel mehr ist, als ein „Krimi“ aus Sicht des Ermittlers.
Wenn ich nun eines sicher weiss: Es gibt noch mehr von Max Annas!
Interview:
Obwohl ich noch nie in der Eifel war, bin ich es literarisch immer wieder. Erst mit den Romanen von Norbert Scheuer, den ich sehr verehre und nun mit Ihnen. War es einfach die nahe Grenze zu Luxemburg? Der ideale Kontext? Maximale Provinz? Oder doch eigene Erfahrungen, waren sie doch 1978 wenig älter als die beiden Mädchen Sanne und Ulrike?
In dem (fast) nicht genannten Dorf, in dem die meisten Kapitel spielen, ist meine Partnerin aufgewachsen. Die Kapitel, die sich mit den Fussballsammelbildern zur WM in Argentinien beschäftigen, und die Episode mit dem geklauten RAF-Fahndungsplakat sind dokumentarisch. Das ist der Auslöser gewesen für den Roman. Und die Geographie, die Geschichte und die Leute der Gegend hab ich natürlich sehr ernst genommen. Aber Sie haben Recht, ich bin damals nicht viel älter gewesen als die beiden Protagonistinnen. Vieles im Binnenleben der Familie Klein stammt also aus meinem eigenen Aufwachsen, aus der Erinnerung an meine Jugend in Köln, an meine Familie. Politisch, denke ich, waren sich viele Dialoge jener Zeit sehr ähnlich. Das konnte schon mal so wirken wie eine Fortsetzung der Moderationen des ZDF-Magazins unter Gerhard Löwenthal.
Sie bauen ein ganzes Dorf. Ein paar alt eingesessene Bauernfamilien, gescheiterte und gestandene, Zugezogene, Verschrobene, Verschlossene, Verrückte, Versteckte, ein Polizist, ein paar Grenzer und mittendrin zwei Mädchen. Sie erzählen aus allen möglichen Perspektiven. Wie bauen sie eine solche Geschichte? Wächst das nach und nach oder folgt die Geschichte einem Plan?
Tastend. Oder: Sowohl als auch. Ich baue eine solche Geschichte langsam und schreibend. So wie jeder neue Roman ein neues Vorgehen und einen neuen Plan braucht, so gibt es sicher Gemeinsamkeiten hinter den individuellen Plänen. Ein ganz und gar durchgeplotteter Roman, der alle Kapitel schon kennt, erscheint mir für den Schreibprozess nicht interessant. Ich muss mich mit den Figuren suchend im Terrain bewegen, mit ihnen im Dialog stehen. Vor allem mit den wichtigsten Figuren. Aber es gibt stets auch andere Fixpunkte. Bei «Der Hochsitz» war vom Beginn des Schreibens an klar, dass ich mich auf diesen doppelten Showdown zu bewegen würde.
Es ist die grosse Geschichte die fasziniert, ebenso die Kulisse, in der sie spielt. Aber auch die vielen kleinen Geschichten, sei es die Geschichte einer Mutter, die Mann und Sohn verliert, jeden Halt und irgendwie auch den Verstand. Oder die Minigeschichten wie die der beiden Mädchen, wie sie im Hochsitz Fussballerbildchen neben Fahndungsfotos von RAF-Terroristen kleben. Mussten Sie sich zusammenreissen, um sich nicht zu verlieren?
Die ganze Geschichte ist nur so gut wie deren einzelne Teile. Das Wunderbare an ihnen ist nun, das sie gar nicht ohne einander existieren können. Alles geschieht neben- und über- und gegen- und miteinander. Die Erzählebenen kreuzen sich, widersprechen sich, belauern sich beinah. Was ich in der inneren Stimme nicht erfahre, lerne ich dann durch die äußere Betrachtung. Drei Kapitel später. Der Prozess selbst, das Schreiben: Aufregend.
Damals hatten Kinder, wenn sie ihre Aufgaben in Haus oder Hof hinter sich hatten, Freiheiten, die Kinder heute gar nicht mehr kennen. Ihre Geschichte hätte so in der Gegenwart gar nicht spielen können, wo Eltern ihre Kinder mit dem Auto von der Schule abholen, Kinder in ein eigentliches Freizeitprogramm gepresst werden, um sie ja nicht auf „dumme Gedanken“ kommen zu lassen, in den Ferien in Kurse, ein Camp oder in ein Ferienressort mit Unterhaltungsmaschinerie. Die gute, alte Zeit?
Sicher ist «Der Hochsitz» ein Buch über das Erinnern. Hier und da möglicherweise ein Reflex auf die rechte Forderung, es möge alles so bleiben, wie es ist. Dann schauen wir doch einmal darauf, wie es gewesen ist. Werfen wir einen Blick in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland in der zeitlichen Mitte ihrer Existenz, der relativ kurzen sozialdemokratischen Phase. Und atmen wir also die Luft der guten alten Zeit. – Auf der anderen Seite war es für mich interessant, nach zwei Büchern, die in der DDR spielen, den Blick auf Westdeutschland zu justieren. Herauszufinden, wie sich mit dem Schreiben über das andere Deutschland der Blick aufs Eigene entwickelt.
Und auf der anderen Seite begegnet man in ihrem Roman all jenen, die durch die Zeit, durch die Maschen fallen. Denen, die es nicht schaffen, ob privat oder geschäftlich, in der Beziehung oder vor dem Spiegel. Ist Schreiben auch ein Mittel des Trosts?
Trost, natürlich, immer. Für den Autor. Er speist sich aus der Gewissheit, dieser Zeit lebend entkommen zu sein, lebend und lebendig. Vielleicht fehlt mir im Blick auf diese Zeit die Fähigkeit, jene zu sehen, die nicht durch die Maschen fallen. Liegts am Autor? Aufgewachsen in der Arbeiterklasse, prekär. Gut möglich. Liegts an der Zeit? An den falschen Versprechen, die samt und sonders bald wieder gebrochen werden sollten. Die Sicherheit, die soziale. Das Teilen. Das gesellschaftliche Miteinander. Alles gelogen. Alles aufgehoben.
Eine Figur in ihrem Roman erinnert ein bisschen an Dürrenmatts alte Dame. Ein Mann mit Geschichte kurvt in einem gemieteten Cadillac mit Chauffeur durch die Gegend und täuscht Kaufabsichten bei einer ganzen Reihe von Höfen vor. Was wie eine Einkaufstour ohne sichtbare Strategie aussieht, hetzt das Dorf, Nachbarn gegeneinander auf. Neid, Missgunst artet in Gewalt aus. Zufall?
Den Dürrenmatt kenne ich am besten über den Umweg via Senegal. Djibril Diop-Mambetys Verfilmung HYÈNES von 1992 war mir ein Fixpunkt in der Beschäftigung mit dem Kino des afrikanischen Kontinents. Aber der Stoff hat als Vorlage eigentlich keine Rolle gespielt. Das liegt an dem Fokus auf dem Chauffeur, der diese Erzählebene zieht. Der Mann, über den er uns erzählt, bleibt für uns im Undeutlichen, weil es der Chauffeur selbst ist, der nicht versteht. Ich bauchte hier einen Vermittler, der nichts zu vermitteln hat. Einen, der Augen hat, aber nicht sieht. Und damit gewiss nicht allein steht.
Müssen Sie Briefe aus der Eifel fürchten?
Tweets vielleicht? Grimmiges Gezwitscher aus der Eifel? Ich habe meine Premierenlesung in der Eifel gehabt, in Hillesheim, das ist ein paar Mal zehn Kilometer vom Schauplatz des Romans entfernt, da war alles ganz friedlich und freundlich. «Der Hochsitz» ist ja auch kein Schlüsselroman über die Eifel. Er nutzt das dort eigene, um darüber hinaus zu schauen. Dorf, Grenze, sich verändernde Strukturen, Mädchenleben im Aufbruch. Aber ich nehm die Briefe gern in Empfang. Furchtlos.
Max Annas, geboren 1963, arbeitete lange als Journalist, lebte in Südafrika und wurde für seine Romane «Die Farm» (2014), «Die Mauer» (2016), «Finsterwalde» (2018) und «Morduntersuchungskommission» (2019) sowie zuletzt «Morduntersuchungskommission: Der Fall Melchior Nikolai» (2020) fünfmal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Bei Rowohlt erschien ausserdem «Illegal» (2017).
Beitragsbild © Max Annas









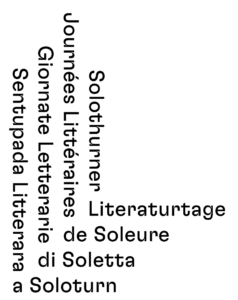
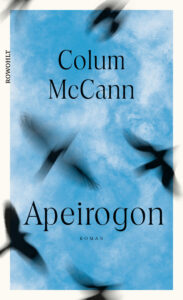










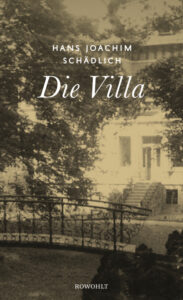






 für Demenzkranke am Rhein. David Wagner schildert Begegnungen, in denen er Dialoge in Echtzeit erzählt, wie sich Wiederholungen immer mehr ausbreiten, die Entfernung aus der Gegenwart immer grösser wird. David Wagner tut dies so schlicht und geradlinig, dass ich mich tief in die Begegnungen hineingezogen fühle, ohne dass der Schriftsteller je in eine sentimentale Ebene abrutschen würde. Ich werde unmittelbarer Zeuge eines Verschwindens. Ich werde durch die immer gleichen Fragen des Vaters, der äusserlich noch immer rüstig und agil erscheint, durch die herzlich hartnäckigen Antworten des Sohnes tief in dieses Gefühl hineingesogen, als würde die Insel im Meer des Vergessens Stück für Stück wegbrechen und immer kleiner werden. Nur die fernen Streifen in der Vergangenheit, die Bilder aus der Kindheit aus der Familiengeschichte während und nach dem grossen Krieg, sind unmittelbar, als würden sie wie Wetterwolken in die absolute Windstille des Vergessens einbrechen.
für Demenzkranke am Rhein. David Wagner schildert Begegnungen, in denen er Dialoge in Echtzeit erzählt, wie sich Wiederholungen immer mehr ausbreiten, die Entfernung aus der Gegenwart immer grösser wird. David Wagner tut dies so schlicht und geradlinig, dass ich mich tief in die Begegnungen hineingezogen fühle, ohne dass der Schriftsteller je in eine sentimentale Ebene abrutschen würde. Ich werde unmittelbarer Zeuge eines Verschwindens. Ich werde durch die immer gleichen Fragen des Vaters, der äusserlich noch immer rüstig und agil erscheint, durch die herzlich hartnäckigen Antworten des Sohnes tief in dieses Gefühl hineingesogen, als würde die Insel im Meer des Vergessens Stück für Stück wegbrechen und immer kleiner werden. Nur die fernen Streifen in der Vergangenheit, die Bilder aus der Kindheit aus der Familiengeschichte während und nach dem grossen Krieg, sind unmittelbar, als würden sie wie Wetterwolken in die absolute Windstille des Vergessens einbrechen.