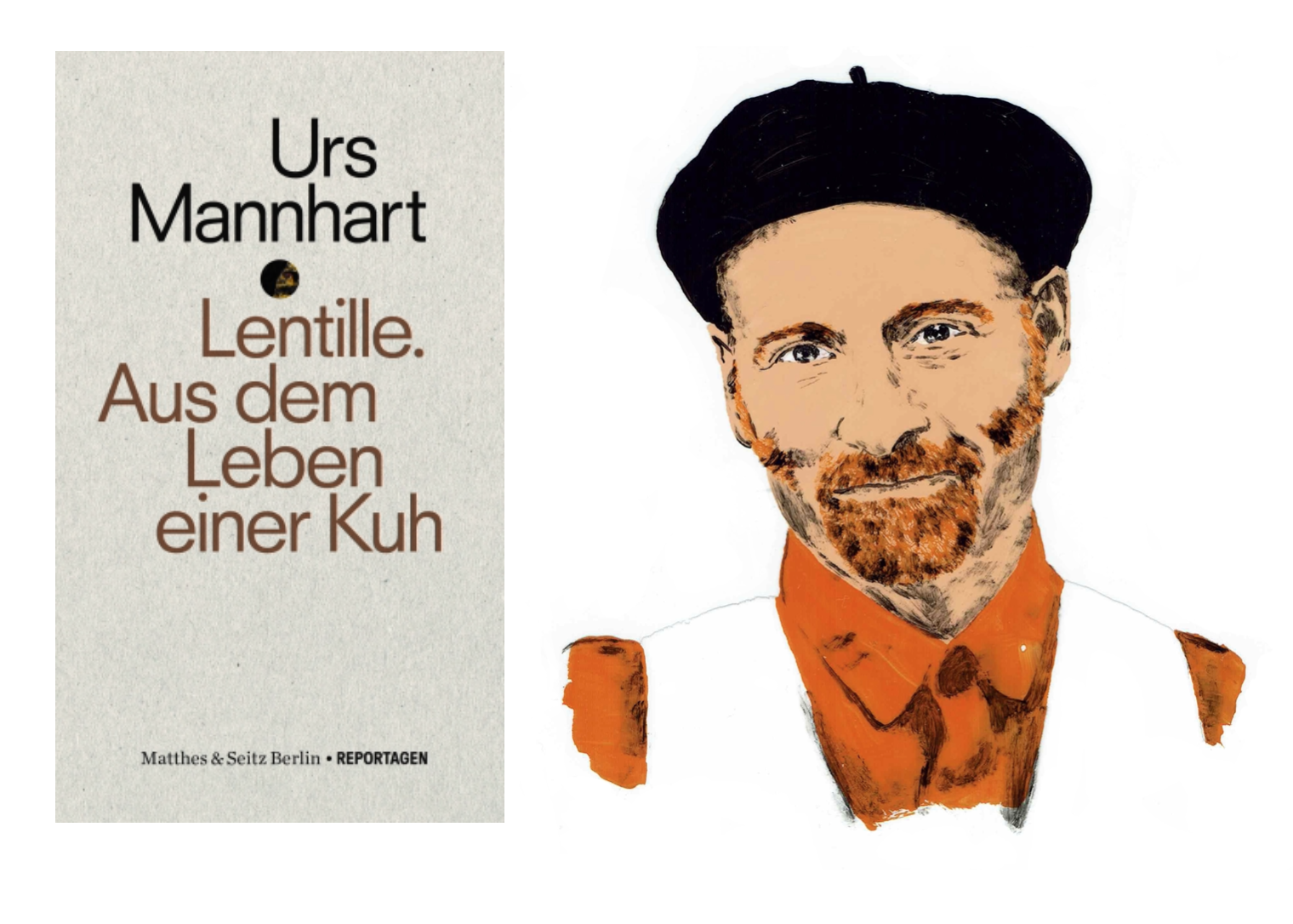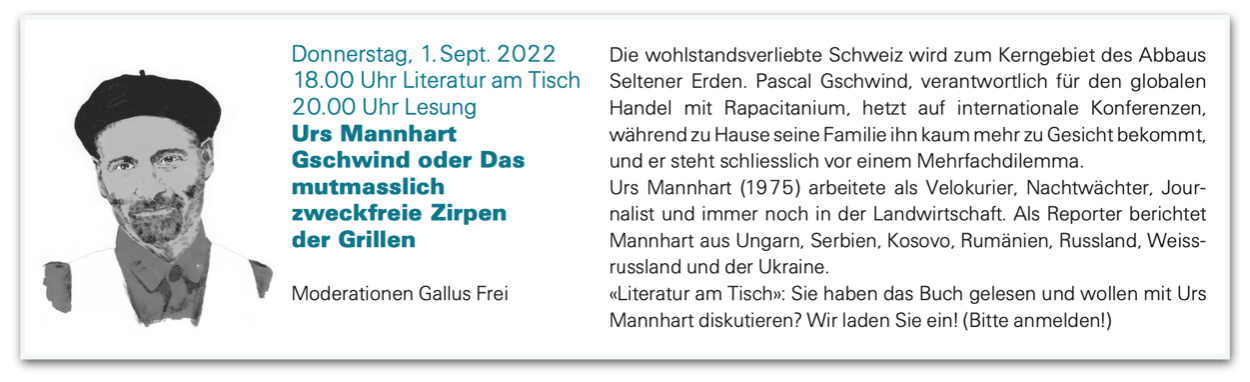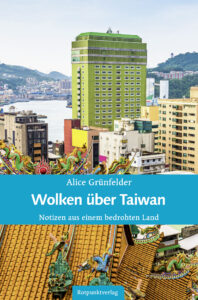In einer Zeit, in der Lesen nicht mehr Pflicht ist, in der Lesen für viele nicht mehr zum Leben gehört, hast du ein besonderes Buch über das Lesen geschrieben. Über Bücher. Über die Verzauberung und Selbsterkundung durch das Buch.
Eine Liebeserklärung an das Buch
Gastbeitrag von Peter Weibel
«Abenteuer Lesen» – Hundert Quellen der Lust und des Erkennens: Eine Reise durch hundert Bücher, die dein Leben geprägt haben. Zu hundert Autorinnen und Autoren, die man sprechen hört, die uns zum Lesen auffordern. Eine Reise zur verborgenen Seele der Bücher. Jedes Buch hat eine Seele. Die Seele dessen, der es geschrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen und erlebt und von ihm geträumt haben (Carlos Ruiz Zafon). Du schreibst keine Rezensionen. Du schreibst über deine Emotionen. Darüber, was dich in einem Buch bewegt hat und warum. Was dich berührt hat. Du schreibst es zu Recht und nachdrücklich: Von Bedeutung ist nicht die literaturkritische Wertung eines Buches, von Bedeutung ist, ob wir vom Buch berührt werden. Denn wir werden berührt, wenn wir in einem Buch Teile unserer eigenen Geschichte wiederfinden.
Jedes Buch hat eine Aura. Der Ort und die Stimmung dort, wo wir es zum ersten Mal gelesen haben. Der Sog in die eigene Lebensgeschichte hinein. Die Entdeckung klingender Passagen, Wortperlen beim zweiten Lesen. Und manchmal auch die Entfernung beim Lesen nach zwanzig Jahren, die unsere Berührbarkeit verändert haben.

«Abenteuer Lesen. Hundert Quellen der Lust und der Erkenntnis», Edition Exodus, 2025, 527 Seiten, CHF ca. 42.00, ISBN 978-3-907386-06-4
Natürlich sind unter den hundert Büchern auch grosse Werke, die man kennt. (Oder zu kennen glaubt.) Thomas Mann. Lew Tolstoi. Max Frisch. Aber auch längst vergessene Trouvaillen sind dabei. Die an Muskelschwund leidende Autorin Ursula Eggli, die 1977 in «Herz im Korsett» eine Lanze für die Rechte von Behinderten und Frauen gebrochen hat, als die Gesellschaft dazu noch nicht bereit war. Oder der radikale Zeitgenosse und wilde Alpinist Hans Morgenthaler mit «In der Stadt».
Bücher erzählen die Zeitgeschichte eindringlicher als jeder Geschichtsunterricht. Wer das Buch «Mila 18» über den jüdischen Aufstand im Wahrschauer Ghetto von Leon Uris gelesen hat, wird die Wunden der Vergangenheit nie mehr los. Wer mit Hemingways «Wem die Stunde schlägt» in den spanischen Bürgerkrieg gezogen ist, begreift das zerrissene Spanien von heute.
Bücher spiegeln die Weltgeschichte – die Auswahl deiner hundert Bücher spiegelt die biografische Spannweite der Nachkriegsgeneration. Und deine persönliche Biografie. Hans Magnus Enzensbergers «Kurzer Sommer der Anarchie» hat dich früh politisiert. Heinrich Harrers Buch über die Tragödien der Eiger Nordwand «Die weisse Spinne» hat deine Leidenschaft für die Berge erstaunlicherweise nicht gebrochen. Hat dich womöglich dazu bewegt, später Bergführer zu werden. Wittgensteins rätselhaftes Werk «Traktats Logico-Philosophicus», das kaum einer entschlüsseln kann, hat dich zur Wahrscheinlichkeitstheorie geführt. Caroline Alexanders Buch «Die Endurance» über Shackletons Überlebenskampf in der antarktischen Eishölle hat das Geheimnis der Führungskunst und den Glauben, dass auch Unmögliches möglich werden kann, geprägt.
Ich weiss nicht, wie du es geschafft hast, hundert Bücher ein zweites oder drittes Mal nochmals zu lesen, das sind vielleicht dreissigtausend Seiten, wahrscheinlich mehr. Und darüber ein fünfhundertseitiges Buch zu schreiben. Aber du hast es geschafft. Und es ist ein einzigartiges Buch über den unermesslichen Reichtum der Bücherwelt geworden. Eine Liebeserklärung an das Buch. Wenn von vielen Leserinnen und Lesern jede auch nur fünf Bücher wiederentdeckt, werden tausende vergessene Bücher in die Gegenwart zurückkehren. Nicht nur, aber auch deshalb muss man «Abenteuer Lesen» allen ans Herz legen, die noch lesen wollen.
Benedikt Weibel, geboren 1946, war von 1993–2006 Chef der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Als Publizist schreibt er Kolumnen. Ausserdem hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter «Simplicity – die Kunst, die Komplexität zu reduzieren» (Zürich 2014), «Das Jahr der Träume 1968 und die Welt von heute» (Zürich 2017), «Wir Mobilitätsmenschen. Wege und Irrwege zu einem nachhaltigen Verkehr» (Basel 2021).
Beitragsbild © Michael Stahl




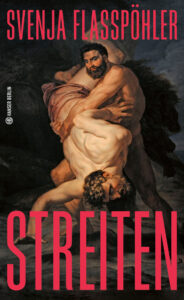


 Auch Helena Schätzle machte diese Erfahrung, begegnete dem als Fotografin in ihrer ganz speziellen Art. Das wenige, das ihr Grossvater, der im 2. Weltkrieg als Maschinengewehrsoldat an der russischen Front teilnehmen musste, das, was er von seiner langen Flucht aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause erzählte, nahm sie als Anlass zu einer Reise zurück in die Zeit, einer Reise mit ihrer Fotokamera. Sie fuhr 9645 Kilometer kreuz und quer durch Osteuropa, um nach Menschen, Landschaften, Bildern zu suchen, die etwas von dem verraten, was im Schweigen ihres Grossvaters zu versinken drohte.
Auch Helena Schätzle machte diese Erfahrung, begegnete dem als Fotografin in ihrer ganz speziellen Art. Das wenige, das ihr Grossvater, der im 2. Weltkrieg als Maschinengewehrsoldat an der russischen Front teilnehmen musste, das, was er von seiner langen Flucht aus der Kriegsgefangenschaft zurück nach Hause erzählte, nahm sie als Anlass zu einer Reise zurück in die Zeit, einer Reise mit ihrer Fotokamera. Sie fuhr 9645 Kilometer kreuz und quer durch Osteuropa, um nach Menschen, Landschaften, Bildern zu suchen, die etwas von dem verraten, was im Schweigen ihres Grossvaters zu versinken drohte.



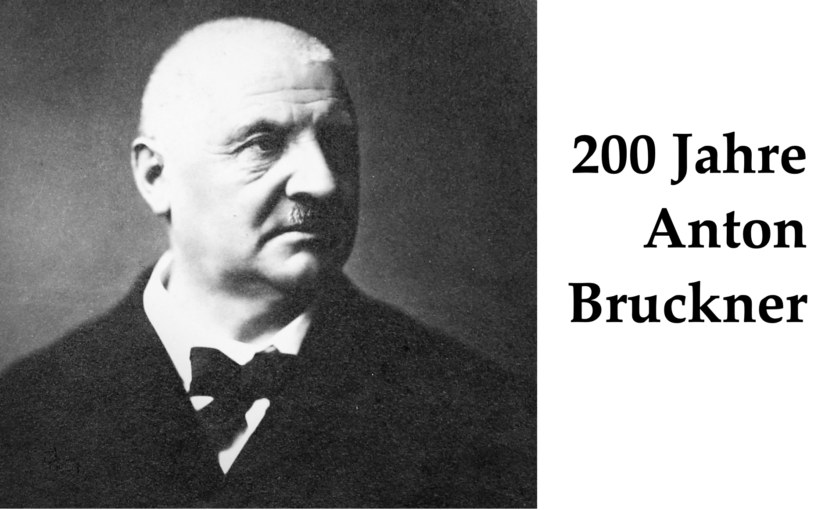
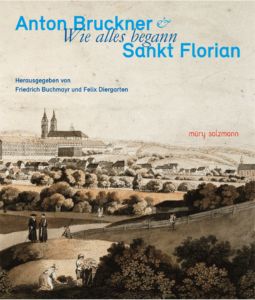

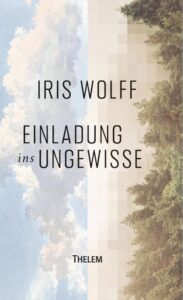




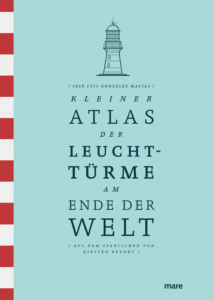
 Die Namen der Orte, an denen die Leuchttürme stehen, lesen sich wie eine Kette kantiger Steine: Clippeton, Erded Rock, Great Isaac Cay, Maatsuyker, Robben Island… „Der Leuchtturm am Ende der Welt“ ist ein Mahnmal für all jene Orte und Menschen, die der stürmischen See und mit einem solchen Buch dem globalen Vergessen trotzen.
Die Namen der Orte, an denen die Leuchttürme stehen, lesen sich wie eine Kette kantiger Steine: Clippeton, Erded Rock, Great Isaac Cay, Maatsuyker, Robben Island… „Der Leuchtturm am Ende der Welt“ ist ein Mahnmal für all jene Orte und Menschen, die der stürmischen See und mit einem solchen Buch dem globalen Vergessen trotzen.