Robert Akeret macht sich auf, auf eine lange Reise. Nicht zur Erholung, nicht einmal auf die Suche nach dem Glück. Robert Akeret will seinem kleinen Leben Bedeutung verschaffen. Er will ein Grundstein der Wissenschaft werden, sein Name ein Denkmal, das bleiben soll.
Robert Akeret bezeichnet sich selbst als Kryptozoologe („Lehre von den versteckten Tieren») und schimpft seine Gegenwart, dass nicht längst an jeder Universität ein Lehrstuhl dieser Wissenschaft vertreten ist. Er hält nichts von der eidgenössischen Bescheidenheit, der Abneigung gegen das Weitschweifende, Weltumspannende. „Ein Leben ohne Zuschauer» sei sinnlos. Er macht sich auf, jenes Lebewesen zu finden, dass das Bindeglied zwischen Mensch und Tier sein soll. Jenes Lebewesen, das man in Vietnam Nguoi Rung nennt, in China Deren, Alma im Altaigebirge, Batutut auf Borneo oder Orang Pendek auf Sumatra.
Insel der unbegründeten Hoffnung
Lukas Maisel siedelt seinen farbigen, üppigen und verspielten Roman in naher Zukunft an, einer Zeit, die aus dem Flughafen und der Stadt Dubai eine heruntergekommene, kaputte Destination macht, ohne zu erzählen, was die Welt derart veränderte. Akeret schliesst sich zusammen mit Blum, einem Studenten der Ethnologie, einem jungen, empfindsamen Mann, der auf dieser Reise, deren Zweck Akeret im Dunkeln lässt, unbekannte Sprachen, Geheimsprachen zu erforschen hofft, wie Akeret eigentlich nur weg will und auf die grosse Offenbarung hofft. Als dritten auf dieser Expedition heuert Akeret Mansur an, einem Mann aus Sulawesi, Angehöriger der Bugs, einem alten Seefahrervolk. Und als letzter noch Jonah, einen stillen Maschinisten, Sohn eines Fischers, geflohen, der mit dem umgebauten Schiff mit dem übergrossen Käfig und seinem tuckernden Motor zurecht kommen soll.
So sehr sich Akeret und Blum auf ihre Aufgabe zu konzentrieren versuchen, so ergeben scheinen Mansur und Jonah, scheinbar zufrieden mit der Aufgabe allein, ohne Zukunft, ohne Perspektiven.
Insel des berauschten Paradiesvogels

Akeret war schon als Kind ein Sonderling, einer, der mit seiner Fragerei den letzten Nerv rauben konnte. Einer der sich mit keiner Antwort abspeisen liess, einer, der sich auch in der Schule nicht abspeisen liess. Sein Lieblingsbuch damals war „Das Buch der geträumten Städte“.
Und als Erwachsener schimpft Akeret sie alle, die Lehnstuhlzoologen, die sich fürchten, ihre schlaffen Körper ins Unbekannte zu stürzen. Ob von Erfolg gekrönt oder nicht, Akeret weiss, sie würden schimpfen, ausrufen, denn er hatte nicht studiert und bekannte sich mit Vehemenz zu einer Wissenschaft, die bei Zoologen nur Kopfschütteln verursacht. Aber er würde es ihnen zeigen. Und wenn der Moment des Triumphs kommt, wird das Wesen Homo Akereti heissen! Akeret und Blum belauern sich, jeder wissend, dass das Unternehmen nie ohne den andern gelingen kann. Man misstraut sich, versteckt sich hinter seiner Aufgabe, der ganz persönlichen Aussicht auf den grossen Triumph, jedes Scheitern ausblendend.
Während die Natur immer wilder wird, der Fluss immer schmaler, das Weiterfahren mit der Marie immer schwieriger, während die Eingeborenen immer feindlicher werden, sich das, was ihnen begegnet immer mehr verschliesst, steigert sich Akerets Entschlossenheit. Irgendwann bringen Eingeborene den Forschungsreisenden tatsächlich ein Wesen, weder Mensch noch Tier. Ein eindeutig menschlicher Kopf mit haarigem Rumpf und Fischlaib, zusammengenäht mit grobem Garn. Ein Versuch, die Fremden zu beschwichtigen? Ein Glücksbringer, ein Ningyo? Eine Warnung?
Lukas Maisels Sprache ist wie seine Geschichte von einer anderen Welt, erfrischend altbacken, genauso wie der Protagonist, der in naher Zukunft unterwegs ist, wie die einstigen Entdecker, wohl wissend, wie viel Leid, Zerstörung und Krankheiten sie auslösten – im Dienst von Wissenschaft und Forschung, Eroberung und Status. So sehr es Akeret um die Erfüllung seines Traumes geht, dem Zusammenschluss zwischen seiner ganz eigenen Logik und allgemeingültiger Wahrheit, so geht es Lukas Maisel nicht um das Ziel, nicht um die Erfüllung. Das „Buch der geträumten Inseln“ liest sich tatsächlich wie ein Traum zwischen den Wirklichkeiten. Ein Mann fährt durch seine Welt, ohne je in ihr anzukommen. Die Welt bleibt fremd.
„Ich weiss, wonach ich gesucht habe, wenn ich es finde.“ Unglaublich erfrischend!
Interview mit Lukas Maisel:
80 Prozent der gegenwärtigen AutorInnen beschäftigen sich in ihrem Schreiben in irgend einer Weise mit sich selbst, transformiert oder nicht. Wer weiss, vielleicht ist diese Selbstschau in ihrem Roman so weit verfremdet und verborgen, dass ich an ihr vorbeilese. Umso mehr interessiert mich der Ursprung ihres Romans. Was stand ganz zu Beginn?
Ich habe kein Bedürfnis, etwa meine Familiengeschichte niederzuschreiben. Ich fände es öde, das zu schreiben, und öde, zu lesen. Das ist so eine unnötige Verdopplung der Wirklichkeit, obwohl man doch alle Mittel hätte, eine ganz andere Wirklichkeit zu erschaffen. — Am Anfang dieses Romans standen ein paar Zeilen, die ich am Literaturinstitut in einem Kurs geschrieben hatte. Es gibt darin noch keine Figuren, allein die Bedrohung durch geheimnisvolle Wesen in einem Regenwald. Diese Miniatur hat viele Fragen aufgeworfen, denen ich nachgehen wollte. Es verbanden sich andere Ideen mit dieser, etwa jene von einer Expedition, bei der möglichst viele Insektenarten beschrieben und benannt werden sollten. Ich finde den menschlichen Drang, alles zu benennen, und die Hybris, es auch zu tun, unglaublich faszinierend. Erst später kam dann Robert Akeret hinzu, die Hauptfigur.
Sind Sie zu Recherchezwecken tatsächlich gereist? Und wie weit hat sich ihr Romanvorhaben während dieser Recherchen von seiner ursprünglichen Form entfernt? Oder folgten Sie einem (ge)strickten Plan?
Ja, ich bin gereist, auf die indonesischen Inseln Sumatra, Sulawesi und Ternate, auch auf Waigeo, das zum indonesischen Teil Neuguineas gehört. Auf Ternate gibt es den Vulkan Gamalama, auf den mich ein barfüssiger Führer gebracht hat, der ständig Nelkenzigaretten rauchte: das Urbild Jonahs, einer der Figuren im Roman. Auch auf Sulawesi verbrachte ich einige Zeit, um Mansur nachzuspüren, dem indonesischen Helfer der Expedition. Es geht um Details, aber Details sind alles in einem Roman. Der Kern des Romans hat sich dabei kaum verändert.
Die verbissene Suche nach etwas, was vielleicht nicht einmal sein kann, dass sich allen Wahrscheinlichkeiten entzieht, ist ein weit verbreitetes Phänomen. All die aktuellen Verschwörungstheorien sind Beispiele genug. So wie der Abenteurer Robert Akeret über die Lehnstuhlzoologen schimpft, schimpft der Verschwörungstheoretiker auf den Mainstream, die Wissenschaft, die Politik. Ist dieses „Aufsitzen“ nicht ein urmenschliches Bedürfnis? Ein Stück Zuhause?
Das wiederkehrende Narrativ ist: Nichts sei, wie es scheint, die vorherrschende Meinung sei falsch. Das würde auch Akeret unterschreiben, doch anerkennt er die wissenschaftliche Methode und die durch sie gewonnenen Erkenntnisse. Er glaubt aber, dass die Wissenschaft etwas übersehen hat, das ein unbefangener Laie eher finden kann. Man sieht nur, was man weiss, meinte Goethe.
Frauen scheinen in Ihrem Roman nur eine sehr untergeordnete Rolle zu haben. Ist es, weil die vier Archetypen, die sich auf diese Forschungsreis begeben auch wirklich den verschiedenen, männlichen Archetypen entsprechen?
So ganz stimmt das nicht: Professorin Dr. Unland beansprucht mehrere Kapitel, und auch Margarete ist keine unwichtige Figur. Den Bechdel-Test jedenfalls würde der Roman bestehen.
„Er wusste wohl, dass Scheitern möglich war, ans Aufgeben aber glaubte er nicht. Mit leeren Händen heimzukehren, war keine Möglichkeit.“ Dieses Missionarische. Wie weit gilt dieser Satz auch für die Schriftstellerei, das Leben als „Jungautor“?
Es ist schon so, wie Meister Yoda sagt: »Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.« Natürlich ist Talent ungleich verteilt und wichtig für das Schreiben, aber genauso wichtig ist die Bereitschaft, aus jeder Zurückweisung, jedem Scheitern zu lernen. Ich hatte schon einige Jobs, ich habe in einer Weinabfüllerei, einem Warenlager, einer Druckerei etc. gearbeitet — ich weiss, dass jeder andere Beruf mich langweilen würde, nur das Schreiben nicht. Darum ist jedes Scheitern für mich, wie für Akeret, kein Anlass zu Zweifeln, sondern treibt mich weiter an.

Lukas Maisel, geboren 1987 in Zürich, machte eine Lehre zum Drucker, bevor er am Literaturinstitut in Biel studierte. Für das Manuskript seines ersten Romans, Buch der geträumten Inseln, erhielt er 2017 einen Werkbeitrag des Kantons Aargau und 2019 den Förderpreis des Kantons Solothurn. Er lebt in Olten.



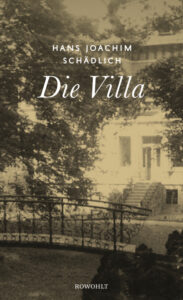






 für Demenzkranke am Rhein. David Wagner schildert Begegnungen, in denen er Dialoge in Echtzeit erzählt, wie sich Wiederholungen immer mehr ausbreiten, die Entfernung aus der Gegenwart immer grösser wird. David Wagner tut dies so schlicht und geradlinig, dass ich mich tief in die Begegnungen hineingezogen fühle, ohne dass der Schriftsteller je in eine sentimentale Ebene abrutschen würde. Ich werde unmittelbarer Zeuge eines Verschwindens. Ich werde durch die immer gleichen Fragen des Vaters, der äusserlich noch immer rüstig und agil erscheint, durch die herzlich hartnäckigen Antworten des Sohnes tief in dieses Gefühl hineingesogen, als würde die Insel im Meer des Vergessens Stück für Stück wegbrechen und immer kleiner werden. Nur die fernen Streifen in der Vergangenheit, die Bilder aus der Kindheit aus der Familiengeschichte während und nach dem grossen Krieg, sind unmittelbar, als würden sie wie Wetterwolken in die absolute Windstille des Vergessens einbrechen.
für Demenzkranke am Rhein. David Wagner schildert Begegnungen, in denen er Dialoge in Echtzeit erzählt, wie sich Wiederholungen immer mehr ausbreiten, die Entfernung aus der Gegenwart immer grösser wird. David Wagner tut dies so schlicht und geradlinig, dass ich mich tief in die Begegnungen hineingezogen fühle, ohne dass der Schriftsteller je in eine sentimentale Ebene abrutschen würde. Ich werde unmittelbarer Zeuge eines Verschwindens. Ich werde durch die immer gleichen Fragen des Vaters, der äusserlich noch immer rüstig und agil erscheint, durch die herzlich hartnäckigen Antworten des Sohnes tief in dieses Gefühl hineingesogen, als würde die Insel im Meer des Vergessens Stück für Stück wegbrechen und immer kleiner werden. Nur die fernen Streifen in der Vergangenheit, die Bilder aus der Kindheit aus der Familiengeschichte während und nach dem grossen Krieg, sind unmittelbar, als würden sie wie Wetterwolken in die absolute Windstille des Vergessens einbrechen.


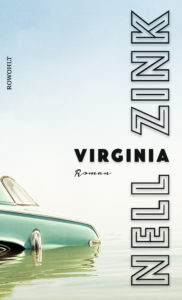 In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.
In ihrem neusten in deutscher Sprache erschienenen Roman „Virginia“ leben die Mutter Peggy und ihre Tochter auf der Flucht aus einer gescheiterten Ehe mit erschwindelten Ausweispapieren als „Schwarze“ unerkannt in einem kleinen Ort in der Pampas, in Virginia, vergessen von der Weissen Seite der Amerikaner. „Virginia“ ist ein Familienroman mit überragendem Sound, ein Amerikaroman über das Leben in einer Kleinstadt im Schatten der grossen amerikanischen Metropolen, ein Identitätsroman über die Fragwürdigkeiten zugeschriebener und zugespielter Identitäten. Ein Roman über zwei Welten, Schwarz und Weiss, zwei Kasten, über eine Frau, die aus der einen Kaste ausbricht, um in der andern unterzutauchen, über Zufall und Glück, die Unmöglichkeiten von Schicksal, Geschlecht und Sexualität. Ein sprachliches Feuerwerk, das man auch in der deutschen Übersetzung von Michael Kellner geniessen kann.
 zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,
zwei neue Bücher zum Entdecken und Vertiefen, zum Geniessen und Eintauchen bereitlagen, nicht nur durch ihr bekanntestes Werk „Warum das Kind in der Polenta kocht“, dass sich bei vielen Leserinnen und Leser tief in die literarische Erinnerung eingegraben hat und von der schwierigen Kindheit der Schriftstellerin erzählt, sondern weil Pedro Lenz, Tanja Maljartschuk und Rolf Hermann ganz oben auf dem Berg in einer Mitternachtslesung unter dem grossen schwarzen Zelt einer sternenklaren Nacht die Texte einer Künstlerin vortrugen. Aglaja Veteranyi, die sich das Lesen und Schreiben als Kind selbst beigebracht hatte, Artistin und Tänzerin war und sich die deutsche Sprache zu ihrem wichtigsten Instrument machte, schuf als Vielschreiberin Kunstwerke, die beim Lesen ebenso schmerzen wie bezaubern,  verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.
verwirren wie erheitern. „Café Papa. Fragmente“ und „Wörter statt Möbel. Fundstücke“ sind gesammelte Texte aus Notizbüchern, Makulaturblättern, Texte voller Witz und Tiefe, Einsichten in die Welt einer Künstlerin, für die Sprache viel, viel mehr als ein Medium war, sondern Manege selbst. Tanja Maljartschuk, die in der Ukraine aufwuchs und studierte, in Wien lebt und schreibend noch immer in das im Würgegriff unversöhnlicher Fronten gefangene Herkunftsland eingreift, nennt Aglaja Veteranyi eine Ecke ihres literarischen Dreigestirns, neben Robert Walser und Peter Bichsel.
 mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!
mit „Nachtleuten“ einen fulminanten Erfolg. Und wer die Schriftstellerin in ihrer leidenschaftlichen und authentischen Art lesen und erzählen hört, ist noch um ein Vielfaches mehr bezaubert und betört vom Feuerwerk aus Sprache, Sprachwitz, Originalität und der scheinbaren Leichtigkeit, die das Erzählen der Meisterin ausmacht. Maria Cecilia Barbetta besuchte die deutsche Schule in Buenos Aires, studierte später Deutsch und kam mit 24 mit einem Stipendium nach Deuschland. „Ich habe mich verliebt in die deutsche Grammatik“, beteuert die Autorin. In „Nachtleuchten“ erzählt Maria Cecilia Barbetta von ihrer Heimatstadt Buenos Aires, von ihrem Viertel Ballester, wo sie aufgewachsen ist. Ein Kosmos der Vielfalt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Ballester ist die Urmutter aller Geschichten und Figuren. Figuren und Orte, die sich aber überall finden, in jeder Stadt, in jedem Ort, auch in Berlin, wo die Autorin seither lebt. „Nachtleuchten“ spielt 1976, am Vorabend des politischen Umsturzes, in einer Zeit, als das grosse Verschwinden begann und in der im Laufe der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 Zehntausende ArgentinierInnen verschwanden. „Nachtleuchten“ ist ein sinnliches Feuerwerk!
 Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.
Leukerbad beweist in eindrücklicher Manier, dass Lyrik nichts mit weltfremden und entrücktem Dichten zu tun haben muss. Seine Gedichte erzählen Geschichten, leuchten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, stellen Fragen, konfrontieren, springen in der Perspektive. Seine Essays spiegeln den Weitblick des Autors, fordern heraus und zeigen, wie Geschichte, Wissenschaft und Gesellschaftskritik konstruktiv provozieren können.
 USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.
USA verlassen hatte, zum andern nimmt sie, ohne es zu wollen, in der kleinen Schule immer mehr eine Sonderstellung ein. Ihr religiöser Eifer, die Tatsache, dass sie Amerikaner(in) ist, ihre Gelehrigkeit und ihr absoluter Wille, ein neues, ganz anderes Leben zu führen, macht aus Aden Suleyman, aus der jungen Frau einen jungen Mann, aus der Flüchtenden eine um jeden Preis gewillte Ankommende. Zwei, die zusammen wegfuhren, sich gemeinsam auf einen Weg machten, entzweien sich mehr, bis hin zur Katastrophe. Je tiefer in der Fremde, je mehr sie eigentlich aufeinander angewiesen wären, desto unvermeidlicher entzweien sie sich, bröckelt Freundschaft.

 Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.
Jenny ist kein Kind mehr. Aber auch von niemandem der Erwachsenen ernst genommen. Im Dorf lebt niemand mit Kindern, ausser die Neuen in einem der Reiheneinfamilienhäuser, die sich aber nie zeigen. Da ist nur Maik, fünf unendlich lange Jahre älter, das Tor zu einer Welt, auf die Jenny aufspringen will, einer Welt, vor der sich Maik fürchtet. Es wird eine Freundschaft, die in den Augen der Erwachsenen keine sein darf. Welcher 17jährige gibt sich schon ohne Absichten mit einer 12jährigen ab. Aber genau das will Maik. Maik hat keine Absichten, gar keine, hängt in seinem Leben, zwischen nichts und den vorwurfsvollen Kommentaren seiner Mutter. Sie beide, Jenny und Maik, entfliehen dem, was an ihnen klebt, einem Leben, das sie nicht teilen möchten.


 Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt.
Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt. So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben.
So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben.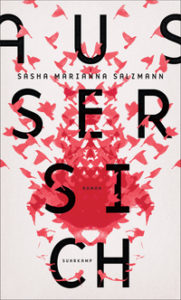 Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete.
Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete. Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche.
Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche. Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).
Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).
 Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt.
Die Reise im Auto wird zur Tortur im Faradayschen Käfig, aufgeladen mit Emotionen, die sich nicht erden können. Betty deponiert ihren wieder erstarkten Vater in Stresa. Und weil man nun schon einmal in Italien ist, geht die Fahrt weiter nach Bellegra, einem kleinen Nest nicht weit von Rom, wo auf dem Friedhof Bettys Vater Ernesto liegen soll, «eine Liebe, die keine Verbindung mehr hatte». Ernesto hatte sich in seinem Musikerleben vor langer Zeit abgesetzt. Ein Umstand, der nichts klärte und nur immer wieder Spekulationen aufkochen liess. Betty will nun endlich Klarheit, auch darüber, ob unter der Grabplatte auf dem Friedhof wirklich ihr Vater liegt. Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.
Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Nach «Durst ist schlimmer als Heimweh», «Ich habe Freunde mitgebracht «und «Takeshis Haut» ist dies ihr vierter Roman. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.
 Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut.
Schreiben war und ist Delius Stimme, sein Instrument, sein Sound. Nach dem Tod seines Vaters auf dessen Schreibmaschine getaktet. Er, der damals verschreckte Musiklaie, das Dorfkind, der Provinzler, der Predigersohn, Spätzünder sass mit einem Mal dort, wo sich die amerikanische Seele mit aller Radikalität und Intensität von den Verkrustungen und Verunsicherungen befreien wollte. Sei es der nie zu gewinnende Vietnamkrieg, das Attentat auf Kennedy. Alle Grenzen und Mauern sollten mit den Hörnern von Jericho niedergerissen werden, auch die Grenzen und Barrieren zwischen Schwarz und Weiss, dem zementierten Establishment und unüberwindbarer Armut. Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, in Hessen aufgewachsen, lebt seit 1963 in Berlin. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit achtzehn Bände. Friedrich Christian Delius wurde unter anderem mit dem Fontane- Preis, dem Joseph-Breitbach Preis und 2011 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.