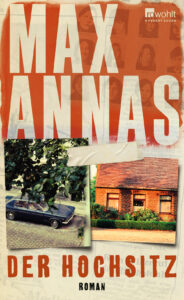Zum wiederholten Mal hat das Literaturfestival Literaare Thun den länderübergreifenden Wettbewerb für Lyrik und Spoken Word TEXTSTREICH ausgeschrieben. Dieses Jahr in Kooperation mit dem Literaturmagazin Manuskripte aus Graz und dem Haus für Poesie in Berlin.
«Die Geige verstecken» (Auszug) ist nicht der Wettbewerbstext, der exklusiv in der Literaturmagazin Manuskripte erscheint, aber ein freundlicherweise an literaturblatt.ch freigegebener Text:
«Die Geige verstecken» (Auszug)
Mein Gott, jetzt sitzt du da mit deiner Geige in der U-Bahn und hast fünfzigtausend weniger und dafür eine Angst
Jetzt hast du wirklich fünfzigtausend ausgegeben
Na und, sagst du dir
Na und
Fünfzig tausend für eine Geige
Fünf zig tausend für ein Stück Holz, das innen hohl ist
Das kann man doch keinem erklären
Deinen alten Freunden kannst du das nicht erklären
Neue hast du nicht
Du könntest sagen, das sei eine Geldanlage
Sicherer als Gold
Wovon kann man das schon behaupten, sicherer zu sein als Gold
Von dir nicht, du bist eine unsichere Anlage
Du schwankst
Die Pumps sind zu hoch
Du bist echt ein hoher Stapel
Du hast ein neues Kleid, du zupfst daran
Du weißt jetzt, dass es nicht zu deinem Mantel passt, weil du jetzt weißt, dass es verschiedene Schwarztöne gibt
Der Mantel ist tiefschwarz und das Kleid hat einen Lila-Blau-Schimmer
In den Kleidergeschäften werden dir jetzt Beratungen angeboten und du sagst nicht nein
Das hat doch nichts mehr mit Musik zu tun
Da hat dich doch was verlassen
Da hast du doch was übersehen, irgendwas nicht bemerkt
Jetzt fängst du schon wieder an, die Geige zu verstecken
Weil du dir eine für fünfzigtausend kaufen musstest und den Leuten nicht traust, weil du es ja weißt
Du weißt ja, wie sich der Neid anfühlt
Hungrig, geil, mit zu viel Spucke im Mund und einem steifen Nacken vom vielen Glotzen
Der Neid macht, dass du jemand sein willst, den du hasst
Oder dass du hasst, wer du sein willst
Jetzt hast du schon wieder die Angst auf dir sitzen
Du wirst geritten von der Angst
Die hockt dir auf den Schultern und peitscht dir den Hintern und trifft genau die Ritze
Du schmeißt die Angst nie ab, du machst andere Sachen
Du versteckst die Geige unterm Mantel
Du wirst jetzt immer einen Mantel tragen müssen, auch im Sommer
Du bist jetzt eine Angestellte und hast immer einen Mantel an
Das ist doch jetzt das
Das
Hier, das Ding
Wenn du die Angst abschmeißt, wie willst du dir dann beweisen, dass du jetzt eine von denen bist, die was zu verlieren haben, irgendein Ding
Du sagst jetzt Dienst zur Probe und Doppeldienst zum Konzert
Sicher und sicherer sind für dich blickdichte Adjektive geworden
Sie haben sich in deinen Wortschatz geschlichen und vor die Substantive gesetzt und du siehst die Substantive gar nicht mehr hinter ihnen
Du sagst, du hast es jetzt geschafft und hoffst, dass du bald auch mit dem Sprechen aufhören kannst, mit dir selber in der U-Bahn
Dass du einfach mal ein Buch lesen kannst und dabei einschlafen und dass dich ein Fremder weckt an der Endstation und dass ihr zusammen zurück fahrt und euch vorlest und dabei einschlaft, bis euch jemand an der Endstation weckt, ein Fremder, der euch auf dem Weg zurück was vorliest, bis ihr alle drei einschlaft und an der anderen Endstation geweckt werdet von einer Fremden, die liest und liest mit einer weichen Stimme und dann schläft, genau wie ihr und wenn ihr an der Endstation seid, weckt euch einer so sanft, dass ihr fast nicht aufgewacht wärt und setzt sich dazu und liest was vor und ihr habt alle die Köpfe auf fremden Schultern, und Hände voneinander im Schoß und schlaft vorsichtig zwischen euren Atemstößen und dann wird dem Vorleser der Kopf schwer und irgendwann kommt ihr wieder an, an der ersten Endstation und da ist alles schon wie immer geworden, es steigt eine ein und weckt euch, ganz schüchtern sieht sie aus und riecht gut und sie liest vor auf dem Rückweg, der gar kein Rückweg mehr ist und
Dass du einfach wieder runter fährst mit dem Aufzug
Das wäre doch kein
Naja das
Das wäre doch kein Ding
Du verdienst jetzt Geld mit Musik, sagst du dir selber ins Ohr
Fünfzigtausend für dein Arbeitsgerät
Andere haben Dienstwagen oder Dienstwaffen, sagst du dir
Du machst jetzt Online-Banking ohne Angst, ganz lässig bankst du hin und her
Das hat dir keiner geglaubt, du selber nicht, dass du einmal grüne Scheine aus dem Automaten ziehst, als wären es Fahrscheine für den Nahverkehr
Dass du mal den Nahverkehr bezahlst, das hätte keiner gedacht
Dafür hast du die Siedlung belogen
Hast gesagt, dass du schon verabredet bist, mit Leuten, die es gar nicht gibt, deinem Vater zum Beispiel
Denen hättest du das nicht erklären können, dass du eine Jugend lang Geige übst
Dafür bist du jeden Tag nach der Schule zu deiner Geigenlehrerin gefahren, zur Frau Zacharias
Die hat dich ins Gästezimmer gelassen und dir ihre Geige geliehen
Dass du üben kannst, ohne, dass es einer merkt
Dass du keine eigene Geige brauchst
Deine Mutter hätte das Geld irgendwie zusammengekratzt für eine schlechte Geige, aber die hättest du dann mit dir herumtragen müssen, das wäre ein Beweis gewesen, gegen den du nicht angekommen wärst
Dafür hast du dir den Bauchnabel piercen lassen, dass keiner merkt, dass du eigentlich eine mit einem heilen Bauchnabel bist, dass sie dir nicht auflauern, dass sie dich nicht abziehen
Dafür bist du aus der Siedlung raus, wo deine Mutter die Spritzen von deinem Bruder weggeräumt hat mit Handschuhen an und alles im Waschbecken verbrannt, die Handschuhe und die Spritzen
Obwohl man Plastik nicht verbrennen darf
Dafür bist du in eine andere Stadt mit einem historischen Stadtkern gezogen und ins Ausland und dann wieder zurück
Dafür hast du vier Jahre in einer Übezelle gehockt
Dafür wurde ein ganzer Keller ausgebaut, lauter Zellen, in die man die Musik mit den Studenten sperrt
Dass du den Nahverkehr bezahlst, wo sowieso nie kontrolliert wird, weil die Leute sich selber kontrollieren
Du warst mit der Musik eingesperrt, als wäre euer Aufzug stecken geblieben
Ihr wolltet zusammen hoch fahren, oder vielleicht war es Zufall
Vielleicht habt ihr euch doch erst so richtig im Aufzug kennengelernt, als du schon die Knöpfe gedrückt hattest nach oben
Die Musik hat dich so zart angeschaut, dass du ihr nichts abgeschlagen hast
Die wollte immer alles von dir, du musstest deine Tasche ausleeren und aus deinen Schulaufsätzen vorlesen
Die Musik hat dir versprochen, dass sie etwas hat, was du willst, aber sie hat nie gesagt, was das sein soll
Du hast der Musik alles geglaubt
Die hatte manchmal eine Zartheit
Um die hast du sie beneidet, weil du damals schon gewusst hast, dass du dir diesen Zartheitsluxus nicht leisten kannst
Die hat gestrahlt und du nicht, die hat dich bestrahlt bis du ganz warm geworden bist und irgendwie
Transparent
Irgendwie zart
Zartsein war ja immer so eine Idee von dir, die perverseste, die du je hattest
Von acht bis achtzehn Uhr, sechs Tage die Woche warst du in der Übezelle
Hast geübt, zärter zu werden, dass man dich nicht raus hört, aus der Musik, weil es größenwahnsinnig wäre, zu glauben, du hättest Mozart was hinzuzufügen
An dem anderen Tag hast du dich nutzlos gefühlt und bemerkt, dass man sonntags nicht einkaufen kann
An dem anderen Tag bist du vorm Netto gestanden und die automatische Glastür hat sich nicht auseinandergeschoben, du bist näher ran, wieder weg, die blieb zu
Da ist dir alles wieder eingefallen
Dass du eine feste Stelle im Orchester brauchst, die Öffnungszeiten, dass du dünn geworden bist, dass die Nadeln übrig bleiben, wenn man die Spritzen verbrennt, solche Sachen
Jetzt steigst du aus der Bahn und lässt dein Spiegelbild an der Scheibe sitzen, es ist so transparent wie du gern wärst, es ist das Bahngleis mit den ganzen Leuten, den Bänken, den Fliesen hinter deinem Gesicht
Auf dem Gleis krabbelt einer auf allen Vieren zwischen den Beinen der Leute
Einer der alles verloren hat, sein Alter, seinen Ausweis mit seinem Namen drauf, seinen Geruch, die Angst
Nur die kleinen dichten Locken hat er behalten
Es ist dein Bruder
Du weißt nicht, ob er dich erkennt, deine Locken hast du geflochten und eine Mütze drüber gezogen
Er schaut auch gar nicht her
Er war ja immer in Zuständen, die letzten Jahre, die ihr zusammen gewohnt habt, immer in Zuständen, solche, in denen er selber gar nicht mehr existiert hat, er ist verschwunden hinter seinen Zuständen, er war nichts anderes mehr als Zittern oder Krampf oder Kotze oder auf dem Rücken liegendes Lachen, das gegen die Decke knallt
Vor den Weihnachtsferien hatte dir die Frau Zacharias mal die Geige aufgedrängt, du solltest sie mitnehmen, dass du weiter üben kannst
Das hättest du ihr nicht erklären können, dass das nicht ging
Du hast überlegt, ob du die Geige auf dem Weg einfach stehen lässt und sagst, du hättest sie verloren
Aber in der Stadt warst du so stolz, eine mit dir rum zu tragen, dass du es nicht übers Herz gebracht hast
Du hast sie immer weiter mitgenommen
Als du von der Bahn in den Bus umgestiegen bist, hast du im Supermarkt eine große Tüte gekauft, mit einem Zipper, in der man Tiefgekühltes transportiert, hast die Geige aus dem Kasten genommen und den auf dem Supermarktparkplatz stehen lassen, hast die Jacke ausgezogen und die Geige darin eingewickelt und alles zusammen in die Tiefkühltüte gesteckt, die nicht mehr zuging
Dann bist du erst in den Bus eingestiegen, wo du angefangen hast, Leute zu kennen und hast dich unterhalten
Gefroren hast du, aber das Zittern hast du dir nicht erlaubt, bis du in der Wohnung warst
Dein Bruder hat nicht gefroren, der lag in seinem Zimmer mitten in seinem Zustand und hat gelacht und auf den Boden eingeschlagen
Und du hast im Zimmer nebenan die Geige festgehalten, die Stimme von der Frau Zacharias im Ohr, du sollst nicht so krampfen, nicht so klammern, beim Spielen, obwohl du noch nicht einmal gespielt hast, nur die Geige festgehalten
Und in denselben Ferien gab es den Tag, an dem es im Zimmer deines Bruders stiller war als sonst, als du dachtest, heute musst du dich nicht schämen, die Musik zu dir nach Hause einzuladen und hast dich nicht zurückgehalten, hast gespielt, ohne Angst, dass die Siedlung dich entlarvt, dir die Geige wegnimmt, hast bemerkt, dass das eine Amputation wäre, eine sehr schwierige Operation, die kaum einer kann und das hat dich beruhigt, man hat ja auch nicht ständig Angst, dass einem die Beine abgenommen werden und die Musik hat zu allem ja gesagt, hat dir alles erlaubt, du bist schier abgehoben vor Glück, bist schier Luft geworden und die Musik hat dich umarmt mit ihren Flügelchen, die Musik kann nämlich Luft umarmen, da warst du umarmt und trotzdem frei und hast gewusst, das kann dir sonst keiner geben, da hast du gewusst, dass du jetzt etwas weißt und als es dunkel war, bist du ins Wohnzimmer und da lag deine Mutter auf der Couch und dein Bruder war kein Zustand, sondern dein Bruder, und er hat ihr Isabel Allende vorgelesen und du warst sauer auf die Musik, dass sie dich so lange in deinem Zimmer in ihren Flügelchen festgehalten hat, dass du nicht mit deiner Mutter auf der Couch eingeschlafen bist unter dem fransigen Stehlampenlicht und dein Bruder hat gesagt, aus dir wird mal was, aus dir wird mal eine Musikerin, und er hat so gestrahlt dabei, da bist du der Musik hinterher, in den Aufzug eingestiegen
Nora Schramm (1993) studiert Theorien und Praktiken professionellen Schreibens in Köln. 2021 war sie Stipendiatin des 1:1 Mentoringprogramms am Literaturbüro NRW. Ihre Texte wurden in diversen Zeitschriften veröffentlicht, ihr Hörspiel FRIEDEN UND RUHE auf dem Theaterfestival «Poligonale» als szenische Lesung gezeigt.
Literaare Literaturfestival Thun
Beitragsbild © Siggi Herbst



 „In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel“ ist immer wieder durchsetzt von Sätzen, die wie Mantras auftauchen und manchmal ist ein Satz wie ein Monolith aus einer Seit ganz allein. Eine Geschichte, aus der die Autorin nicht aussteigen kann. Eine Geschichte, die einem bewusst macht, wie zerbrechlich das Fundament einer Zehnjährigen sein kann und wie viel Kraft eine junge Seele aufbringen muss, um zusammenzuhalten, was auseinanderzubrechen droht.
„In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel“ ist immer wieder durchsetzt von Sätzen, die wie Mantras auftauchen und manchmal ist ein Satz wie ein Monolith aus einer Seit ganz allein. Eine Geschichte, aus der die Autorin nicht aussteigen kann. Eine Geschichte, die einem bewusst macht, wie zerbrechlich das Fundament einer Zehnjährigen sein kann und wie viel Kraft eine junge Seele aufbringen muss, um zusammenzuhalten, was auseinanderzubrechen droht.



 Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «
Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «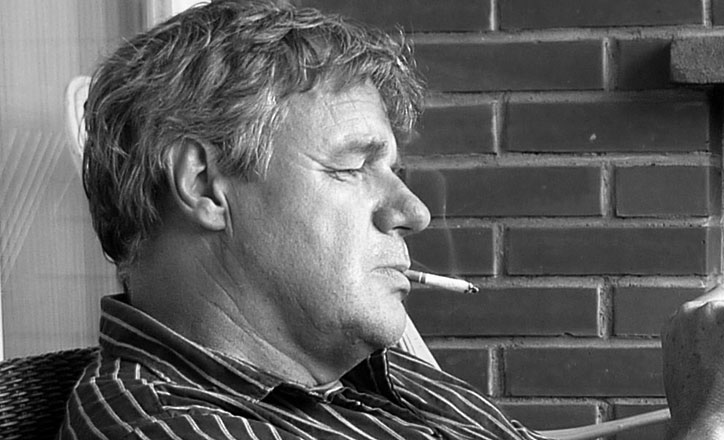


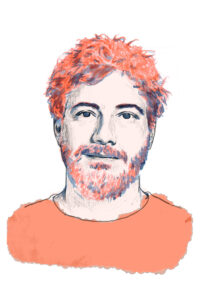






 Theres Roth-Hunkeler, geboren 1953 in Hochdorf Luzern, lebt heute in Baar bei Zug und oft in Berlin. Schreiben, Lesen und Literaturvermittlung sind ihre Schwerpunkte, die auch ihre langjährige Lehrtätigkeit an Kunsthochschulen prägten. Die Autorin hat neben Erzählungen und journalistischen Texten fünf Romane publiziert, zuletzt «Allein oder mit andern» (2019) und das Text-Bild-Werk «Lange Jahre» (2020) mit Bildern der Malerin Annelis Gerber-Halter.
Theres Roth-Hunkeler, geboren 1953 in Hochdorf Luzern, lebt heute in Baar bei Zug und oft in Berlin. Schreiben, Lesen und Literaturvermittlung sind ihre Schwerpunkte, die auch ihre langjährige Lehrtätigkeit an Kunsthochschulen prägten. Die Autorin hat neben Erzählungen und journalistischen Texten fünf Romane publiziert, zuletzt «Allein oder mit andern» (2019) und das Text-Bild-Werk «Lange Jahre» (2020) mit Bildern der Malerin Annelis Gerber-Halter.

 Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.
Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012) sowie zuletzt Rainer-Malkowski-Preis (2016) und Christine-Lavant-Preis (2018). Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung «Im Schläfengebiet» ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen.