Man fühlt sich nicht unbedingt fremd, da wo man gerade ist und doch denkt man für sich, dass man sich auch nicht unbedingt wie zu Hause fühlt, da wo man gerade ist. In diese Gedanken dann mischen sich Bilder, Bilder von früher und damals, Bilder vor dem inneren Augen, dem Innenauge; leicht verzerrt sieht man also vor dem Innenauge Bilder und denkt sich, ob das, was auf diesen Bilder ist wohl dorthin gehört, wo man sich zu Hause fühlt. Diese Bilder sind grün und braun und man denkt sich, das also sind sie, die Farben von damals, die einen nicht verlassen haben, und die noch immer gespeichert sind, da drinnen, tief drinnen in einem selber. Und man sieht auf diesen Bildern Umrisse von Hügeln und Gestalten, erahnt die Formen und denkt sich, das also sind sie, die Formen von damals – auch sie haben einen nicht verlassen.
Und genau in diesem Moment, in dem man sich dies alles fragt und dies alles für sich denkt, da zuckt der Himmel, genau in diesem Moment türmen sich Wolken auf, als wollen sie ein Turm bauen da oben im zuckenden Himmel. Und man erschrickt sich ein wenig, weil es so laut ist und so plötzlich, so plötzlich und laut eben, dass man sich erschrecken muss, gar nicht anders kann als sich zu erschrecken. Doch es ist kein böses Donnern und Grollen, das man hört und ab dem man sich erschreckt hat, schon gar kein unheimliches geschweige denn ein bedrohliches, es ist lediglich ein Donnern und Grollen, das sich seinen Weg gebahnt hat bis zu einem, bis dahin, wo man gerade sitzt oder liegt oder steht. Und es ermahnt einen, es gebe noch diesen Ort, diesen Ort gebe es doch, der einen jetzt rufe mit Wolkentürmen und zuckendem Himmel; es ist der Ruf nach dahin, dem Ort, wo man früher war und dachte, das ist es, hier dieser Ort, hier will man sein und bleiben, hier zu diesem Ort gehört man.
Und trotzdem man das wusste ging man weg, irgendwann dann eben doch weg, weil es könnte ja doch noch andere Orte geben und vielleicht gibt es woanders einen Ort, zu dem man sogar noch mehr gehört. Aber man zögert keine Sekunde damit, ihm zu folgen, diesem Ruf, der einen plötzlich ereilt und man braucht nicht zu fragen, wo er ist, dieser Ort, weil ehe man sich versieht, ist es lauter zu hören; das Donnern und das Grollen über dem Kopf und man sieht einen zuckenden Lichtstrahl quer über den Himmel, der wie zufällig die Richtung anzeigt. Und man muss nicht rennen, nicht hasten, gar darob stolpern, nur folgen diesem Ruf der ruft: Hier, komm, hier, hier ist dein Ort.
Und anstatt dass man im Gewitter den Kopf einzieht, streckt man ihn hoch, hoch in den Himmel und zwar so hoch, dass man ihn plötzlich in den Wolken hat und darüber und runter schaut auf die eigenen Füsse, die weit unter einem über grüne Hügel dem Ruf folgen. Man denkt nicht, muss nicht nachdenken, denn es läuft automatisch, die Füsse und alles was dazu gehört laufen ganz automatisch.
Unten sieht man bald Kühe, klein und braun, so braun wie die Häuser, die ebenfalls klein im Blickfeld von hoch oben aus dem Himmel stehen und zwar nicht angeschmiegt an die Hügel sondern thronend auf deren Kuppen. Sie sagen Hallo hier bin ich und auch wenn ich alt bin und klein und in deinen Augen nichts Besonderes, ich stehe hier, werde stehen bleiben, thronend auf der Kuppe der Hügel. Und mit dem Kopf oben in den Wolken sorgt man sich um diese kleinen Häuser auf ihren Kuppen mit ihrem altehrwürdigen Braun, das nur zum Schein unscheinbar ist, weil dahinter sich ja Geschichte verbirgt, nicht nur Geschichte sondern auch Geschichten, von Menschen, die einst gewohnt haben in diesen alten und kleinen Häusern; Geschichten von Menschen, die darin gewohnt haben und gelebt, die darin gelacht haben und manche wohl auch geweint. Und so sorgt man sich weil man den Kopf in den Wolken hat mitten im Donner und Gewitter und deshalb weiss um die Blitze, die sich noch immer wie zuckende Lichtstrahle, manche wie Lichtgestalten gar, quer durch den Himmel ziehen und nicht nur das, sondern sich zuweilen auch frech dem Boden nähern, der Erde, ebendieser auf welcher die braunen Häuser auf den Hügeln thronen.
Und dann, auf einmal hört man da oben mit den Ohren voll Wolken und Nass und Regen ein paar Töne, Klänge viel mehr und denkt sich ob das wohl die gleichen sind wie damals, früher, als man noch viele solcher Klänge hörte in dieser Gegend; und dass man irgendwann keine solche Klänge mehr gehört hat, hat nicht daran gelegen, dass es keine mehr gab, hier in dieser Gegend, sondern dass man selber weg war, also nicht mehr in der Gegend, ortsfremd und ortsfern geworden war, und solche Klänge nur mehr im leichten Schlaf gehört hatte, sozusagen im Traum obwohl die Tiefschlafphase nicht erreicht war. Denn so fein sind die Klänge, dass sie da nicht durchkommen, durchdringen, nicht so weit hinein reichen wie in die Tiefschlafphase in der normalerweise die Träume einen ereilen. Und so fragt man sich, ob man wieder träume, einen dieser Leichtschlaf-träume, das fragt man sich wenn man sie plötzlich wieder hört, diese Klänge. Bis man sie aber hört, immer deutlicher, mehr und lauter und weiss, dass kann kein Leichtschlaf-traum sein; nein sie sind da in aller Wirklichkeit, sie schwingen und klingen und finden das Ohr auch im Regen und durch die Wolken, Klänge, die sich gegenseitig suchen und finden, sich übereinanderlegen und einander folgen, Klänge aus Mündern, die sich im Kreis formieren.
Und so will man sich bücken, den Kopf aus den Wolken ziehen, gestrengter hinhören, mehr erhaschen von diesen Klängen, die drinnen im Innenohr, im Drinnenohr gespeichert waren trotz Ortsfernheit; trotz dessen dass man das Weite gesucht hatte, wortwörtlich die Weite, die Ebenen, die Durchatmungslandschaften in denen keine Erhebung den Blick aufhält. So lange hatte man dies Weite gesucht bis es gefunden war um dann doch zu denken: Ach, wie wäre es schön es gäbe eine Erhebung, ein Hügel oder Berg, die den Blick aufhalten würde.
Und während dem gestrengten Hören, dem Erhaschen dieser Klänge, Klänge, die einen Erinnerungsschleier lichten, lichten sich auch die Wolken, der Dunst vom Regen und man erhascht nicht nur die Klänge sondern auch den Blick auf einen Berg. Ein Berg, den man doch kennt, so denkt man für sich, einer wie es ihn nur einmal gibt und wie man ihn unter allen Bergen wiederfinden würde, ganz gleich wo und unter welchen Bergen. Und während man ihn betrachtet diesen Berg durchfährt es einen; es durchfährt einen mit der Gewissheit ob der eigenen Naivität und man lacht leise in sich hinein, über sich selber lacht man leise in sich hinein, dass man so naiv war und woanders gesucht hatte.
Und während man lacht, leise in sich hinein und über sich selber, ja während man also so lacht und gleichzeitig läuft, ganz automatisch läuft, währenddessen schickt man seinen Blick an den Berg und denkt, gut, dass es ihn gibt. Diesen Berg, um den man so froh ist, glücklich auch, ihn zu sehen, wieder zu erblicken, und zwar so sehr, dass man ihn gern aufgreifen möchte, einpacken, einstecken und zwar in die Hosentasche, um sich an ihm zu erfreuen ganz heimlich, noch mehr aber um ihn zu jedem Zeitpunkt aus der Tasche nehmen zu können, vor sich aufzustellen und einen Blick darauf zu werfen, auf diesen Berg, der Erinnerungsschleier lichtet. Dann aber mahnt einen das Donnern und Grollen – dieser Ruf – daran, nirgendwo hin zu gehen, wo man ihn bräuchte, diesen Berg in der Hosentasche, weil man doch da ist, wo er steht, im Original, gross und verankert; dass man da hingehen soll, und ebenso da bleiben soll, wo es nicht nötig ist, den Berg aus der Hosentasche zu nehmen, weil er ja vor einem steht, original, gross und verankert.
Und dann, ganz langsam, schleichend sogar verziehen sich die Wolken und die Türme und man realisiert, dass auch das Donnern und Grollen ein Ende nimmt, gar schon genommen hat, dass man kein Donnern und Grollen mehr im Ohr hat und auch keinen Regen im Auge oder auf den Füssen, sogar wieder über trockene Hügel läuft. Wenn also das Donnern und Grollen aufgehört hat, denkt man sich dann, oder fragt sich vielmehr, ob also der Ruf zu Ende ist, weil man da ist, wohin es einen gerufen hat. Und man schaut umher und sieht so viel Grün in all seinen Schattierungen, ein Grün, das sich hervortut unter den Wolken, die letzten Wolken sogar vertreibt und weil es sich so vertraut anfühlt, dieses Grün zu sehen und mehr noch, es unter den Füssen zu haben, kommt man nicht umhin zu lächeln. Denn wenn es also so ist, dass der Ruf zu Ende ist, dann bedeutet das, dass man wieder da ist; an dem Ort, der zu einem gehört und an dem Ort, zu dem man selber auch gehört.
Dann lächelt man also und sucht das passende Wort für diesen Ort und freut sich über den Reim, aber sucht dann weiter und man lächelt noch mehr, strahlt sogar, lacht auch laut vor Freude und etwas Schalk, weil man es gefunden hat, das Wort. Und man lacht weiter, ganz laut und sogar immer lauter und ist froh, dass man ihn wieder gefunden hat, diesen Ort, wieder hierher gefunden hat, nicht nur das sondern auch ein Wort gefunden hat für ihn, diesen Ort und denkt für sich, zum Glück bin ich gefolgt, diesem Donnern und Grollen, das mich ereilt hat, zum Glück bin ich gefolgt diesem einen Ruf, diesem Ruf nach Heimat, zum Glück.
Rebecca C. Schnyder, 1986 in Zürich geboren, lebt und arbeitet als freie Autorin (Drama/Hörspiel, Prosa) in St. Gallen. Für ihre Arbeiten erhielt Rebecca 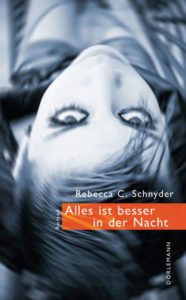 C. Schnyder mehrere Auszeichnungen, unter anderem den «Preis für das Schreiben von Theaterstücken» der Schweizerischen Autorengesellschaft, den Jurypreis am Autorenfestival SALZ! am Theater Lüneburg, den Publikumspreis am Autorenwettbewerb der Theater Konstanz und St. Gallen und zuletzt den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. 2013/2014 war Rebecca C. Schnyder Teilnehmerin am Dramenprozessor am Theater Winkelwiese in Zürich und wurde mit «Alles trennt» zum Heidelberger Stückemarkt 2015 eingeladen (verteten durch Hartmann&Stauffacher Verlag). Seit Februar 2016 ist der Debütroman «Alles ist besser in der Nacht» im Buchhandel erhältlich (Dörlemann Verlag, 2016, Zürich).
C. Schnyder mehrere Auszeichnungen, unter anderem den «Preis für das Schreiben von Theaterstücken» der Schweizerischen Autorengesellschaft, den Jurypreis am Autorenfestival SALZ! am Theater Lüneburg, den Publikumspreis am Autorenwettbewerb der Theater Konstanz und St. Gallen und zuletzt den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. 2013/2014 war Rebecca C. Schnyder Teilnehmerin am Dramenprozessor am Theater Winkelwiese in Zürich und wurde mit «Alles trennt» zum Heidelberger Stückemarkt 2015 eingeladen (verteten durch Hartmann&Stauffacher Verlag). Seit Februar 2016 ist der Debütroman «Alles ist besser in der Nacht» im Buchhandel erhältlich (Dörlemann Verlag, 2016, Zürich).

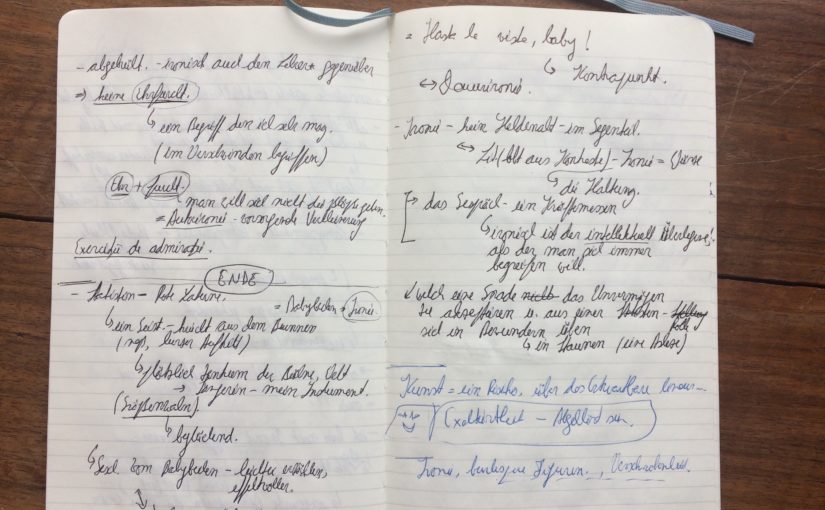

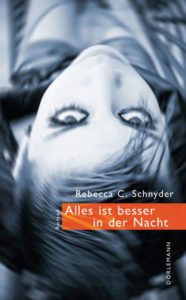 C. Schnyder mehrere Auszeichnungen, unter anderem den «Preis für das Schreiben von Theaterstücken» der Schweizerischen Autorengesellschaft, den Jurypreis am Autorenfestival SALZ! am Theater Lüneburg, den Publikumspreis am Autorenwettbewerb der Theater Konstanz und St. Gallen und zuletzt den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. 2013/2014 war Rebecca C. Schnyder Teilnehmerin am Dramenprozessor am Theater Winkelwiese in Zürich und wurde mit «Alles trennt» zum Heidelberger Stückemarkt 2015 eingeladen (verteten durch Hartmann&Stauffacher Verlag). Seit Februar 2016 ist der Debütroman «Alles ist besser in der Nacht» im Buchhandel erhältlich (Dörlemann Verlag, 2016, Zürich).
C. Schnyder mehrere Auszeichnungen, unter anderem den «Preis für das Schreiben von Theaterstücken» der Schweizerischen Autorengesellschaft, den Jurypreis am Autorenfestival SALZ! am Theater Lüneburg, den Publikumspreis am Autorenwettbewerb der Theater Konstanz und St. Gallen und zuletzt den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. 2013/2014 war Rebecca C. Schnyder Teilnehmerin am Dramenprozessor am Theater Winkelwiese in Zürich und wurde mit «Alles trennt» zum Heidelberger Stückemarkt 2015 eingeladen (verteten durch Hartmann&Stauffacher Verlag). Seit Februar 2016 ist der Debütroman «Alles ist besser in der Nacht» im Buchhandel erhältlich (Dörlemann Verlag, 2016, Zürich).
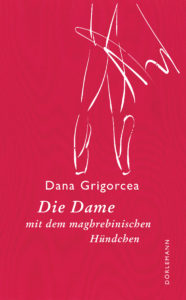 Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman «Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit» wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling «Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare» ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag neu erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit Mann und Kindern in Zürich.
Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman «Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit» wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling «Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare» ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag neu erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit Mann und Kindern in Zürich.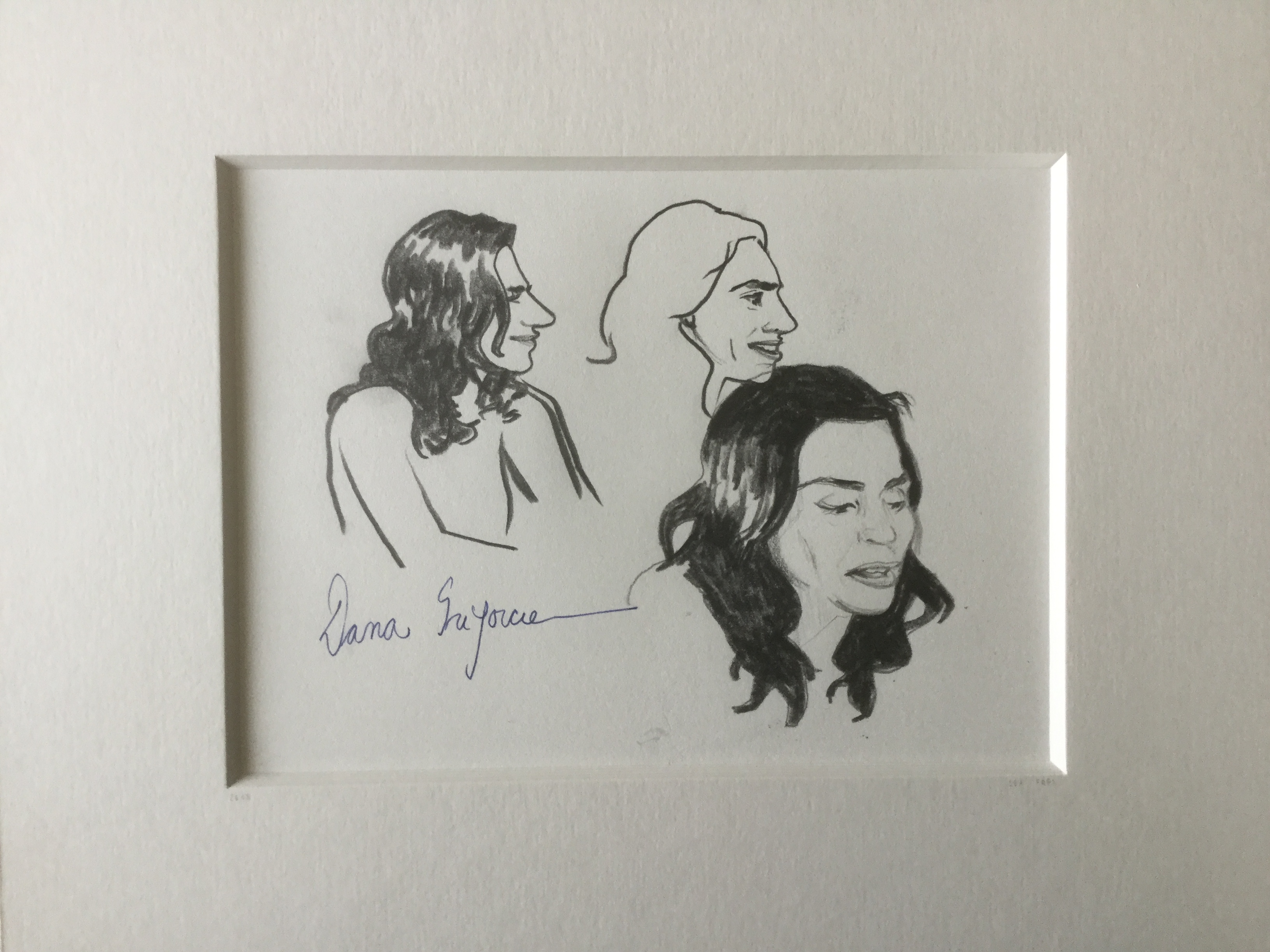

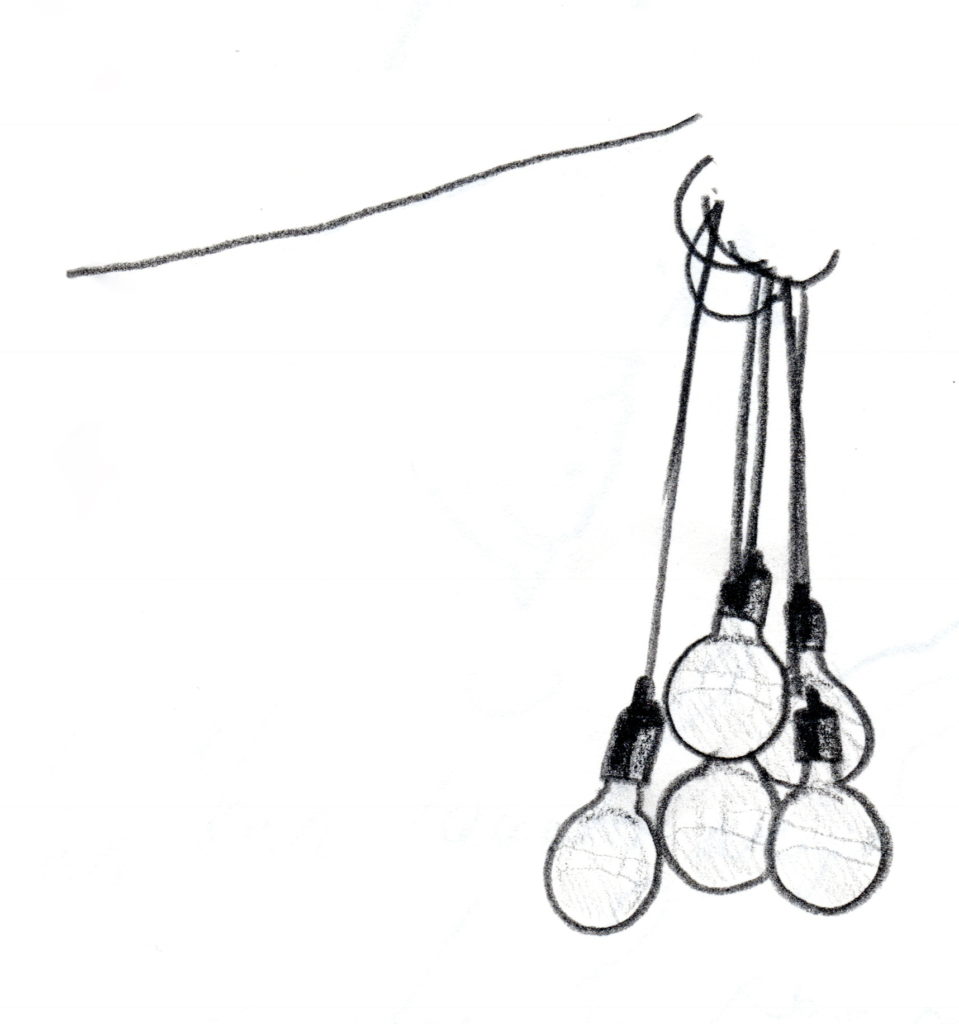
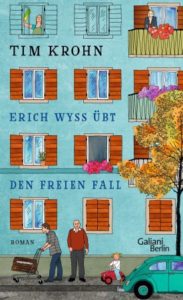 Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.
Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.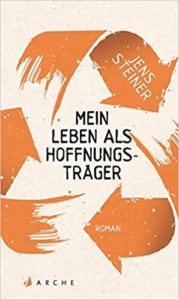 „Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.
„Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus. „verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“
„verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“
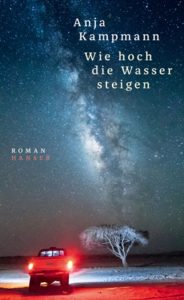 ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.
ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.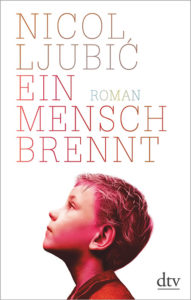 Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.
Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

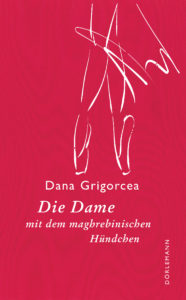 hingezogen, nicht nur weil er jünger als sie zu sein scheint. Sie treffen sich wieder, immer wieder, fast jeden Tag. Gürkan entschuldigt sich für seine Küsse. Während er sich immer tiefer in den Zwist mit seinem Gewissen manövriert, treibt es Anna immer offensichtlicher hin, ihre Leidenschaft für diesen Mann in die Öffentlichkeit zu tragen. Während es Gürkan zu zerreissen droht, provoziert sie immer offensiver das Schicksal. Etwas, was auch ihr Mann spürt und die Umgebung an Ihrem Arbeitsplatz. So sehr, dass sie unverhofft zu einem vielleicht letzten Engagement als Primaballerina kommt. Noch einmal eine Hauptrolle. Gürkan droht in seinem inneren Zwist zu versinken, während der Stern Annas noch einmal alles überstrahlen soll.
hingezogen, nicht nur weil er jünger als sie zu sein scheint. Sie treffen sich wieder, immer wieder, fast jeden Tag. Gürkan entschuldigt sich für seine Küsse. Während er sich immer tiefer in den Zwist mit seinem Gewissen manövriert, treibt es Anna immer offensichtlicher hin, ihre Leidenschaft für diesen Mann in die Öffentlichkeit zu tragen. Während es Gürkan zu zerreissen droht, provoziert sie immer offensiver das Schicksal. Etwas, was auch ihr Mann spürt und die Umgebung an Ihrem Arbeitsplatz. So sehr, dass sie unverhofft zu einem vielleicht letzten Engagement als Primaballerina kommt. Noch einmal eine Hauptrolle. Gürkan droht in seinem inneren Zwist zu versinken, während der Stern Annas noch einmal alles überstrahlen soll. Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman „Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit“ wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling „Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare“ ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Perikles Monioudis, und Kindern in Zürich.
Dana Grigorcea, geboren 1979 in Bukarest, studierte Deutsche und Niederländische Philologie in Bukarest und Brüssel. Mit einem Auszug aus dem Roman „Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit“ wurde Dana Grigorcea in Klagenfurt beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb 2015 mit dem 3sat-Preis ausgezeichnet. Ihr Erstling „Baba Rada. Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare“ ist im Oktober 2015 ebenfalls im Dörlemann Verlag erschienen. Nach Jahren in Deutschland und Österreich lebt sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Perikles Monioudis, und Kindern in Zürich.
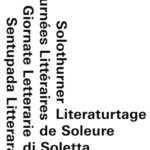 Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört.
Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört. «Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,
«Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,  dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017»
dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017» «Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen,
«Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen, 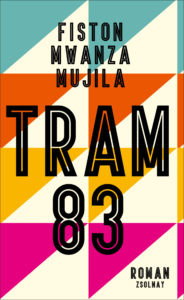 egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt.
egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt. «Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist.
«Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist.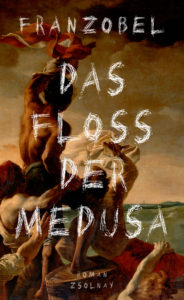 Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.
Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.